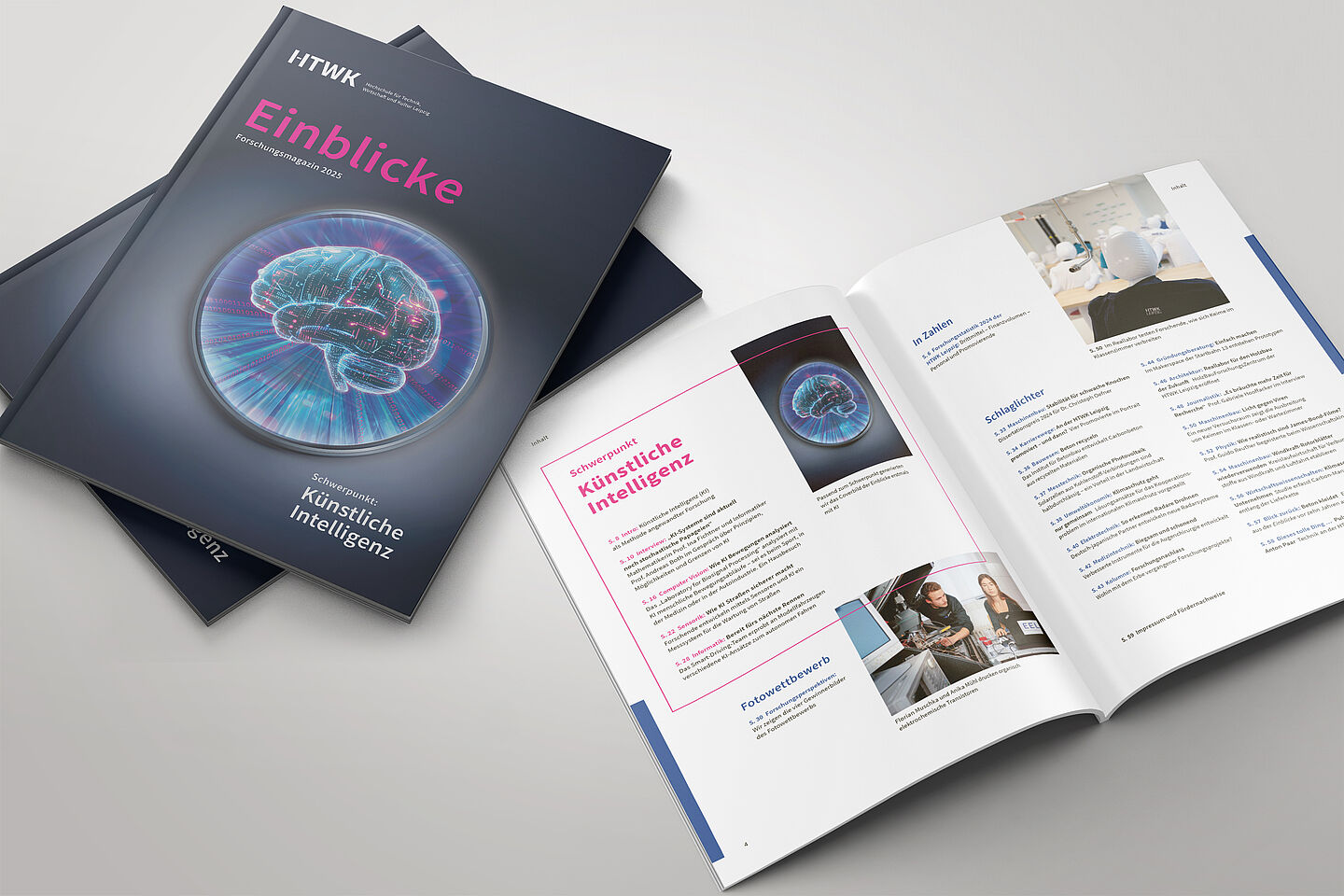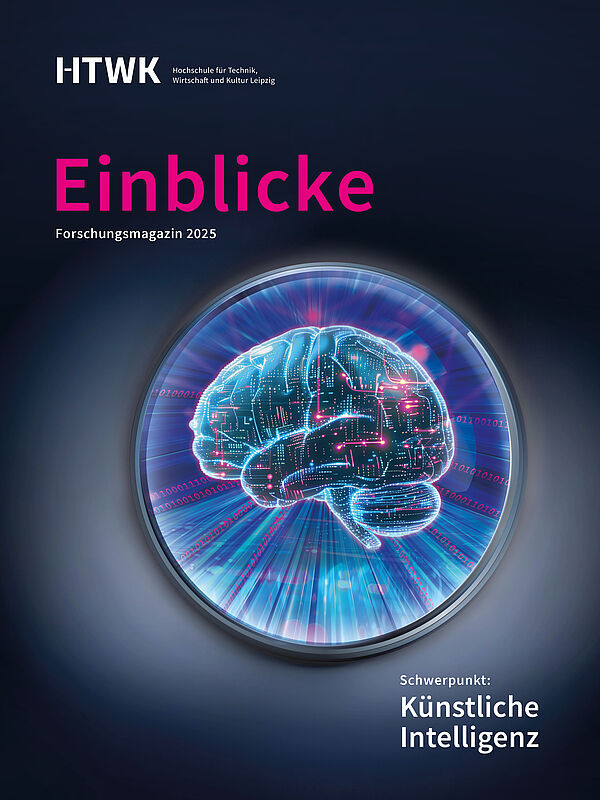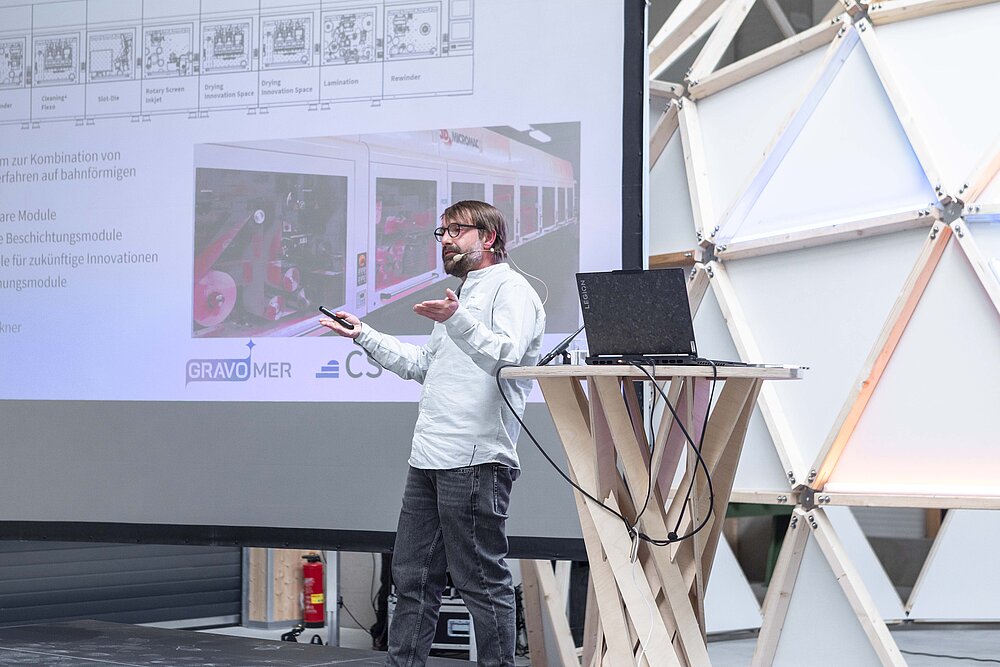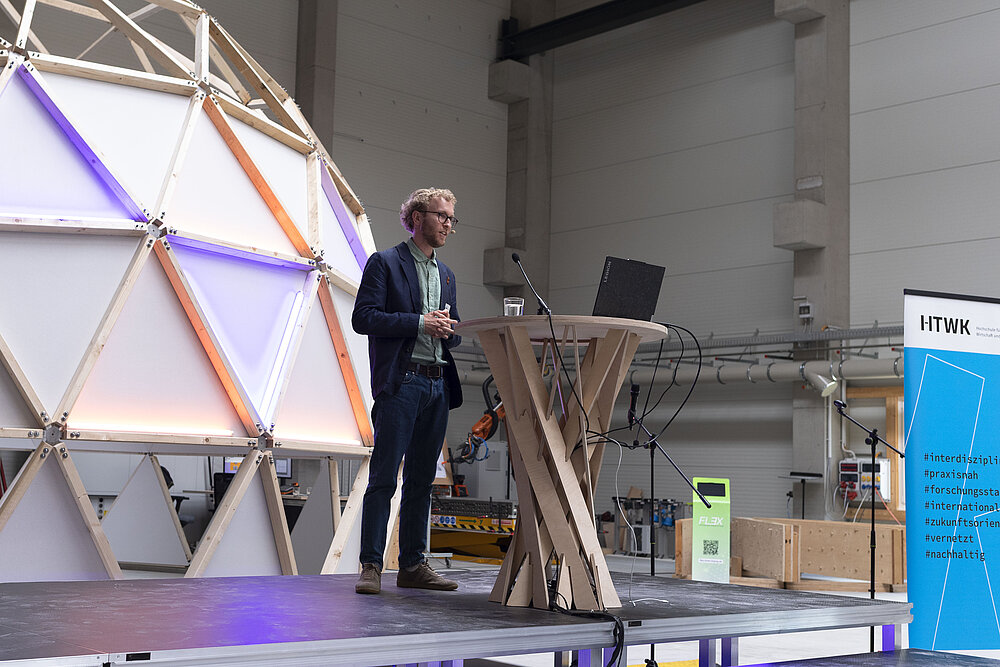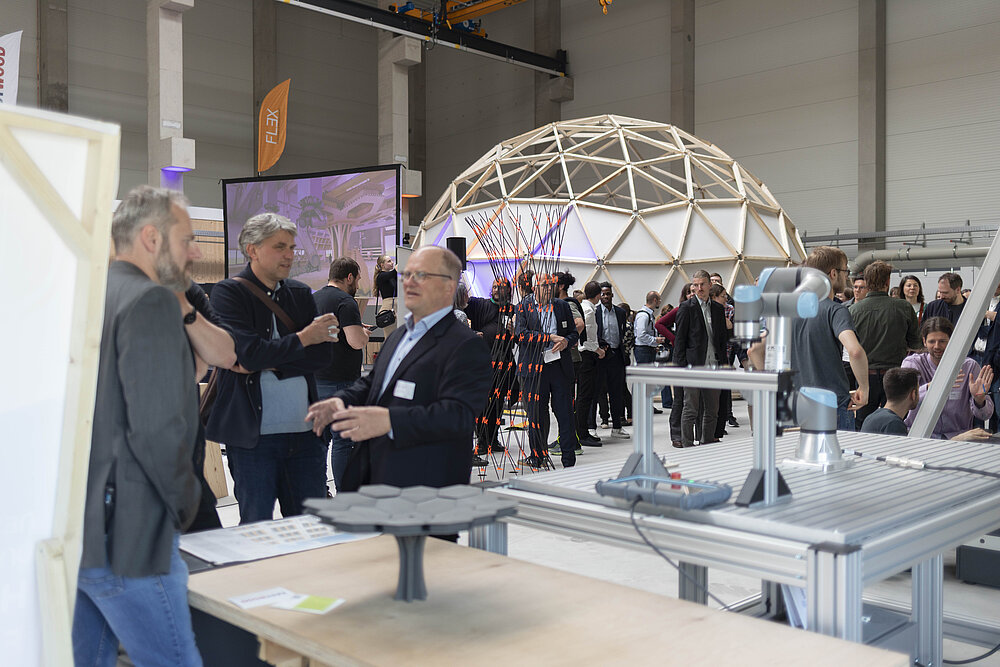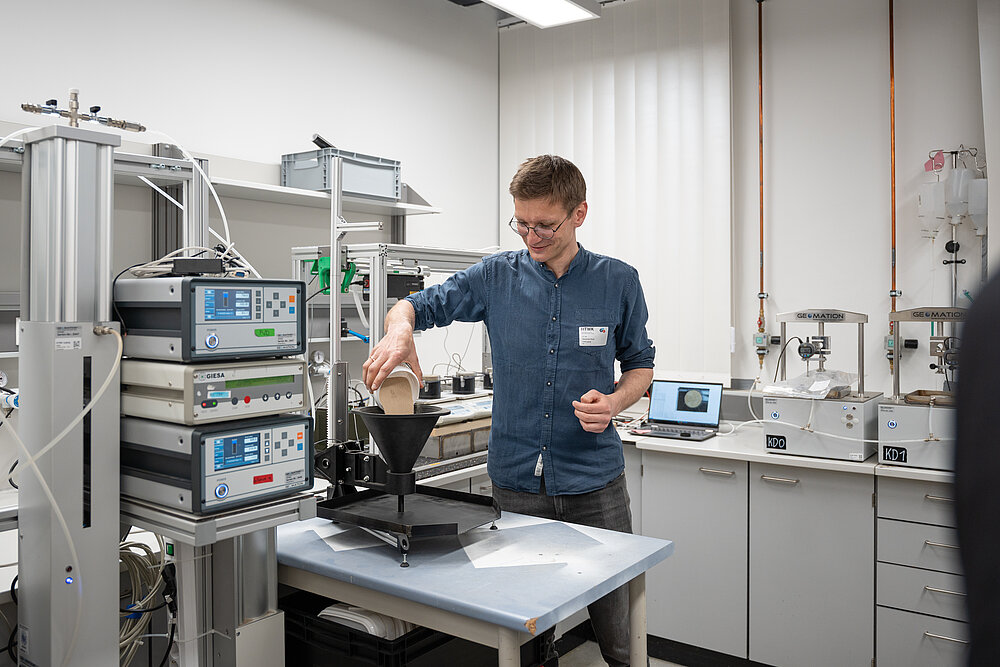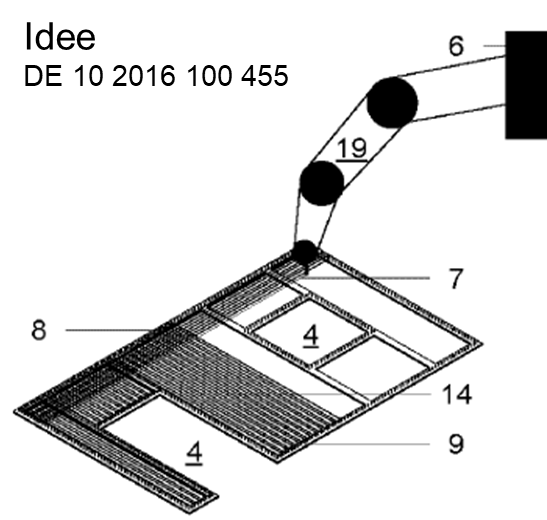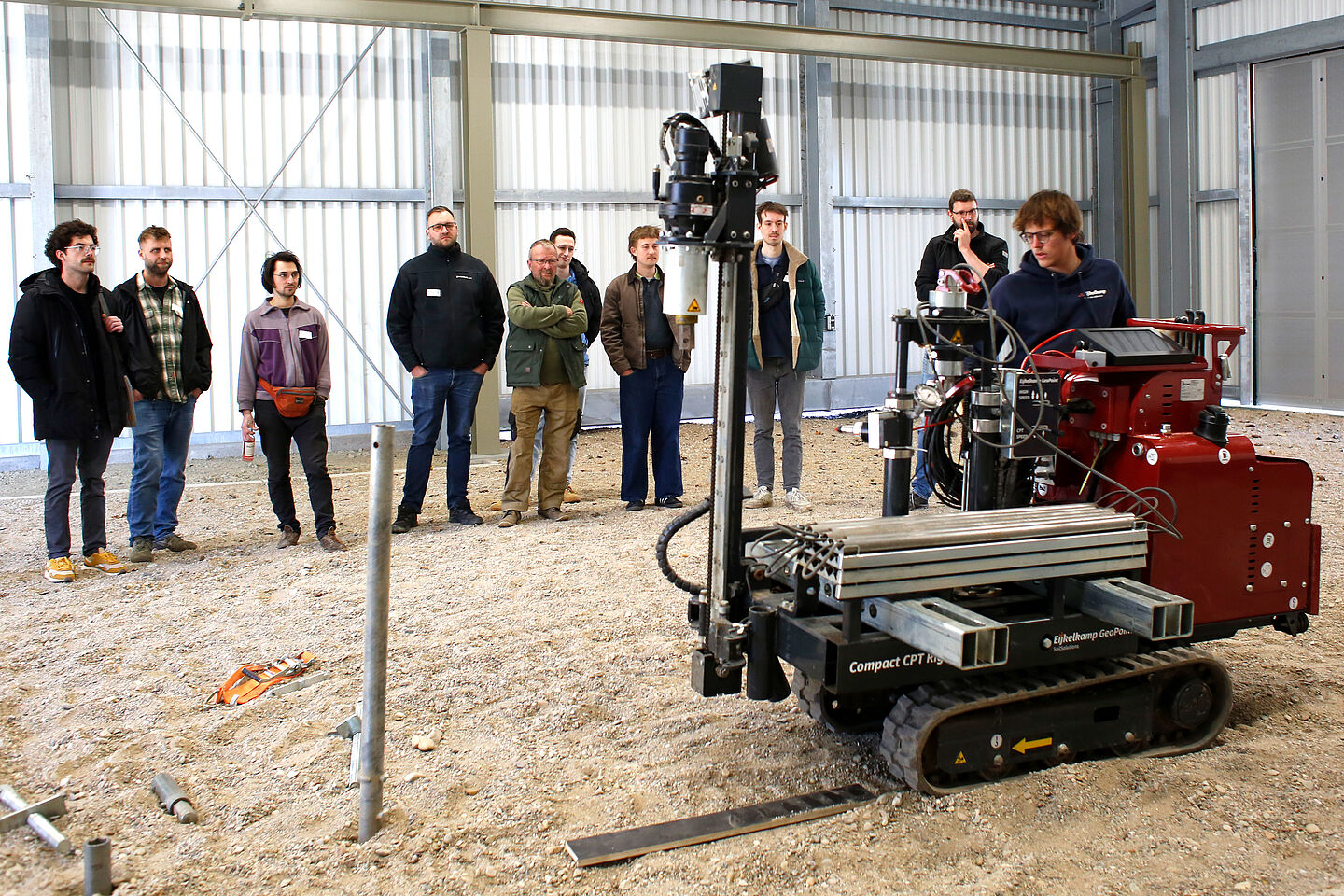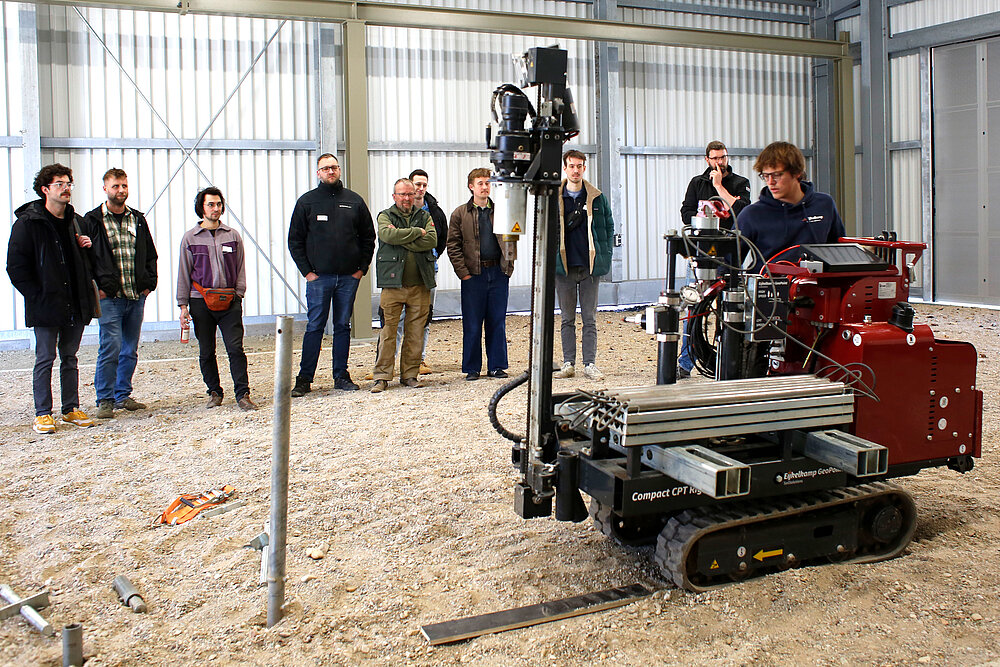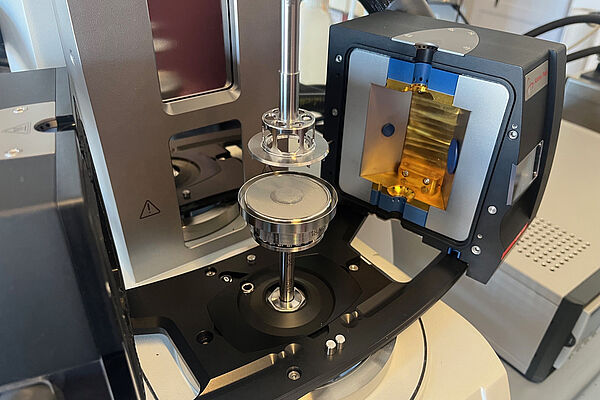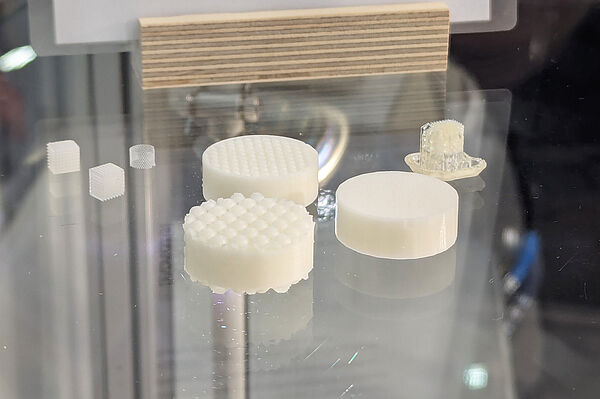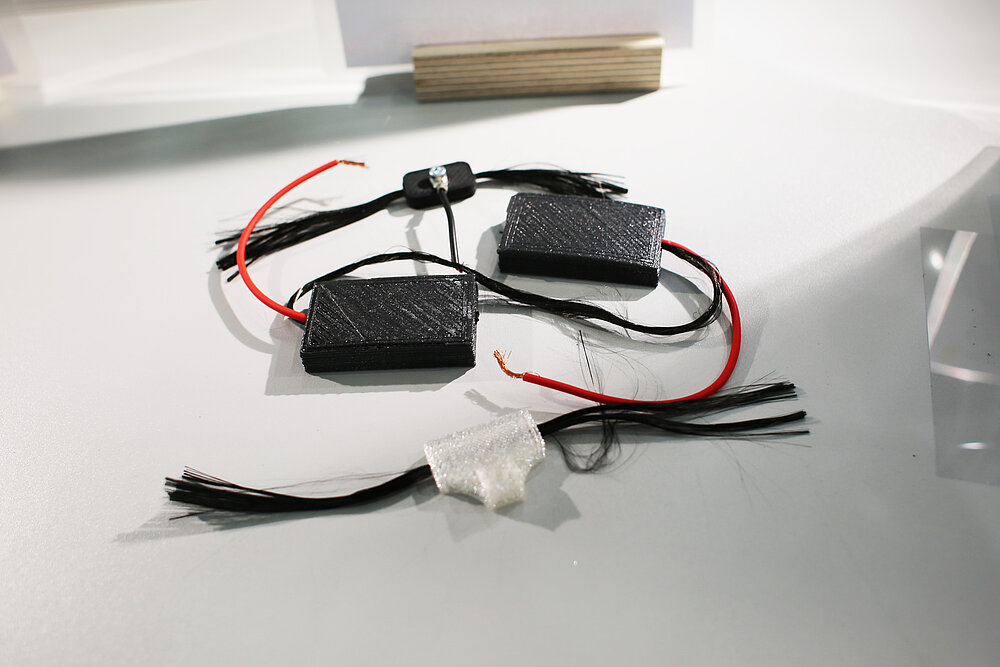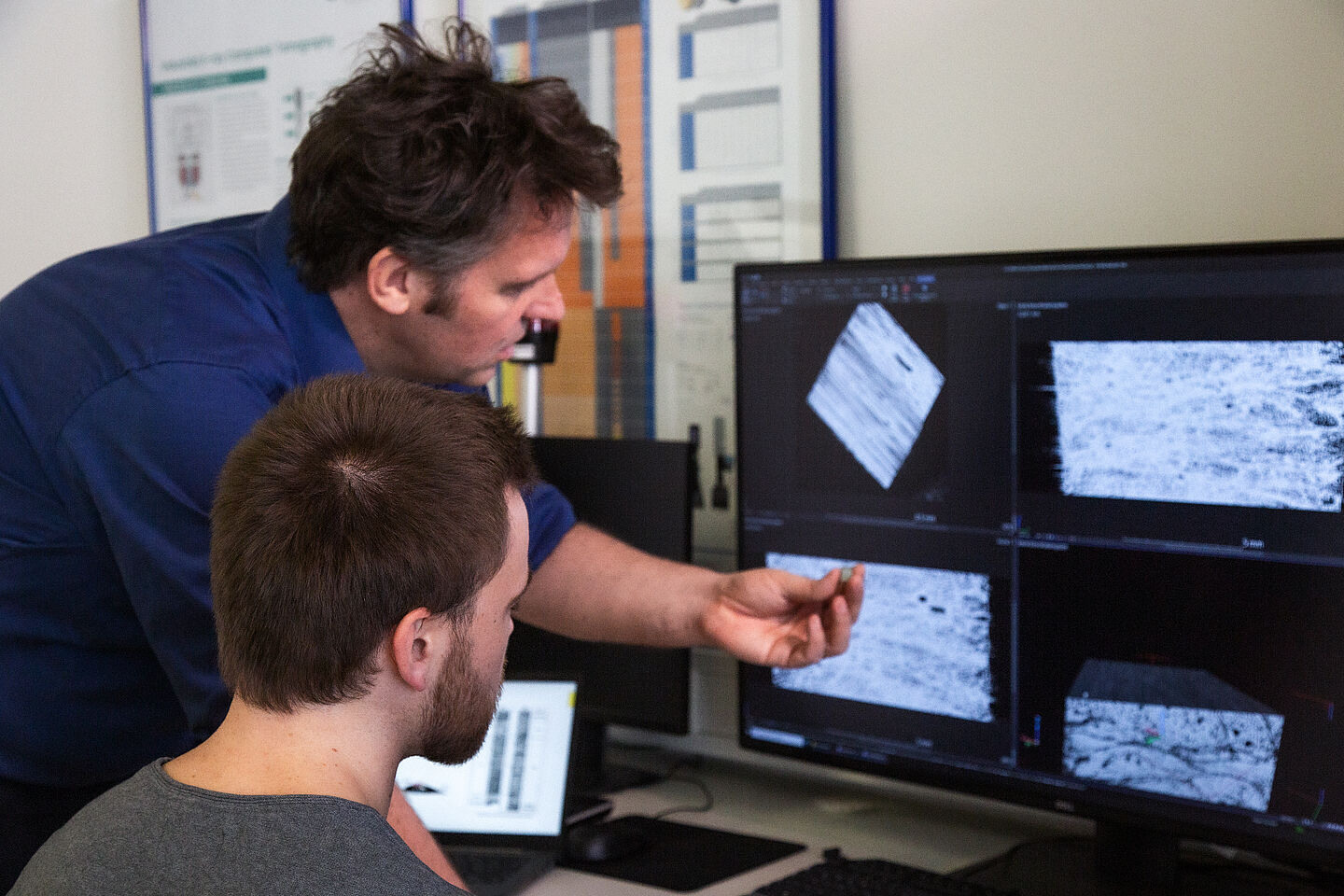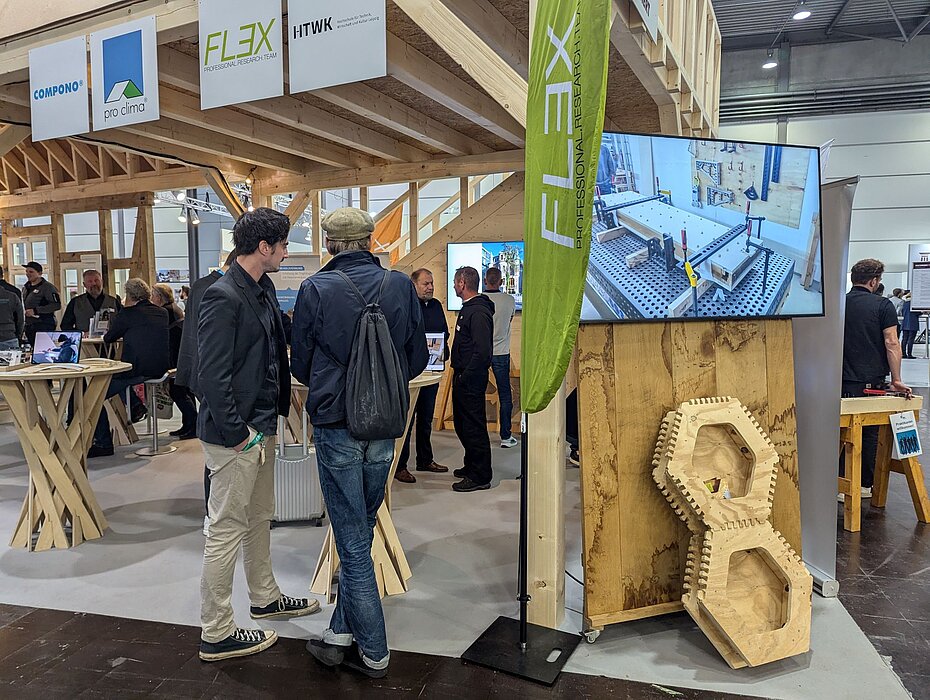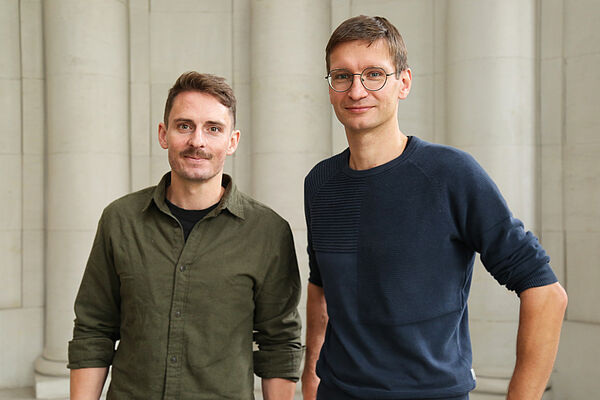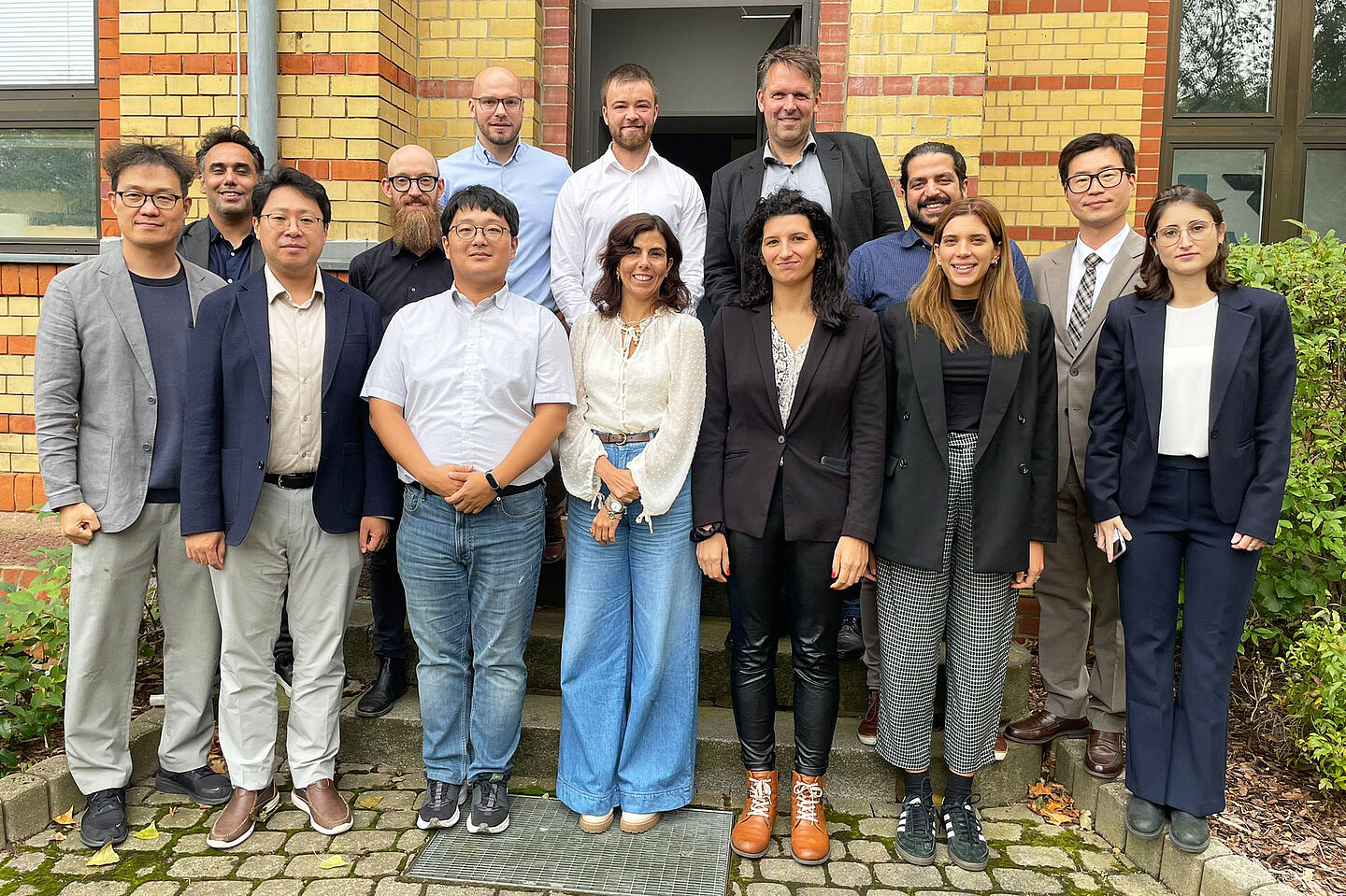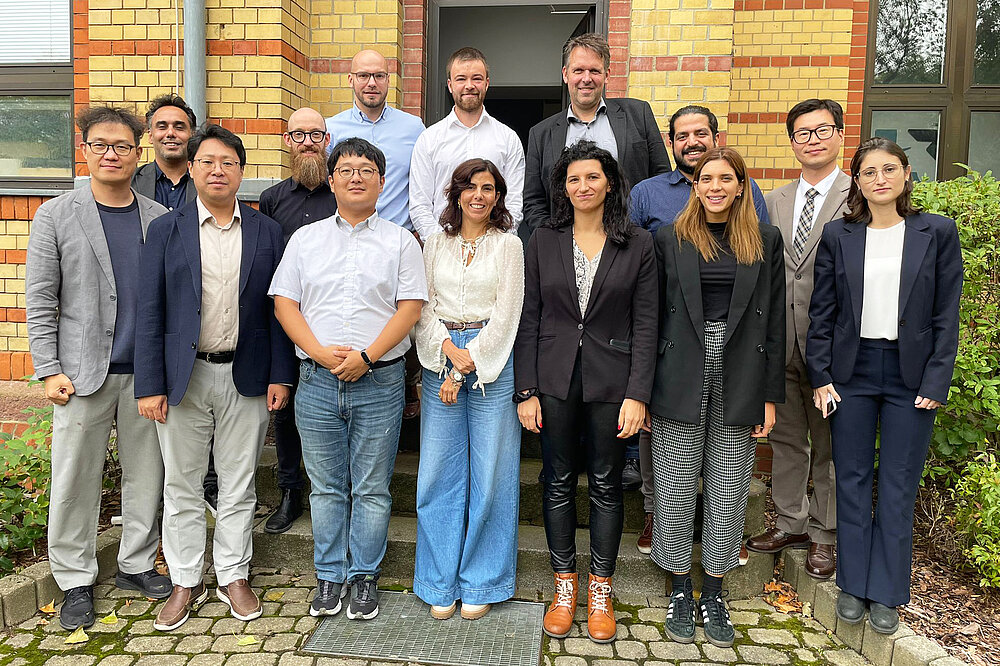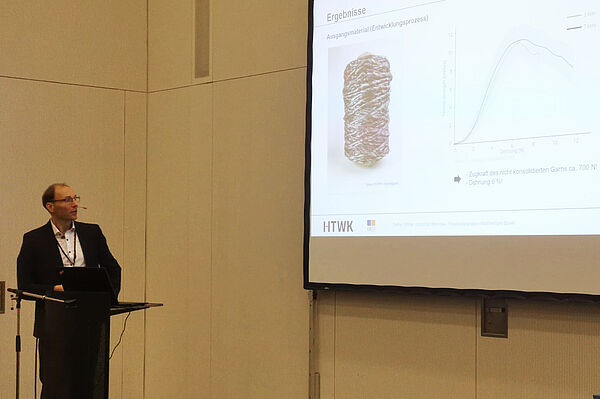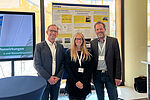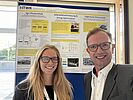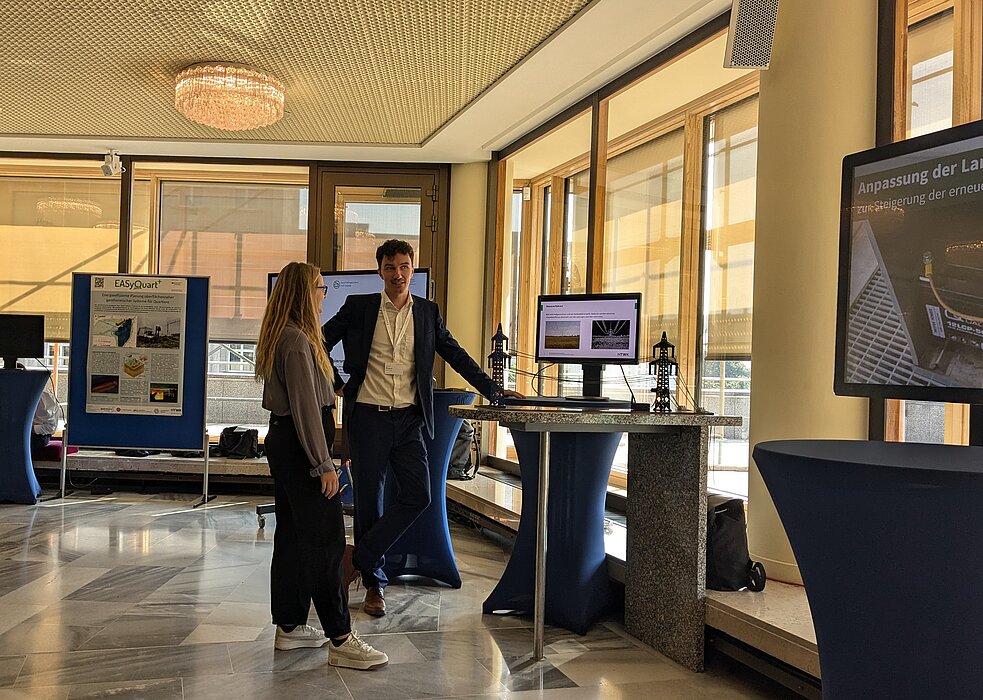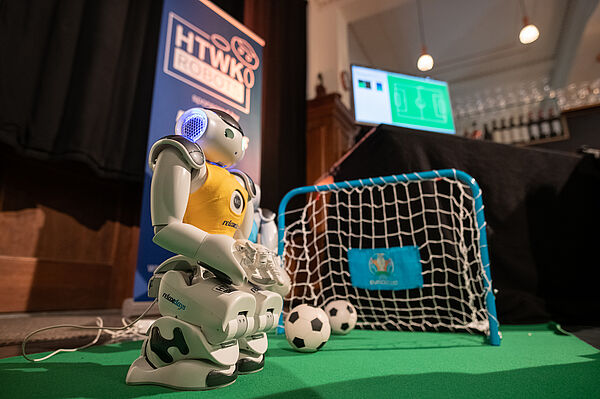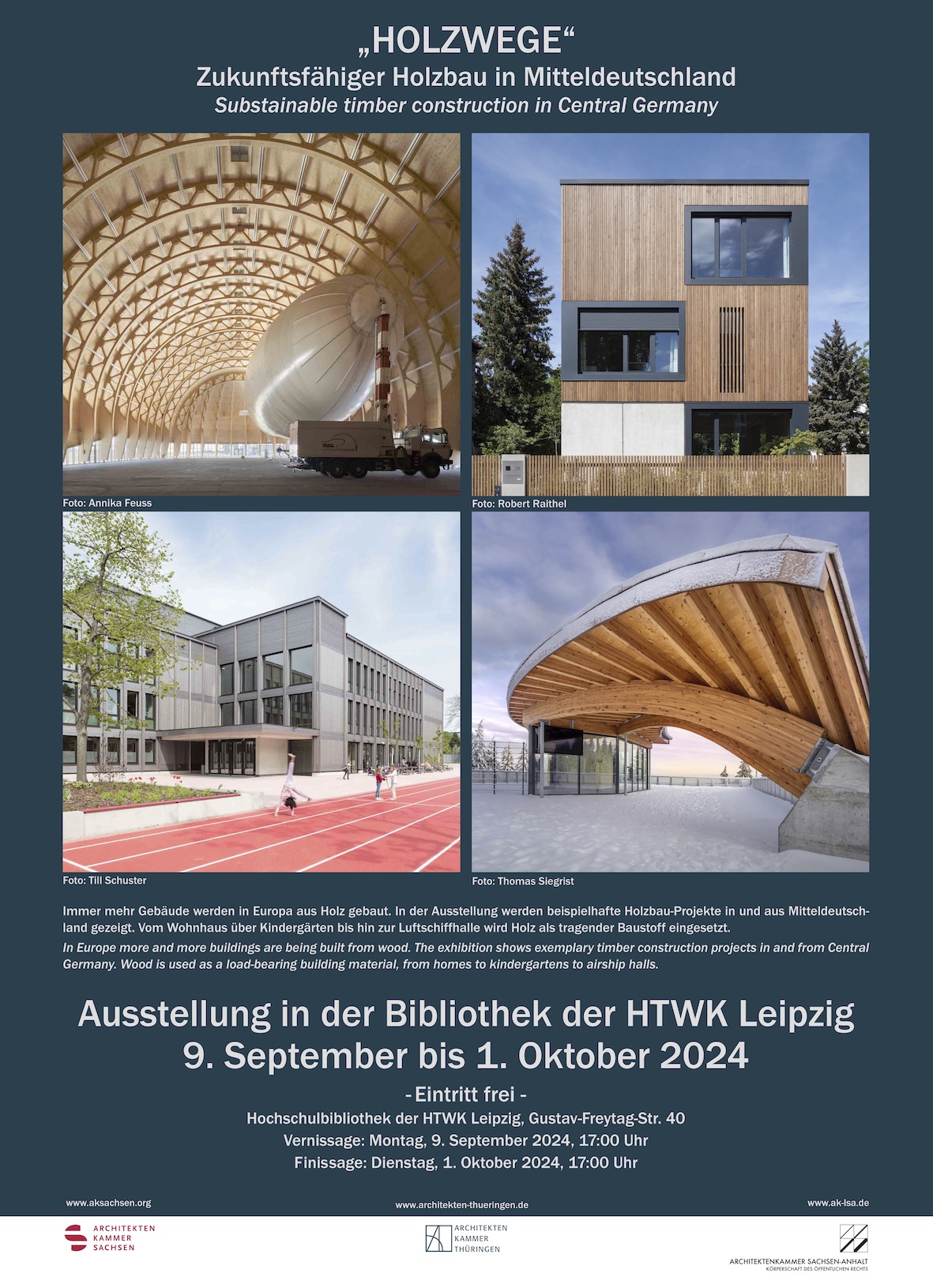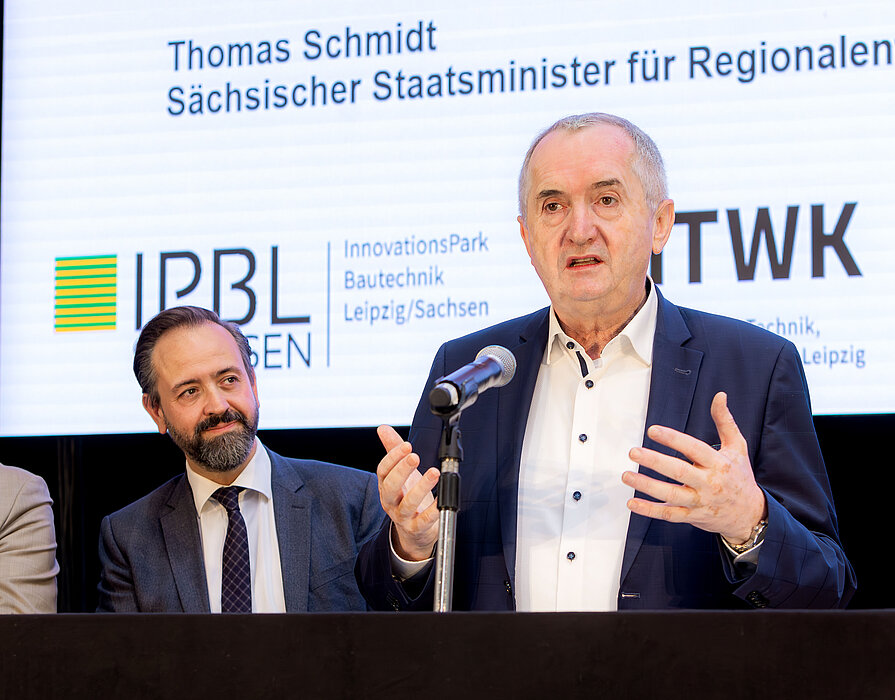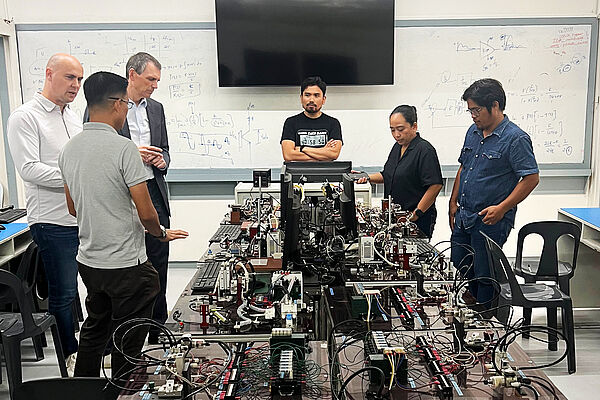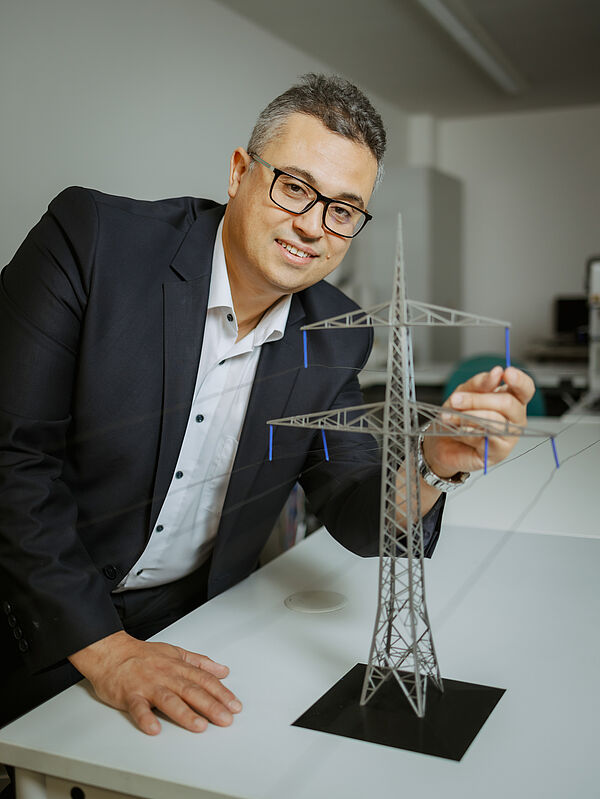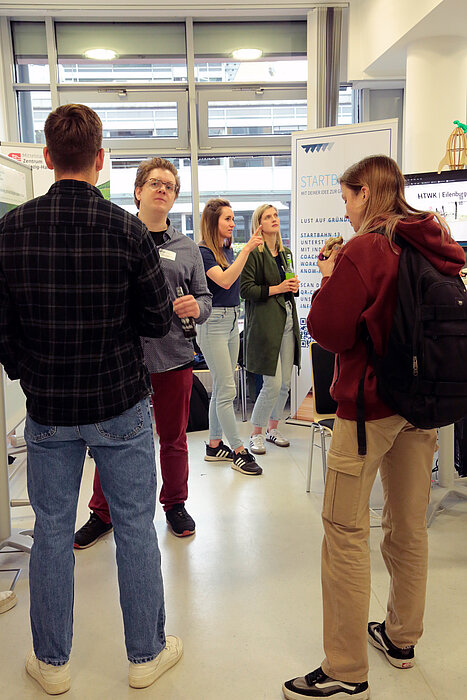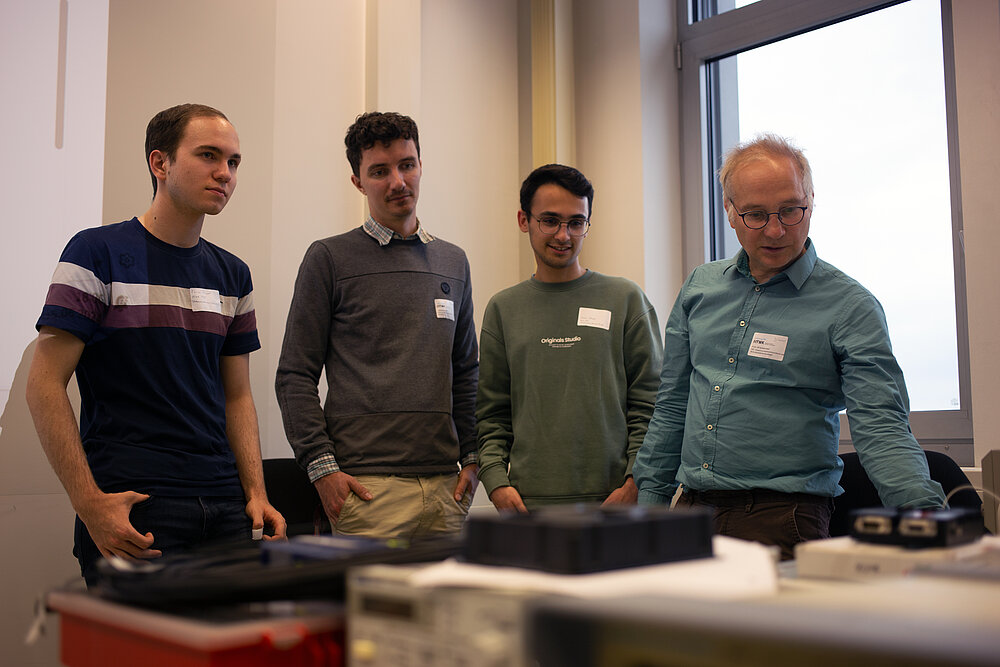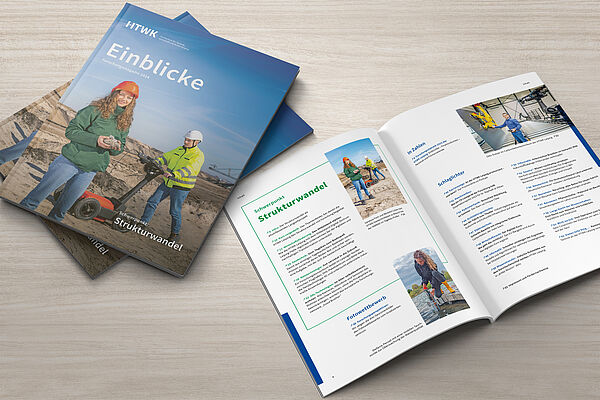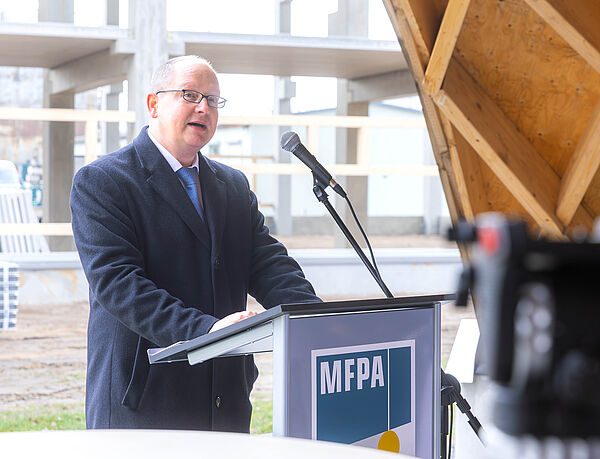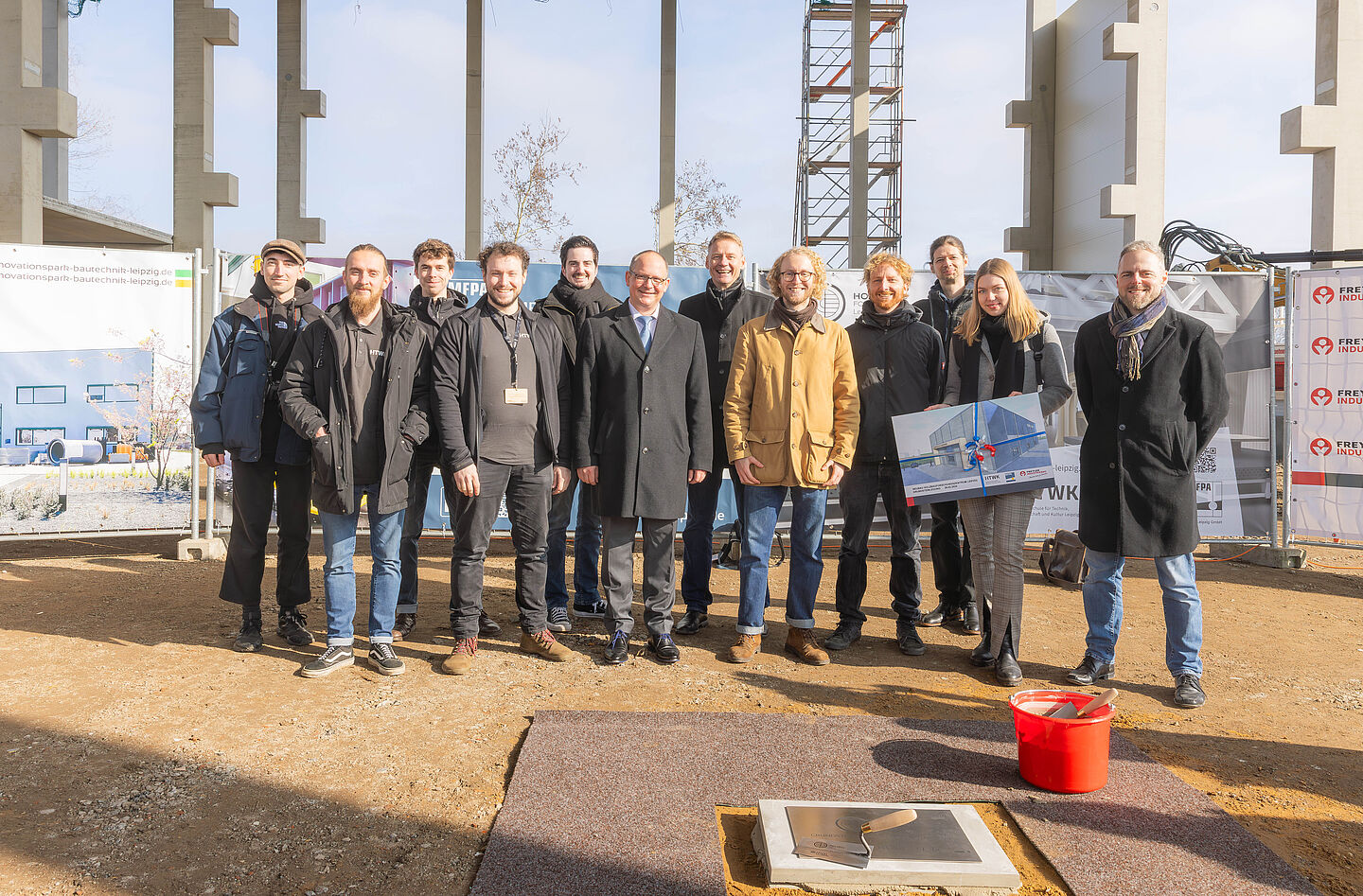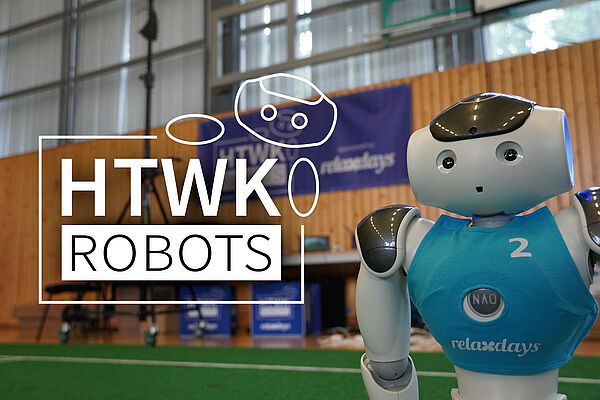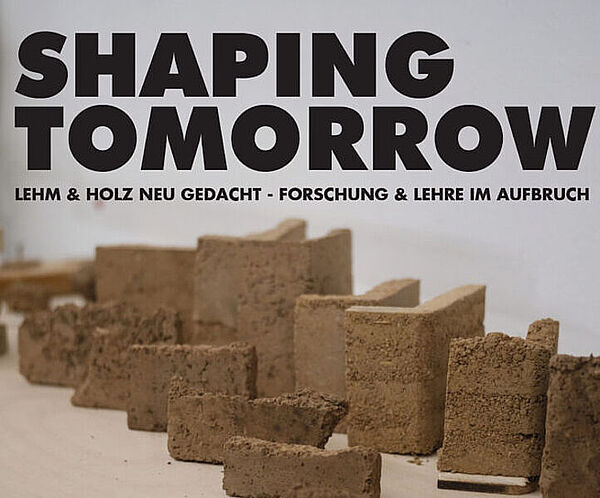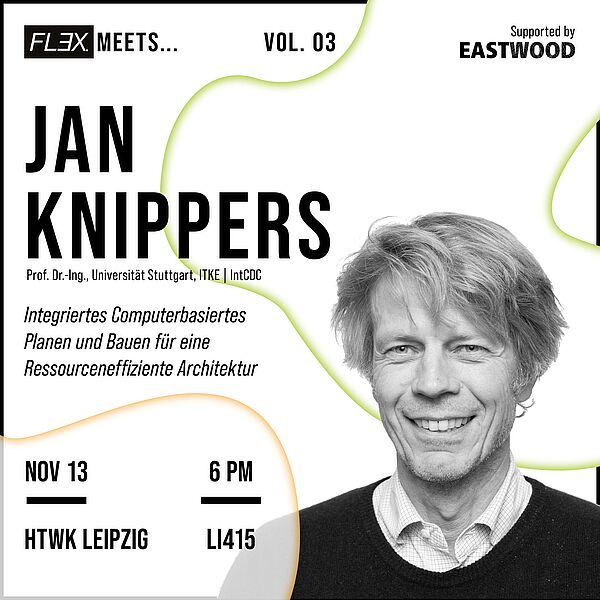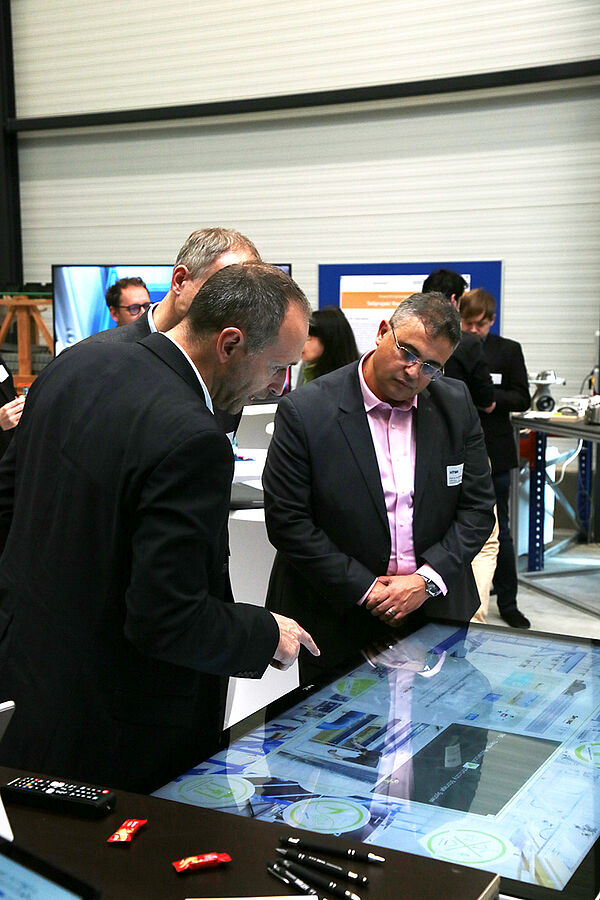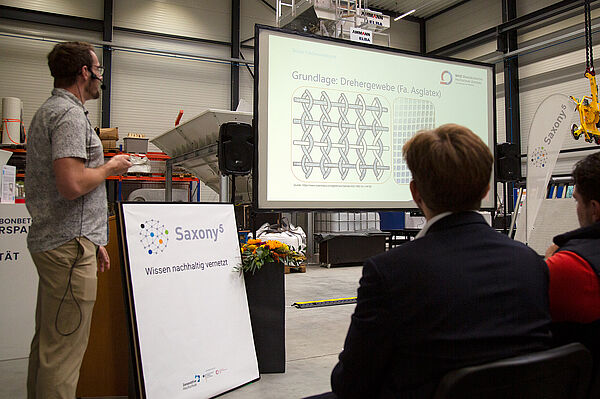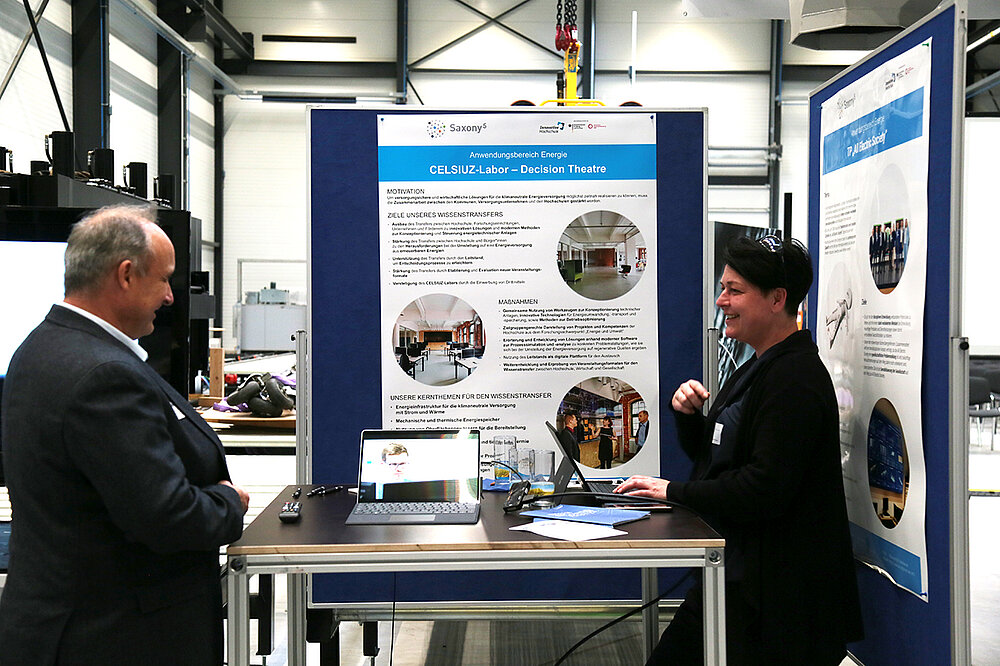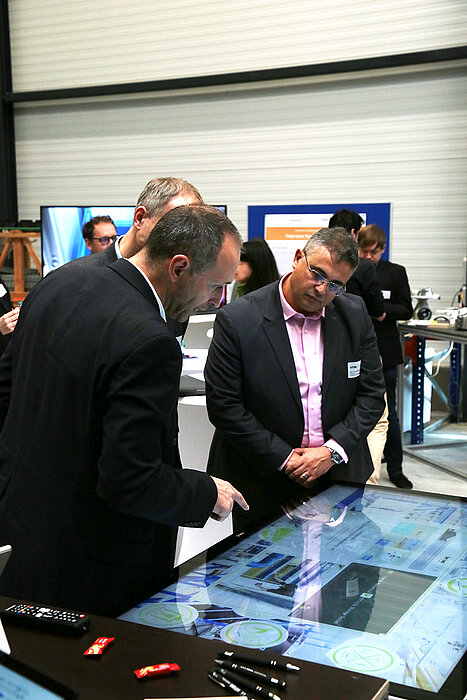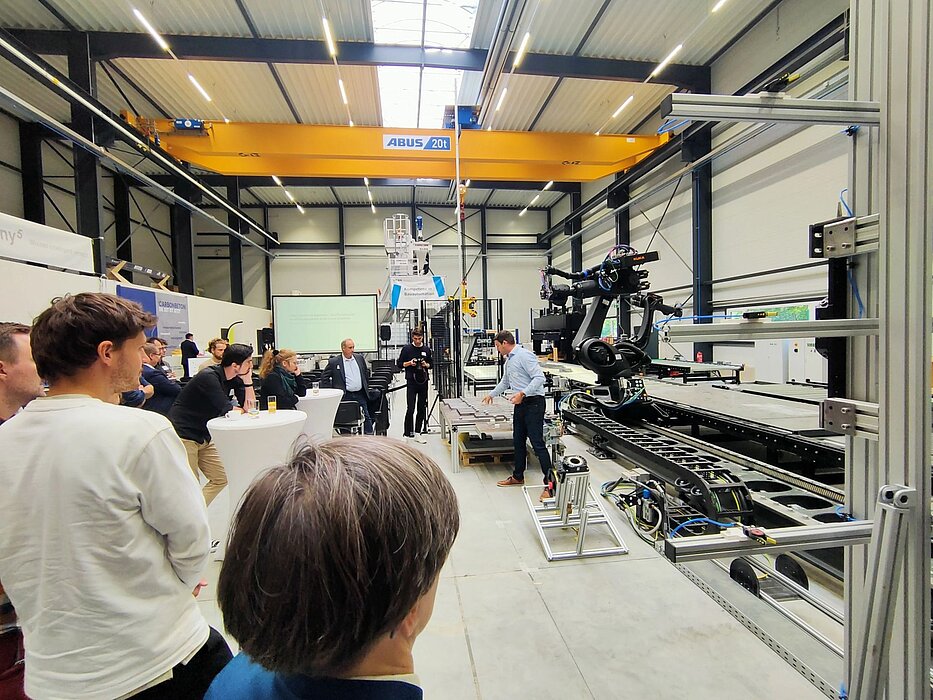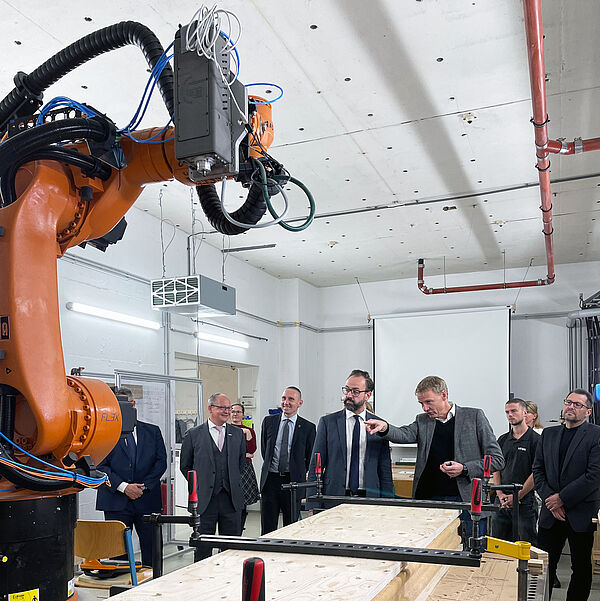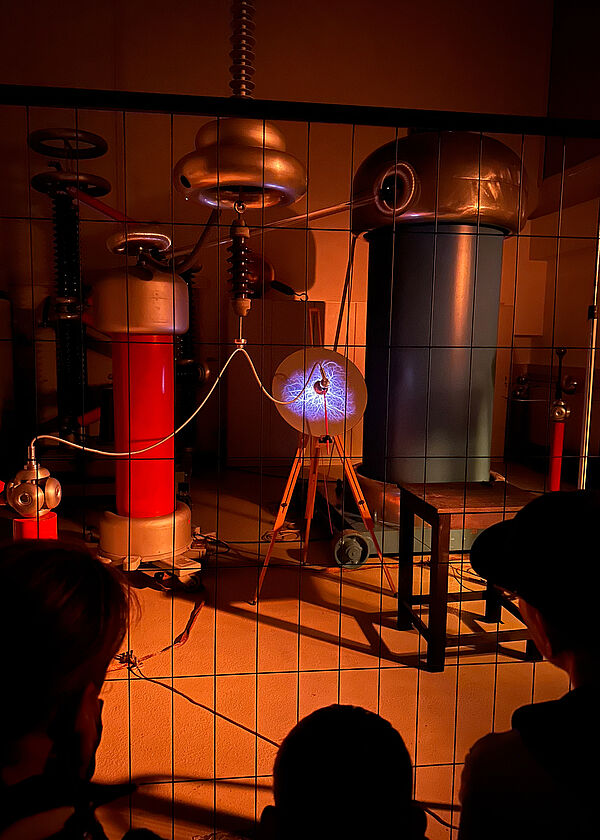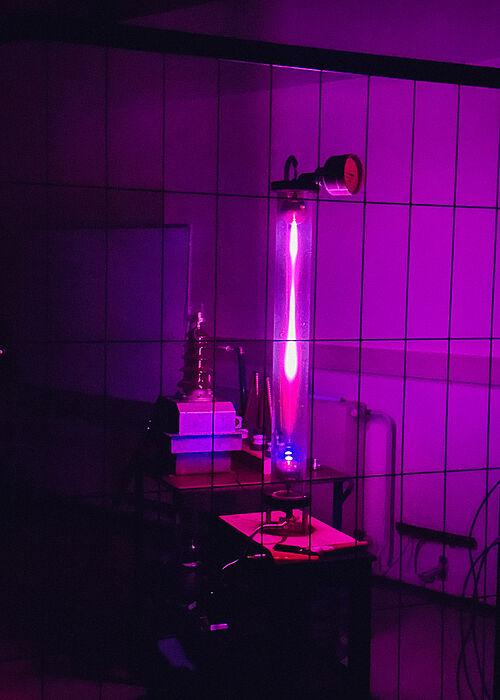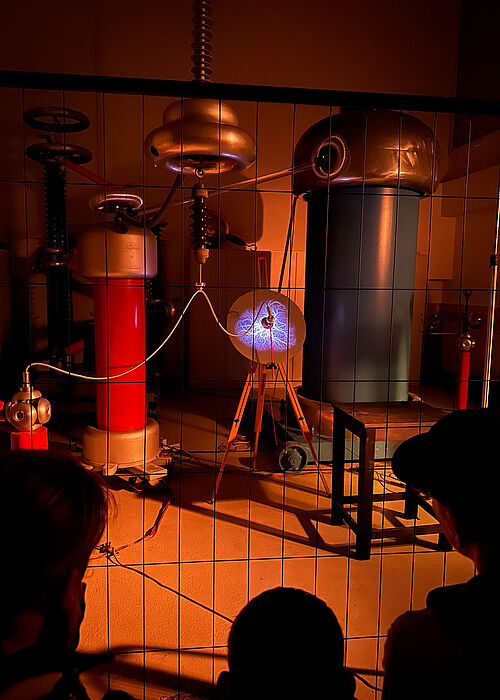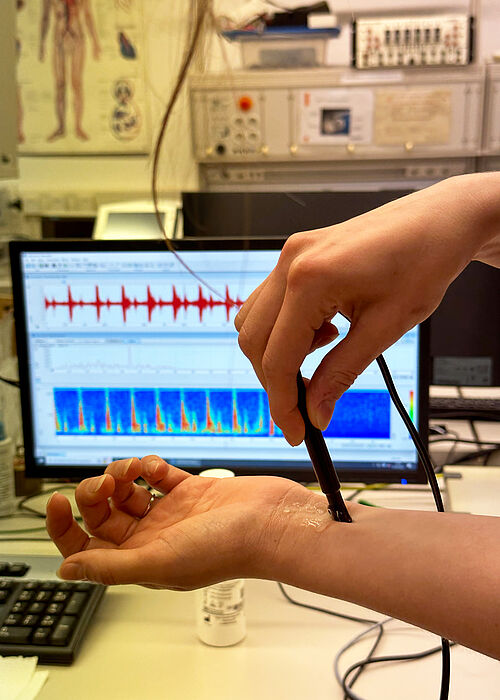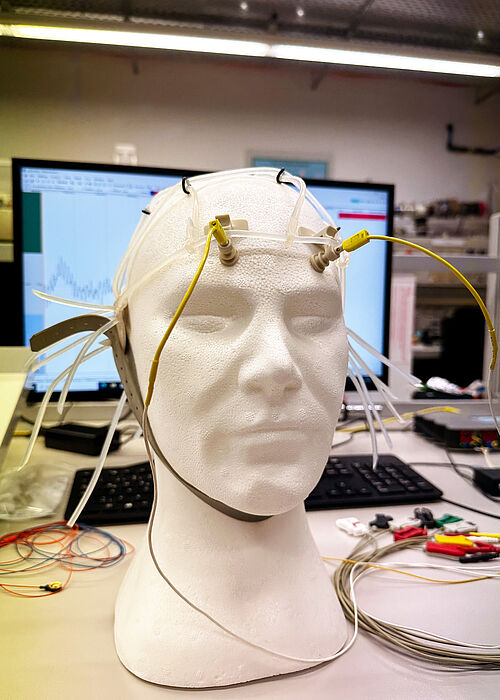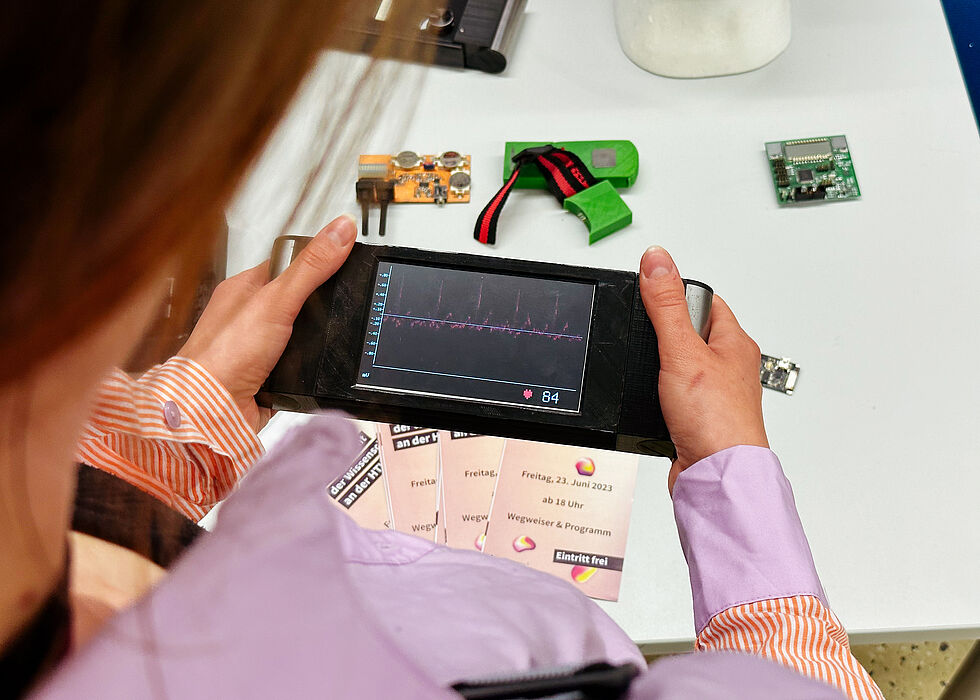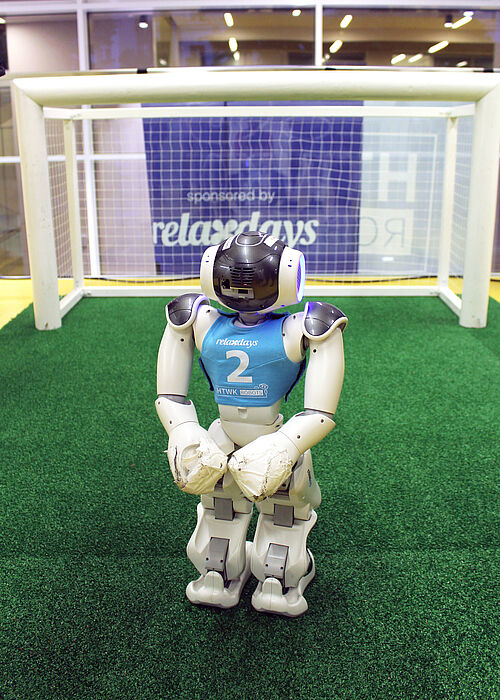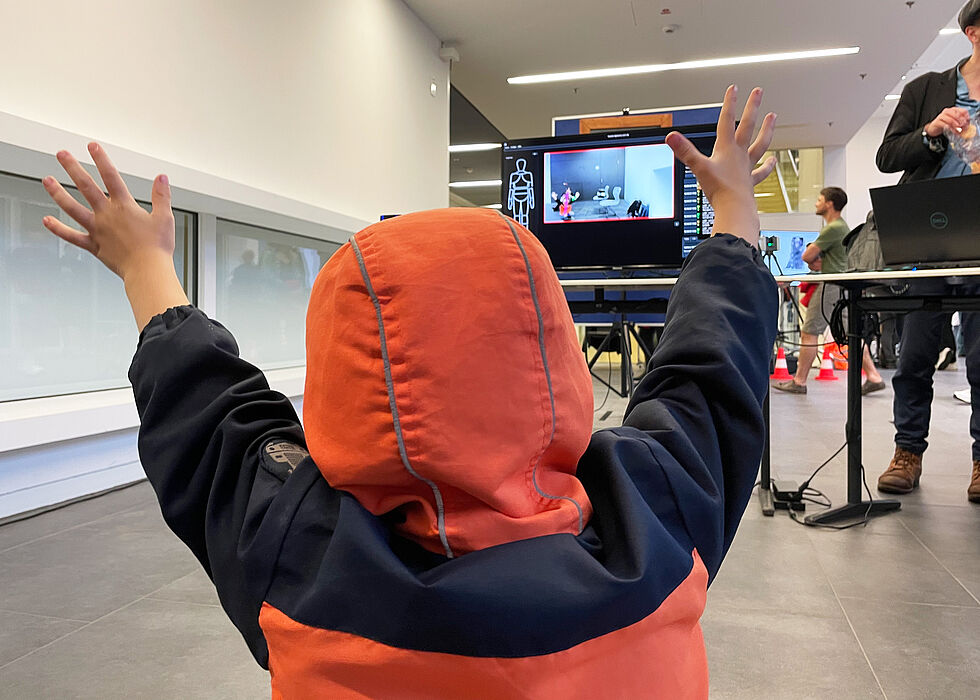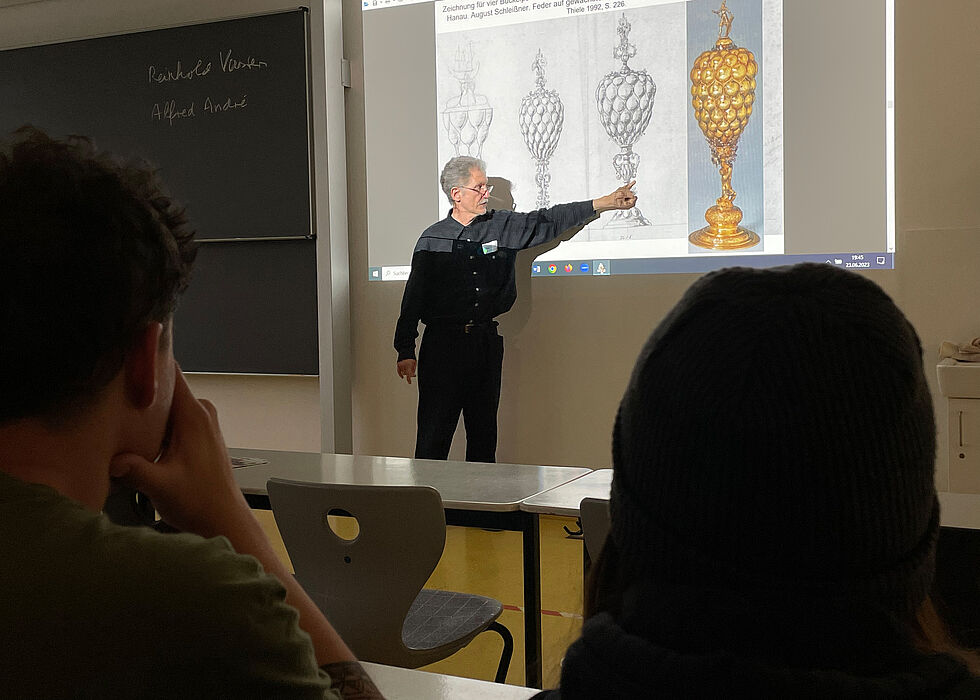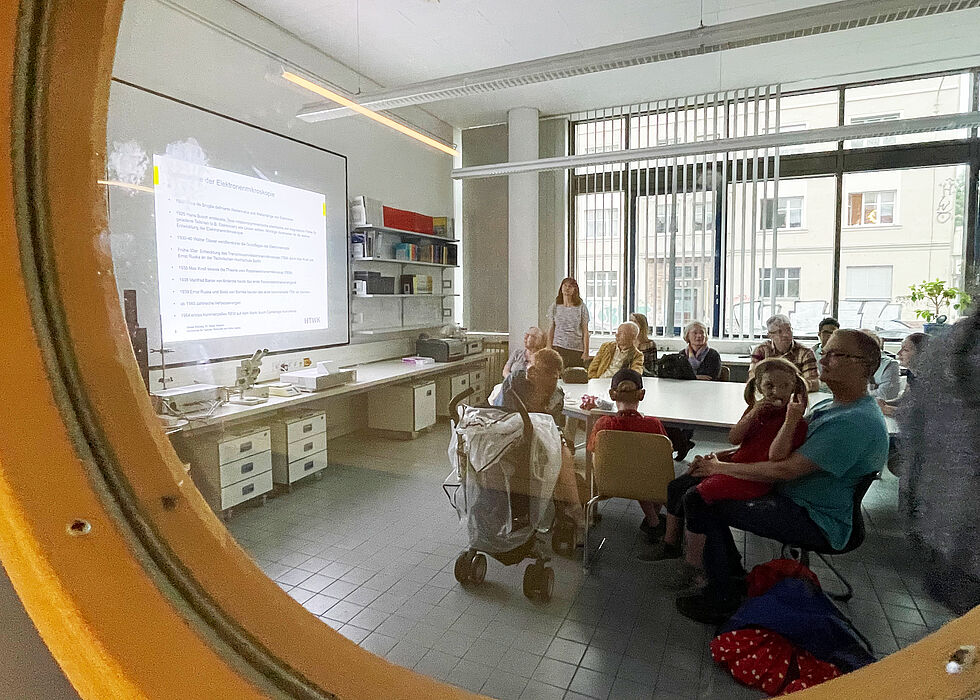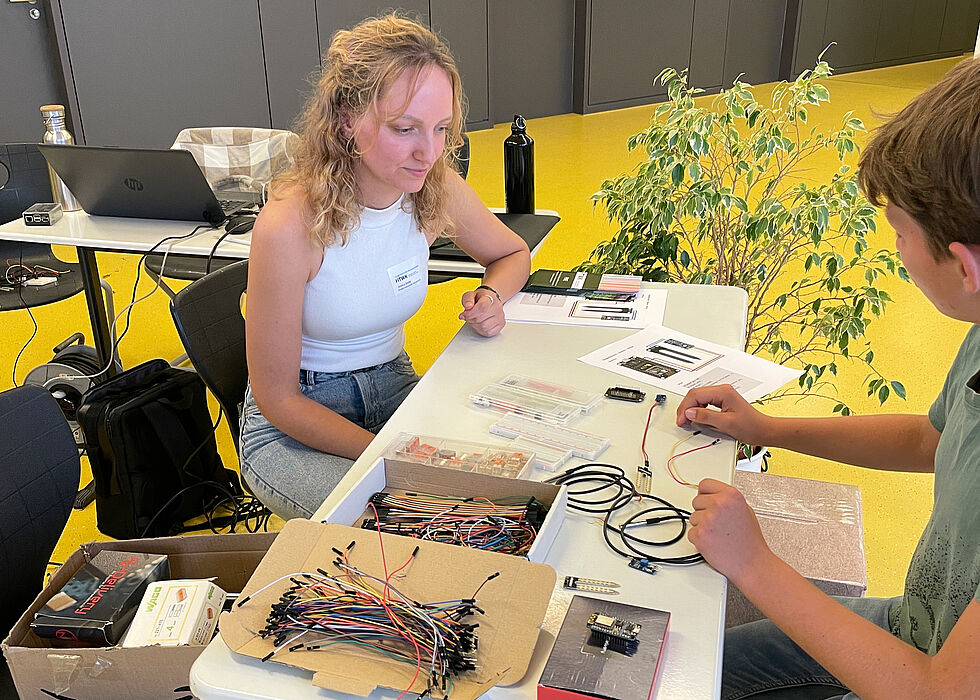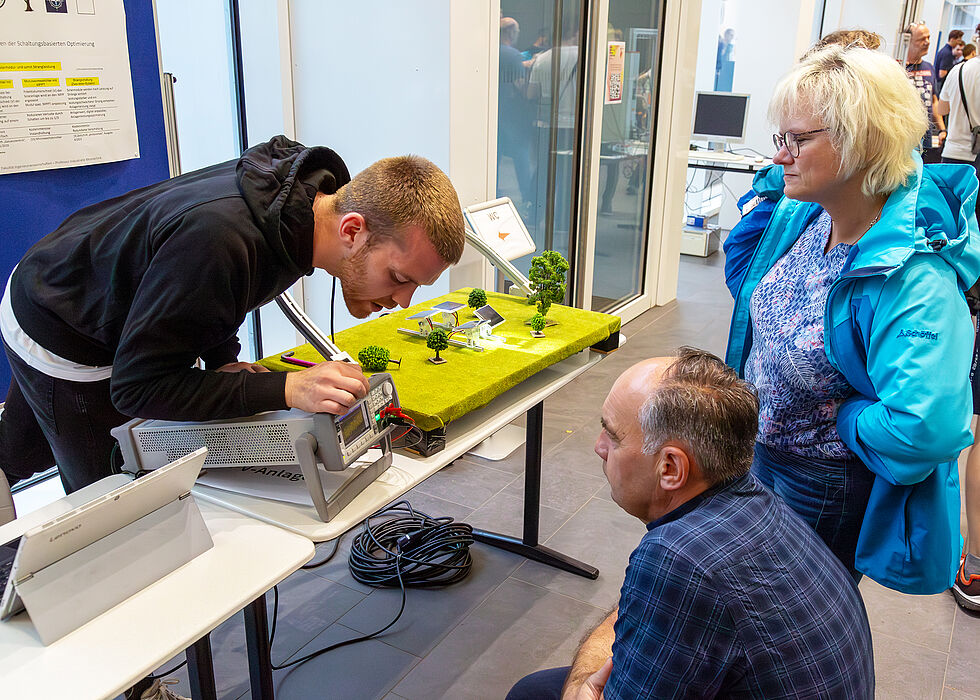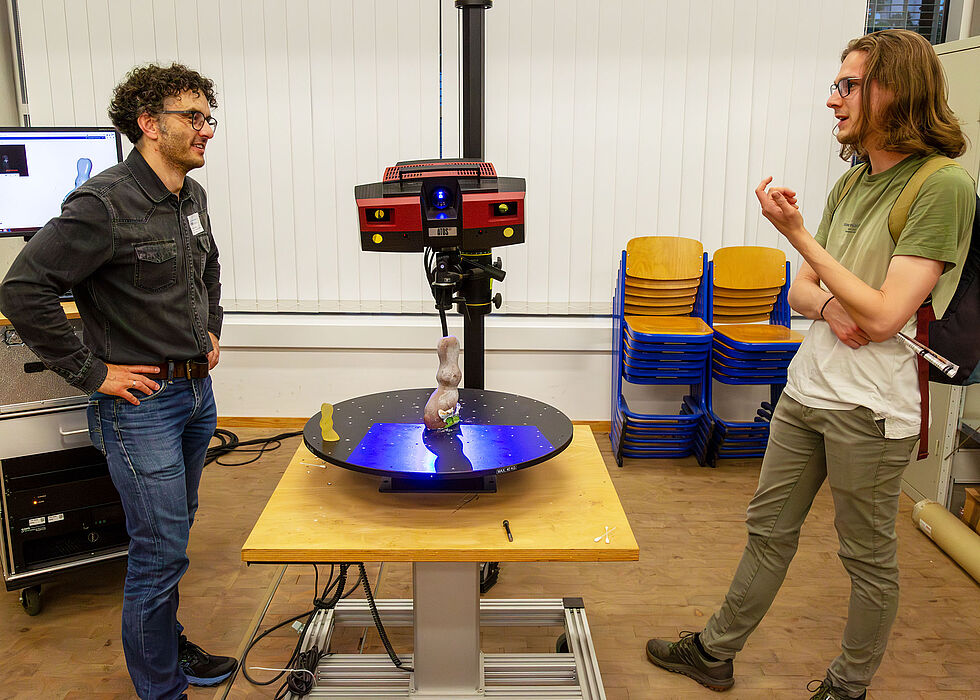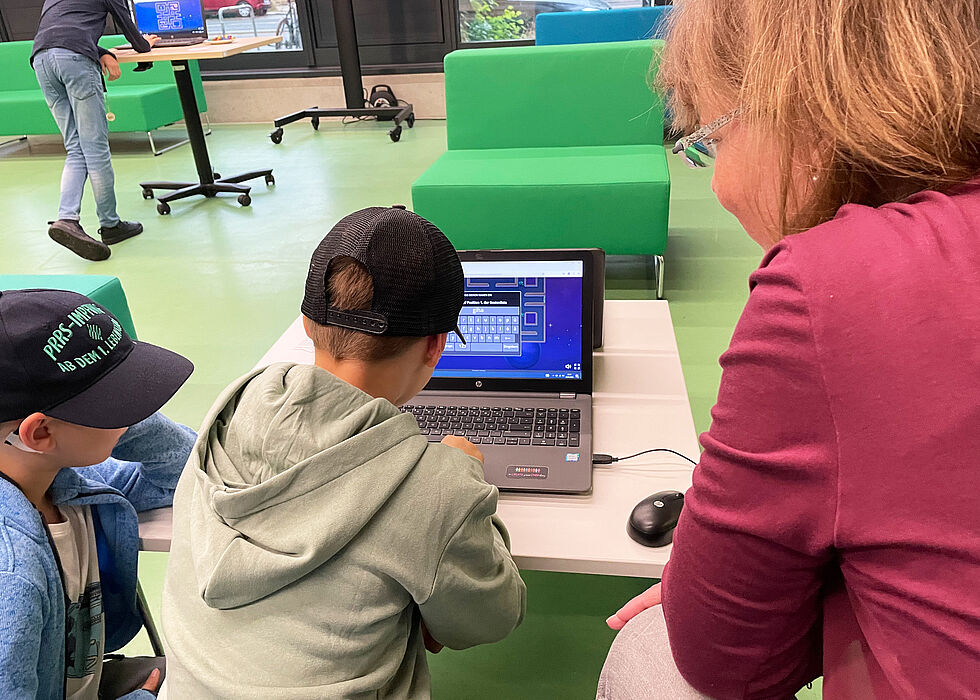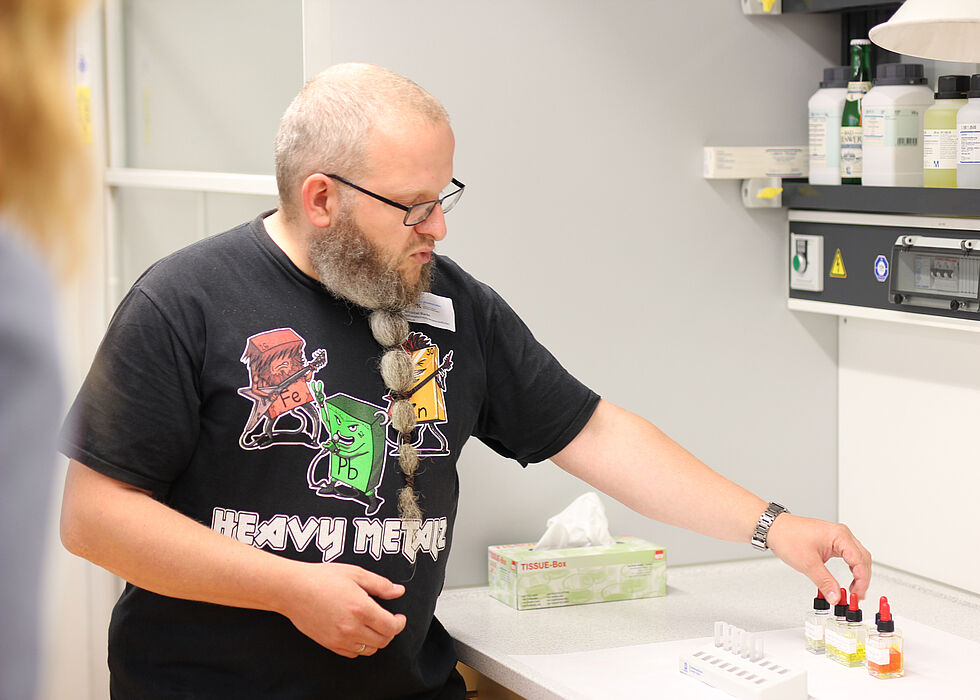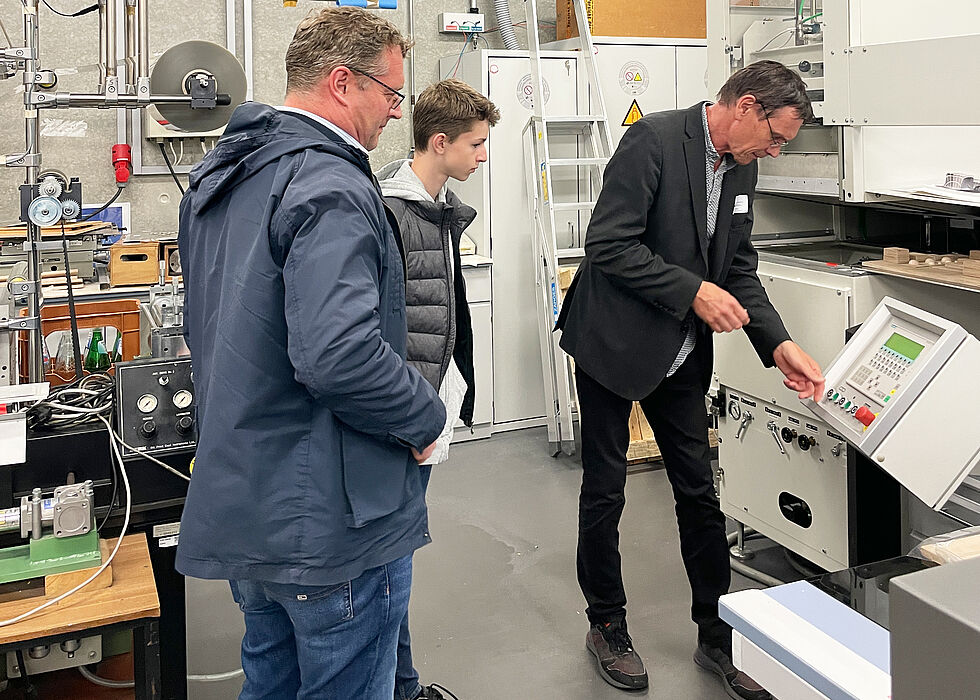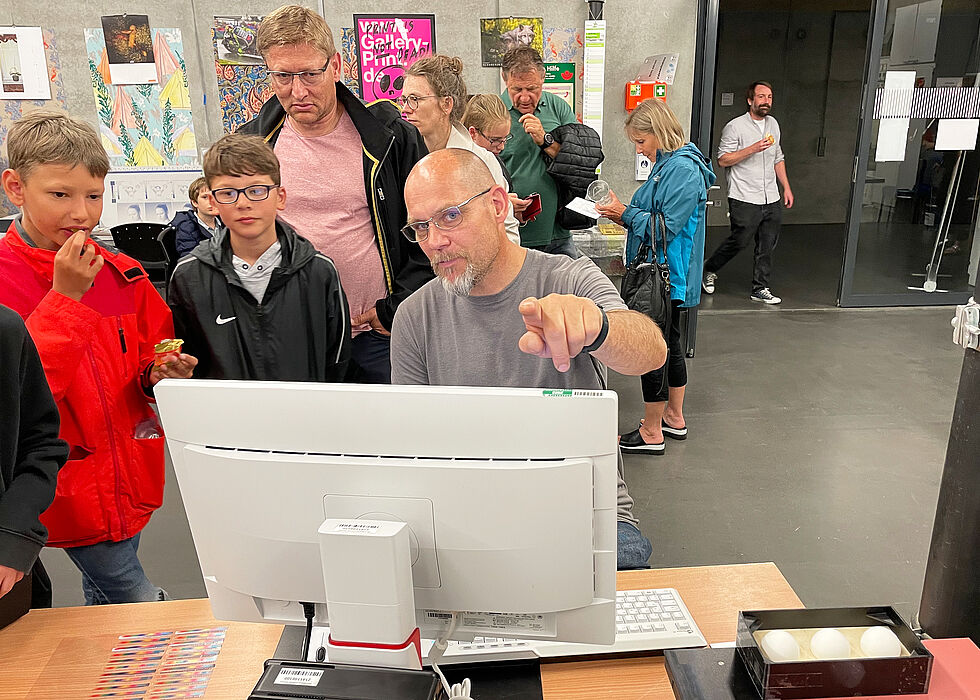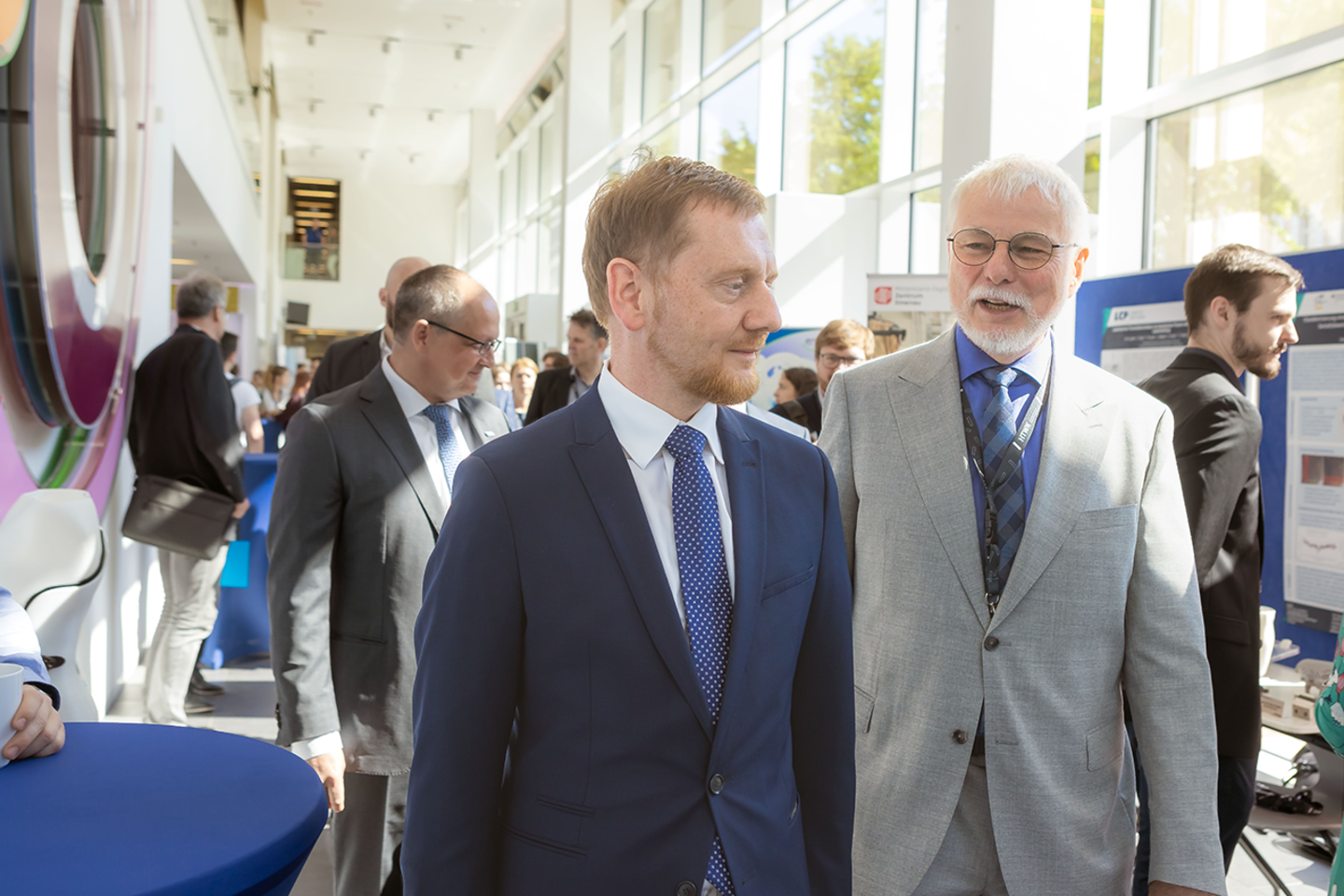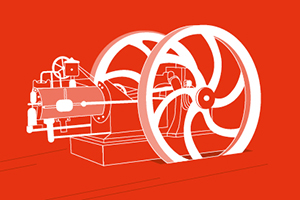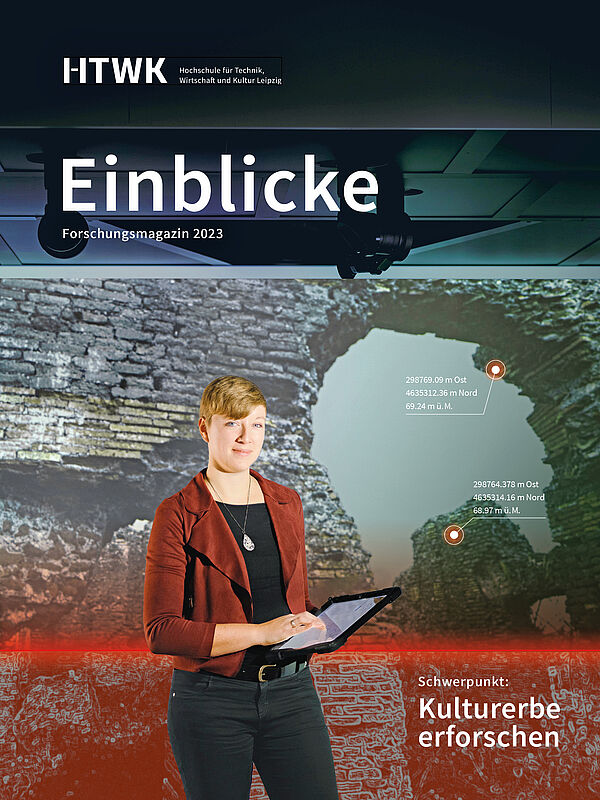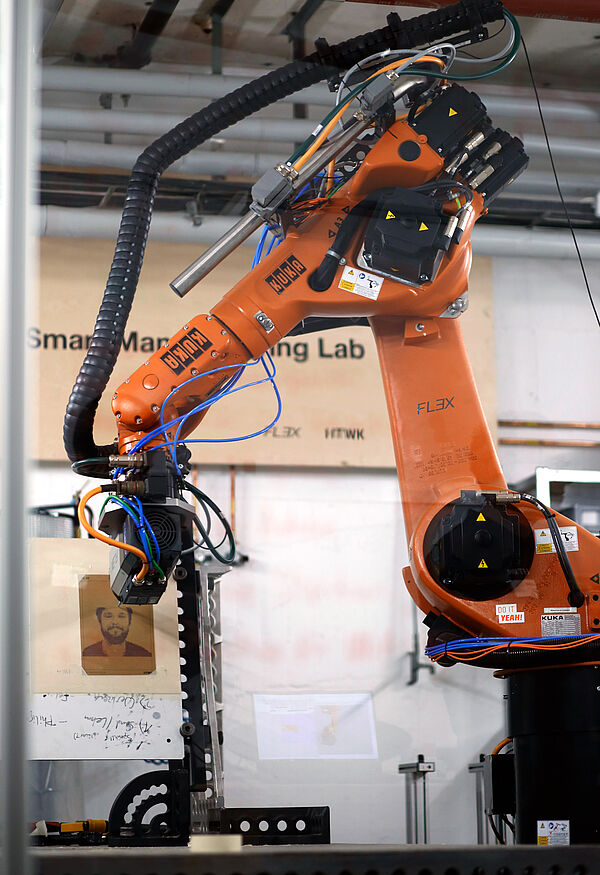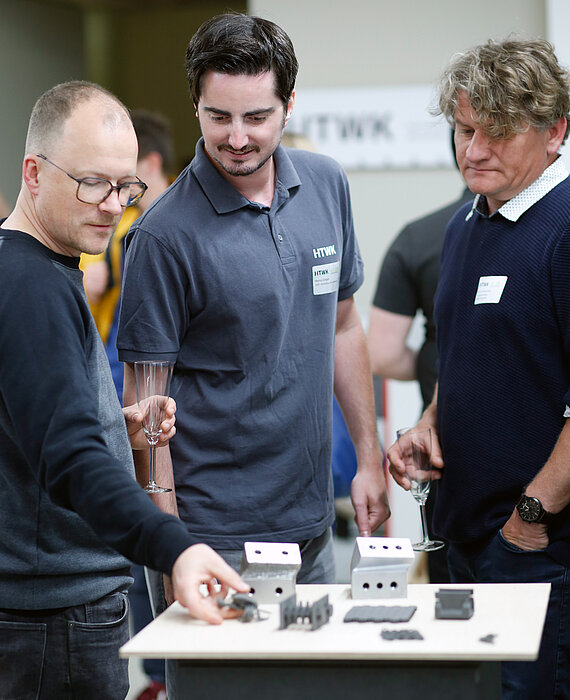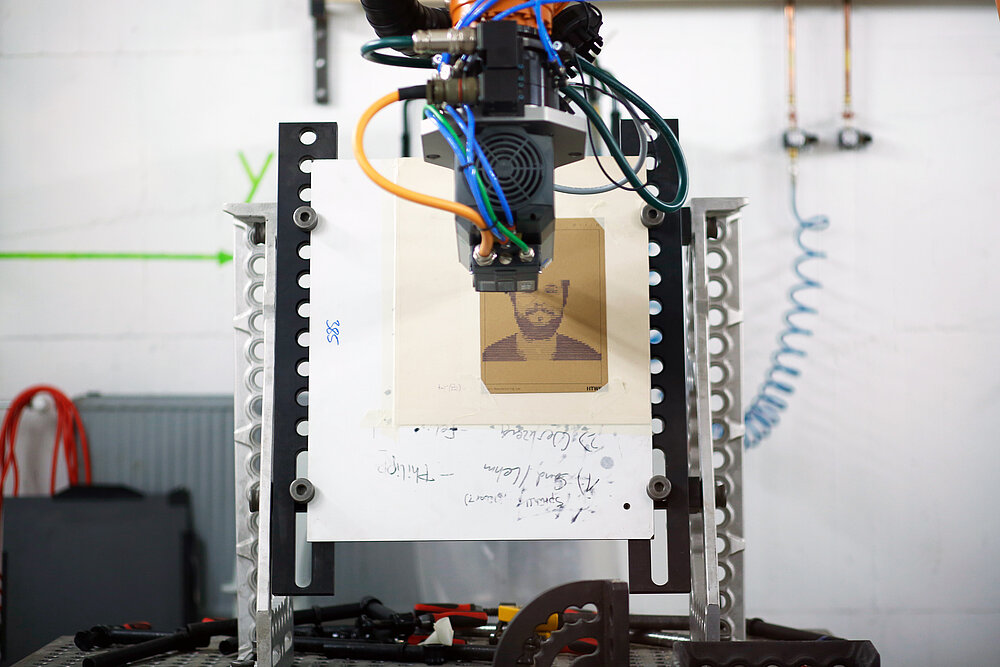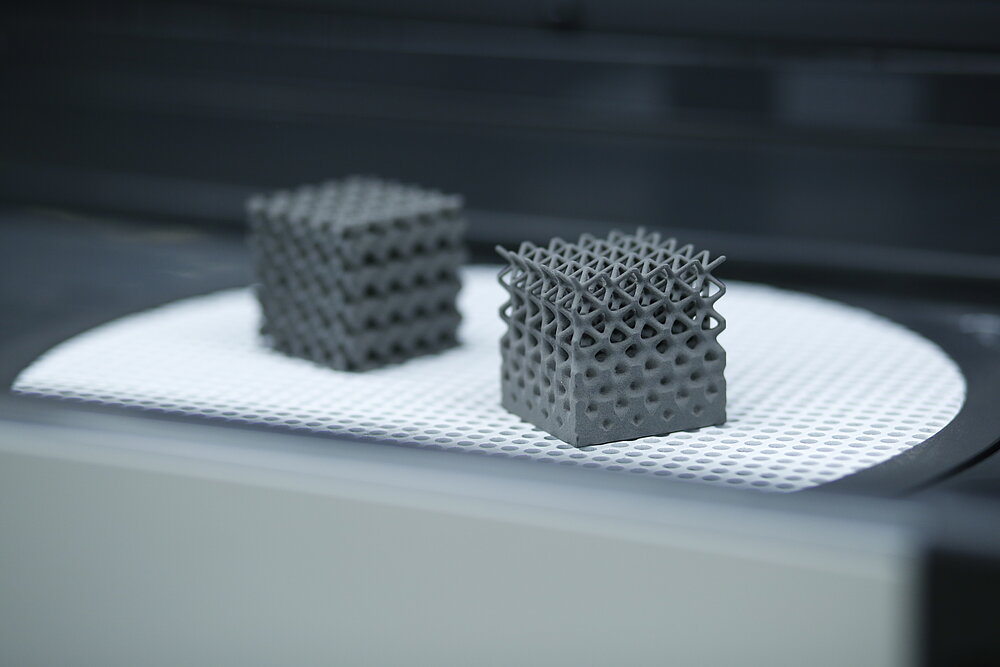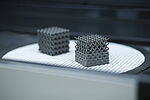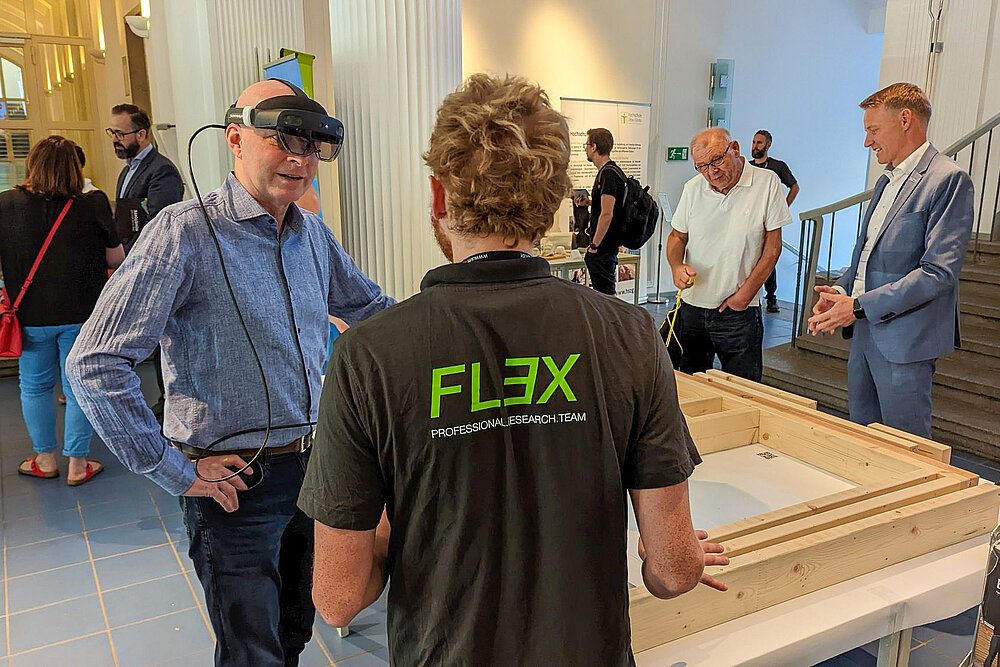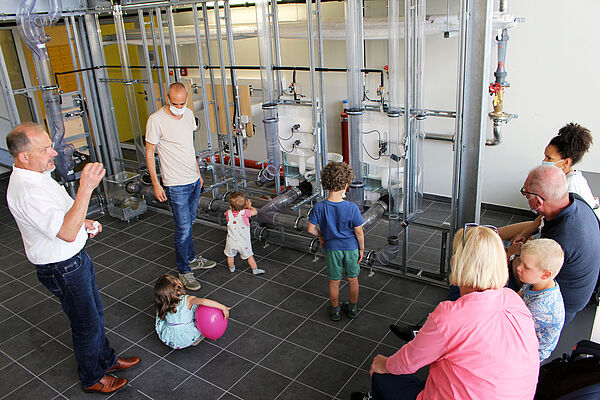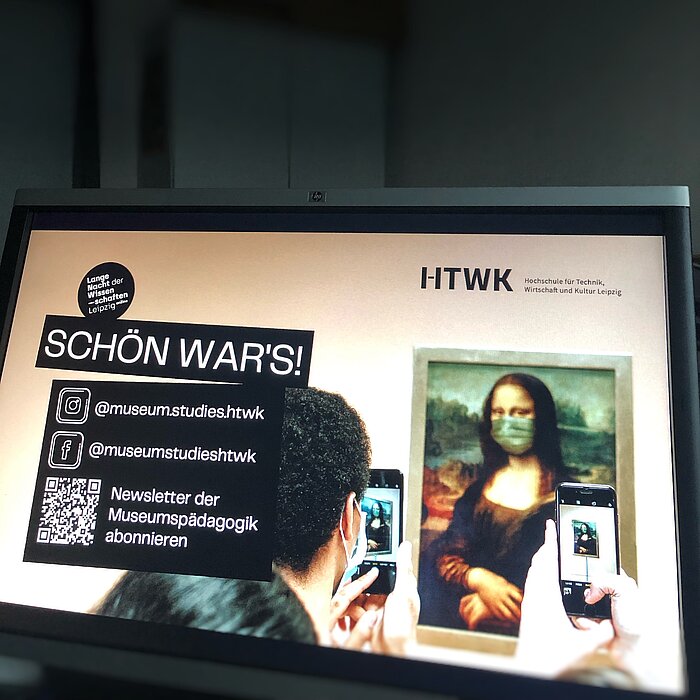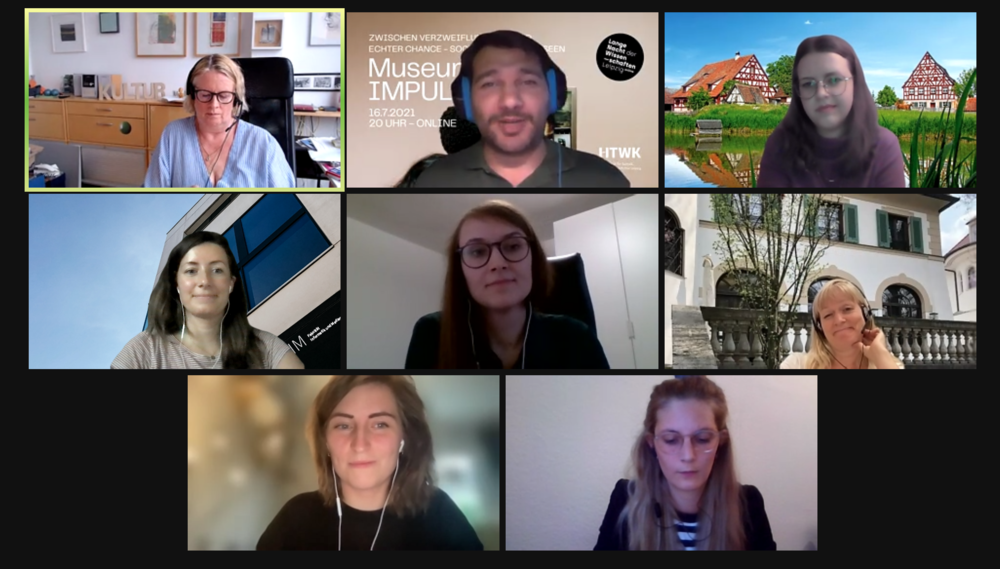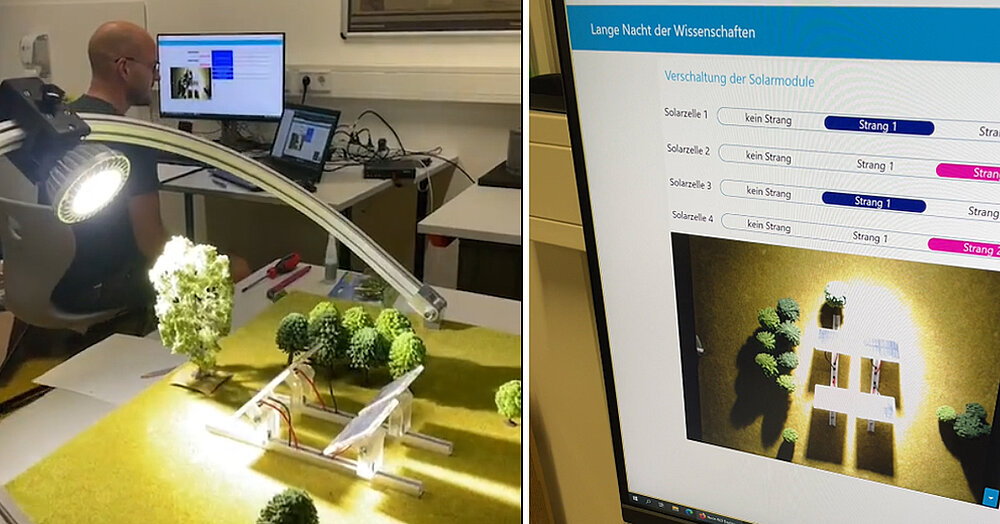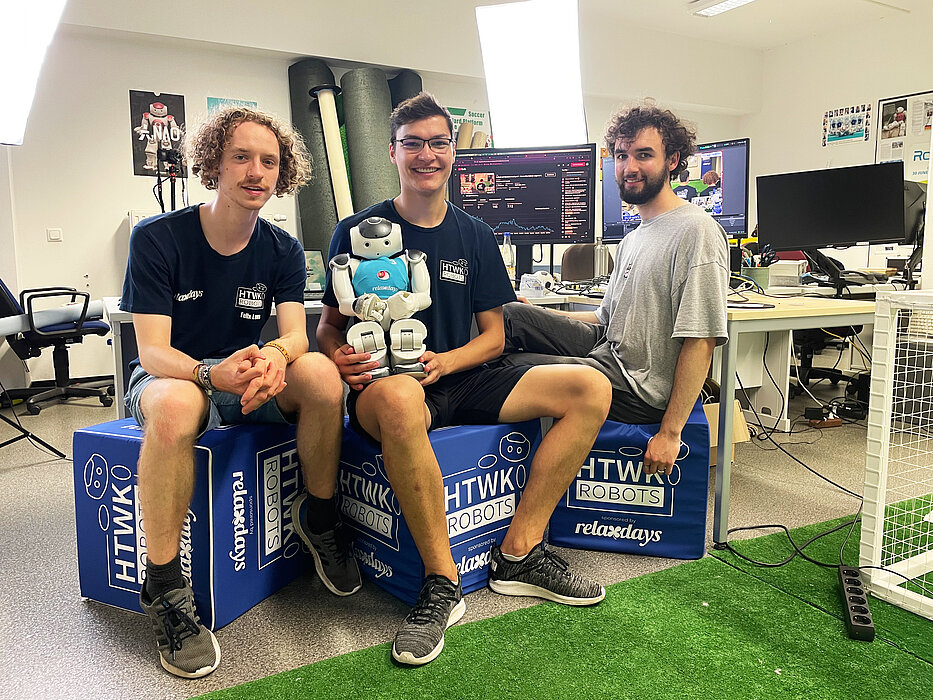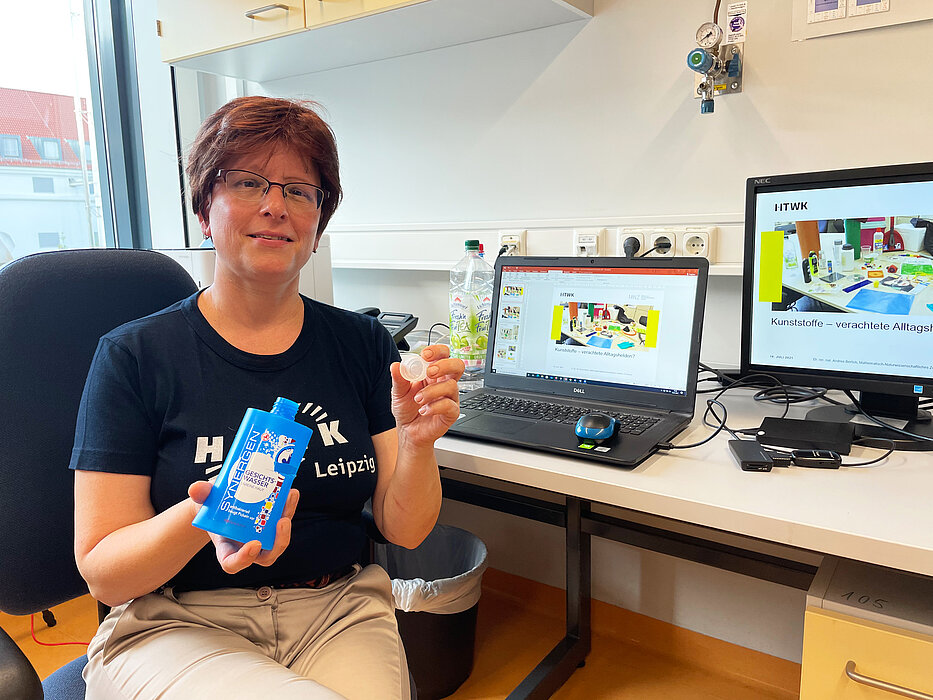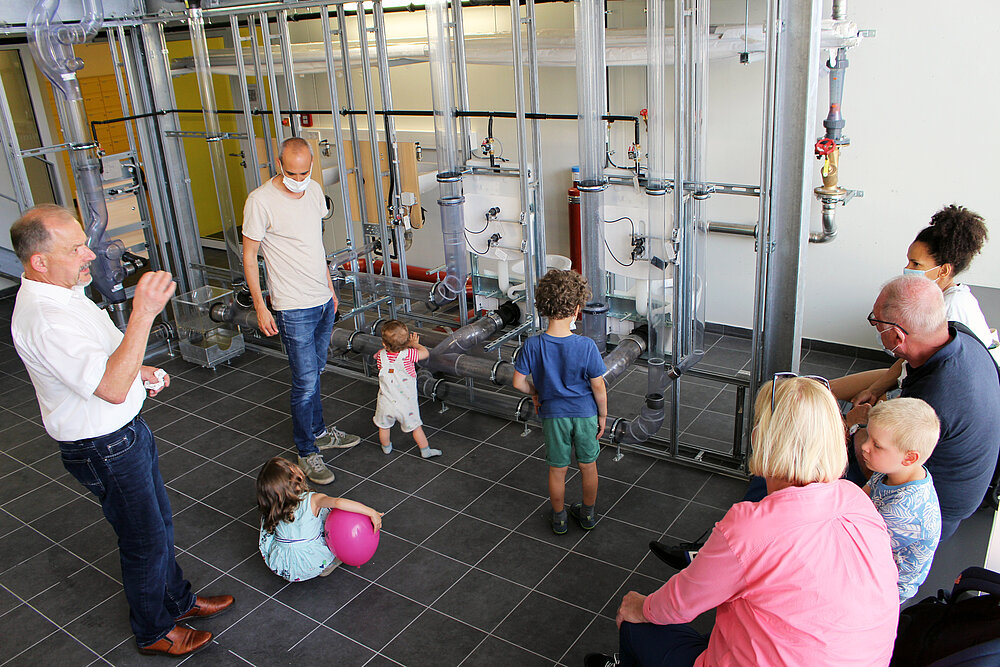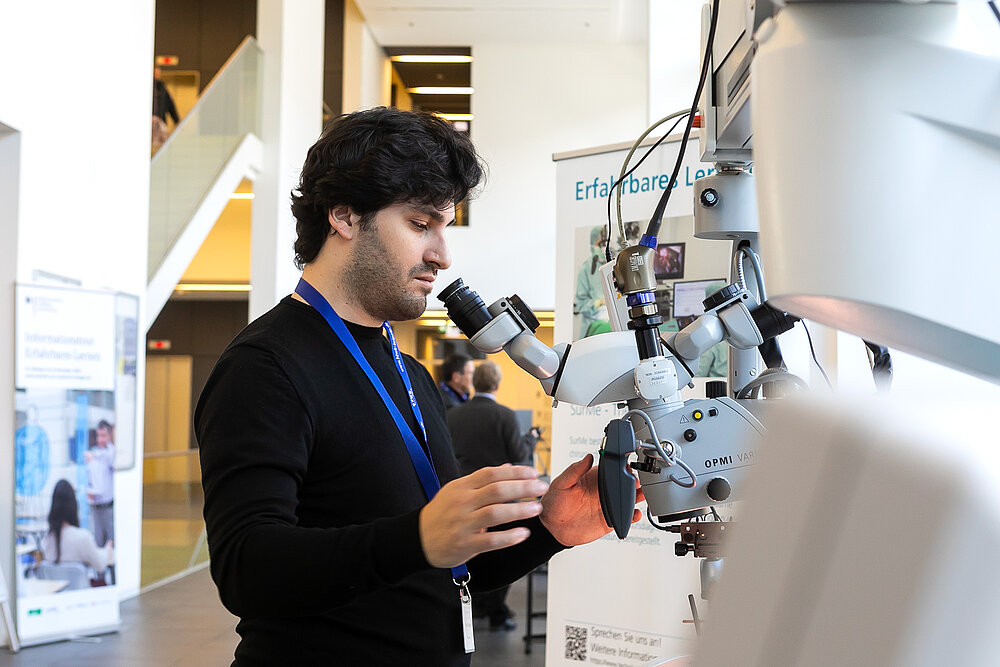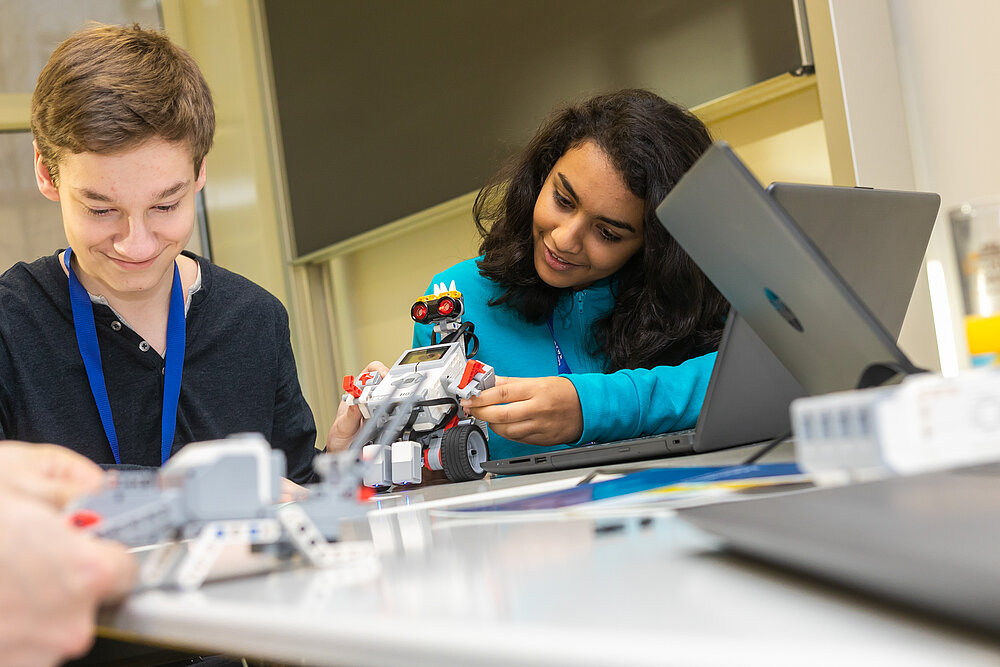„Wir freuen uns sehr, dass wir Gastgeber dieser bedeutenden Konferenz sein durften“, sagte Prof. Klaus Holschemacher, Direktor des Instituts für Betonbau an der HTWK Leipzig. „Gerade angesichts der technischen und gesellschaftlichen Transformationen unserer Zeit ist der rechtliche Diskurs im Bauwesen essenziell.“
Eröffnung mit Weitblick: Perspektiven auf Kooperation, Forschung und Recht
Die offizielle Eröffnung am 1. Juli in Leipzig wurde durch Grußworte aus Politik, Wissenschaft und Diplomatie eingerahmt. Prof. Klaus Holschemacher hob in seiner Rede die zentrale Rolle rechtlicher Fragestellungen für die Weiterentwicklung des Bauwesens hervor. Dirk Panter, sächsischer Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz, betonte die Bedeutung internationaler Kooperationen in Forschung und Entwicklung für den Freistaat Sachsen. Courtney Mazzone, Konsulin am US-Generalkonsulat Leipzig, verwies auf die enge und bewährte Zusammenarbeit zwischen den USA und Deutschland – auch in Wissenschaft und Technik. Prof. Faouzi Derbel, Prorektor für Forschung und Nachhaltigkeit der HTWK Leipzig, hob die Forschungskompetenz der Fakultät Bauwesen und die strategische Relevanz der Konferenz für die Hochschule hervor. Der Editor-in-Chief des Journals Dr. Lance VanDemark sagte im Nachgang: „Der internationale Workshop in Leipzig war ein zum richtigen Zeitpunkt stattfindender Workshop, der Wissenschaftler, Praktiker und Rechtsexperten zusammenbrachte, um das Verständnis von Streitigkeiten und deren Beilegung voranzubringen. Die vielfältigen Hintergründe und Wissensgebiete der Teilnehmenden trugen dazu bei, das Verständnis für Streitigkeiten zu vertiefen und das Risiko von Auseinandersetzungen in Zeiten der Globalisierung zu verringern.“
Zur thematischen Vertiefung folgten zwei Keynotes: Dr.-Ing. Matthias Tietze (C3 – Carbon Concrete Composite) sprach über regulatorische Herausforderungen beim Einsatz von Carbonbeton. Sarah Kristina Merz (Deubim) gab Einblicke in rechtliche Rahmenbedingungen und Normen bei BIM-Projekten.
Fachlich fundiert und international vernetzt

Insgesamt wurden 57 Fachvorträge gehalten – zu Themen wie Schadensersatz, Vertragsgestaltung, Streitbeilegung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Besonders gefragt waren die neuen Themen Building Information Modeling (BIM) und Vertragsmanagement. Die Vortragenden lieferten aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, die in einer LADR-Sonderausgabe veröffentlicht werden – ein wichtiges Instrument für den internationalen Wissenstransfer.
Die lebhaften Diskussionen im Anschluss an viele Vorträge zeigten, wie groß das Interesse an Austausch und Kooperation ist – über Disziplin- und Ländergrenzen hinweg.
Leipzig kennenlernen
Bereits zur Welcome Reception am Vorabend der Konferenz trafen sich die Teilnehmenden in der Kanzlei Seufert Rechtsanwälte, einem Sponsor der Veranstaltung. Bei Fingerfood und kühlen Getränken genossen sie den Blick über das alte Rathaus, und knüpften erste Kontakte in entspannter Atmosphäre.
Auch das festliche Konferenz-Dinner bot Gelegenheit zum Austausch über Forschungsthemen hinaus. Den Abschluss bildete ein Stadtrundgang durch Leipzig mit Besuch des traditionsreichen Auerbachs Keller, in dem schon Goethes Faust zu Tisch saß.
Bildimpressionen
Worum geht es in der neusten Ausgabe?
Im Forschungsmagazin Einblicke 2025 hat Künstliche Intelligenz (KI) zum Schwerpunkt, denn kaum eine technische Errungenschaft hat in jüngster Zeit so viel Aufmerksamkeit erhalten und so tiefgreifend Einzug in verschiedene Lebensbereiche gehalten. Auch in der Forschung spielt KI eine zunehmend tragende Rolle: Sei es als eigener Forschungsgegenstand oder aber als Methode angewandter Forschung, die in diversen Disziplinen neue Ansätze und Möglichkeiten bietet.
Lesen Sie im Magazin beispielsweise, wie die Forschende der HTWK Leipzig KI einsetzen, um menschliche Bewegungsabläufe zu analysieren - sei es im Sport, in der Medizin oder bei Arbeitsabläufen. Auch ein Messsystem für die Wartung von Straßen entwickeln Forschende aus dem Zusammenspiel von Sensoren und KI. A propos Straße: Das Smart-Driving-Team der HTWK Leipzig erprobt an Modellfahrzeugen verschiedene KI-Ansätze zum autonomen Fahren - wir berichten.
Themenvielfalt
Neben der Forschungsstatistik 2024 finden Sie wie immer auch die Gewinnerbilder des Fotowettbewerbs Forschungsperspektiven sowie in den "Schlaglichtern" viele weitere spannende Einblicke in unsere vielfältigen Forschungsthemen. Seien es die Bauingenieure und Architekten um Prof. Dr.-Ing Alexander Stahr, die ein neues Reallabor für den Holzbau der Zukunft errichteten, die Maschinenbauer um Prof. Dr.-Ing. Stephan Schönfelder, die UVC-Strahlen zur Luftreinigung verwenden und die Ausbreitung der Keime in Klassenzimmern simulieren, das Team von Prof. Dr.-Ing. Klaus Holschemacher, das recycelten Carbonbeton entwickelt oder aber Prof. Dr.-Ing. Robert Böhm, der mit seinen Mitarbeitenden Methoden erprobt, um Verbundwerkstoffe aus der Luftfahrt und aus Windkraftanlagen wiederzuverwenden.
Das Forschungsmagazin der HTWK Leipzig wird aus Mitteln des Projekts Saxony⁵ mitfinanziert, das im Rahmen des Bund-Länder-Programms Innovative Hochschule gefördert wird.
Keine Ausgabe mehr verpassen
Gern können Sie kostenfrei die Einblicke postalisch oder digital abonnieren. Die Einblicke erscheint einmal im Jahr.
Viel Lesevergnügen wünscht Ihnen die Einblicke-Redaktion des Referats Forschung der HTWK Leipzig!
Rund 90 Wissenschaftler aus aller Welt haben sich für die Konferenz angemeldet. Sie alle sind Expertinnen und Experten auf dem Gebiet des internationalen Baurechts und Baumanagements. Auf hohem akademischem Level und mit starker Anwendungsorientierung tauschen sie sich beim LADR-Workshop über neueste Entwicklungen aus, um so den Wissenstransfer innerhalb der akademischen Gemeinschaft, aber auch in die Bauindustrie und in Behörden zu erhöhen.
Programm mit Vorträgen und Keynotes

An zwei Konferenztagen finden unter anderem Vorträge zu den Themen Rechtsstreit, Schadensersatz, Streitbeilegung, Risiko-Management, Verträge und Konflikte sowie Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Bausektor statt. „Erstmals neu sind die Themen Building Information Modeling (BIM) und Vertragsmanagement, um noch besser die aktuellen wissenschaftlichen Entwicklungen im Bereich des Bau- und Vertragsrechts abbilden zu können“, so Ulrike Quapp, Dekanatsrätin der Fakultät Bauwesen an der HTWK Leipzig und Senior Editor der LADR-Zeitschrift.
Zur Workshop-Eröffnung und den Keynotes am Dienstag, den 1. Juli 2025, werden hochkarätige Gäste erwartet: Nach einer Begrüßung und Einführung durch Professor Klaus Holschemacher sprechen ab 9:00 Uhr Dirk Panter, sächsischer Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz, Lance VanDemark, Chefredakteur des LADR-Journals, Courtney Mazzone, Konsulin vom US-Generalkonsulat in Leipzig, sowie Professor Faouzi Derbel, Prorektor für Forschung und Nachhaltigkeit an der HTWK Leipzig.
Es folgen zwei Keynotes von ausgewiesenen Experten: Dr.-Ing. Matthias Tietze (C3 – Carbon Concrete Composite Verband) gibt einen Überblick zur Regelungssituation für innovative Bauweisen in Deutschland am Beispiel von Carbonbeton. Sarah Kristina Merz (Deubim) befasst sich in ihrem Vortrag mit Normen und rechtliche Anforderungen in BIM-Projekten. Nach den beiden ganztägigen Konferenztagen mit Vorträgen am 1. und 2. Juli 2025 haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit, die Stadt Leipzig bei einer kulturellen Tour auf den Spuren von Goethes Faust besser kennenzulernen.
Veröffentlichung in LADR-Sonderausgabe
Alle Vortragenden werden ihre neuesten Erkenntnisse auch in Beiträgen in einer Sonderausgabe der LADR-Zeitschrift veröffentlichen. Die Zeitschrift ist im Ranking wissenschaftlicher Datenbanken hervorragend positioniert und als Fachpublikation hoch angesehen. So können sich zudem andere Fachleute im Bereich des Baurechts und Baumanagements im Nachhinein weiterbilden.
Der LADR-Workshop wird unter anderem gesponsert von der Kanzlei Seufert Rechtsanwälte und dem Construction Institute der American Society of Civil Engineers (ASCE). Die Amerikanische Gesellschaft der Bauingenieure ist eine der größten Vereinigungen in der Bauindustrie und setzt sich unter anderem für eine nachhaltige Infrastruktur für die Zukunft ein.
Im Mittelpunkt der diesjährigen Ausgabe der Veranstaltungsreihe stand der Forschungscampus Weigelstraße im Leipziger Stadtteil Engelsdorf als einen der jüngsten HTWK-Forschungsstandorte. Gelegen im Innovationspark Bautechnik Leipzig/Sachsen feierte im September 2022 das Institut für Betonbau (IfB) hier die Eröffnung des Carbonbetontechnikums. Rund zwei Jahre später eröffnete die Forschungsgruppe FLEX nur wenige Meter entfernt das HolzBauForschungsZentrum. In beiden Reallaboren entstehen Innovationen rund um das Bauen der Zukunft mit Carbonbeton und mit Holz – und das im Realmaßstab.
Begleitendes Fachprogramm sowie Rundgänge und Mitmachstationen
Die Forschungsgruppe FLEX verband mit der Veranstaltung zugleich ihr Jubiläumsfest zum 10-jährigen Bestehen, begleitet von einem Fachprogramm rund um digital basierte Konzepte für das ressourcensparende, kreislauffähige Bauen von morgen an der HTWK Leipzig. Zum Bauen mit Carbonbeton sprach Prof. Dr. Klaus Holschemacher vom Institut für Betonbau. Es folgten Vorträge von Tobias Rudloff vom Institut für Prozessautomation und Eingebettete Systeme über „Digitalbeton“ und von Prof. Dr. Ingo Reinhold vom iP³ Leipzig, dem Institute for Printing, Processing and Packaging Leipzig, über Additive Fertigung. Danach gaben Mitarbeitende der Forschungsgruppe FLEX in weiteren Vorträgen Einblicke zur Robotik im Holzbau, zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz sowie zu den Potenzialen durchgängig digitaler Wertschöpfungsketten.
Die zahlreichen Gäste hatten im Laufe des Nachmittags und Abends zudem Gelegenheit, sich an verschiedenen Stationen sowohl im HolzBauForschungsZentrum als auch im Carbonbetontechnikum über die Innovationskraft der Reallabore zu informieren und praktische Einblicke in die Forschungsarbeit vor Ort zu erhalten. Das Interesse hierfür war bis in die Abendstunden hinein ungebrochen.
Weitere Programmpunkte: Keynote und Dissertationspreis

Die Möglichkeiten für Rundgänge wurden durch weitere spannende Programmpunkte ergänzt: Nach einer Begrüßung durch Prof. Dr. Jean-Alexander Müller, dem Rektor der HTWK Leipzig, erfolgte die Verleihung des Dissertationspreises 2024 der Stiftung HTWK. Diese ehrte in diesem Jahr Dr. Christoph Oefner, der sich in seiner Promotion mit dem klinischen Problem der Implantatlockerung bei Patientinnen und Patienten mit Osteoporose befasste – einem wachsenden Problem in einer zunehmend älter werdenden Gesellschaft.
Im Anschluss folgte ein Gastvortrag von Thomas Strobel, Geschäftsführer der Unternehmensberatung Fenwis. Der „Zukunftslotse“ warf mit seiner Rede zur „Innovationsroadmap 2050“ einen Blick auf den Bausektor der Zukunft und erläuterte an zahlreichen Beispielen, unerlässliche Schritte und Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Zukunftsplanung und notwendige Transformationen in den kommenden 25 Jahren. Passend zum 10-jährigen Jubiläum gab Prof. Dr. Alexander Stahr, Leiter der Forschungsgruppe FLEX, einen Ausblick auf deren künftige Entwicklung. Als einem der nächsten Entwicklungsschritte steht dabei die Gründung des Instituts als ein weiteres In-Institut der HTWK Leipzig an, ums so deren langfristig ausgerichtete Handlungsstrategie zu betonen.
Weitere Impressionen von „Forschung trifft …“ 2025
Vom intelligenten Spiegel über leuchtenden Beton bis hin zu Blitzen in der Luft
Geöffnet sind an diesem Freitagabend mehrere Gebäude am zentralen Campus im Leipziger Süden sowie der Wiener-Bau in der Wächterstraße 13 im Zentrum-Süd. Zu den Exponaten und Mitmachstationen am zentralen Campus zählen beispielsweise ein mit einem Fernseher verbundenes Fahrrad, leuchtender Beton, ein interaktiver Sandkasten, eine Station um einen HTWK-Hasen zu löten oder ein Spiegel, der einiges über sein Gegenüber erzählen kann. Geöffnet sind außerdem mehrere Labore, darunter zum gläsernen Wasserturm, zum Outdoor-Labor zu Agri-Photovoltaik oder zur Drucktechnologie – bei der die Gäste ihren individuellen Tischtennisball gleich im Spiel ausprobieren können. Und wer sich für Roboter interessiert, kann nun auch eine neue Generation des Roboterfußballs kennenlernen.
Im Wiener-Bau gibt es im Hochspannungslabor, das in der Region einzigartig ist, wieder Blitze in der Luft und andere faszinierende Wirkungen von Elektrizität zu bestaunen. Zum Ausprobieren laden verschiedene Versuche zur Medizintechnik ein oder die Leobots, bei denen alle interessierten Roboter bauen können, – und es warten die leckeren Eiskreationen vom Makers Lab auf Testerinnen und Tester.
Spezielle Veranstaltungen für Kinder oder auf Englisch

Viele Angebote an der HTWK Leipzig richten sich sowohl an Kinder als auch an Erwachsene. Bei zwei dieser Angebote wird um vorherige Anmeldung gebeten, um eine Teilnahme garantieren zu können: Die Hochschulbibliothek hat ein Escape-Room-Game entwickelt, das sich an rätselbegeisterte Jugendliche richtet. Diese können in dem einstündigen Erlebnis eine Zeitreise machen. An Kinder ab dem Grundschulalter richtet sich das Angebot der Fachgruppe Chemie am Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Zentrum: „Ein Fall für Chemiededektive – Was passierte im Aquarium?“. Auch hier ist das Platzangebot begrenzt.
Englischsprachige Gäste, die sich für Drucktechnik interessieren, können insbesondere beim Programmpunkt „Duschen und Drucken: Zwei Welten, eine spritzige Verbindung“ auch nach einer Vorführung in Englisch fragen. Bei dem Angebot werden Experimente vorgeführt, die die Phänomene in grundlegende Prozesse beleuchten, die sonst auch in industriellen Inkjet-Anwendungen eine entscheidende Rolle spielen.
Die App zur Wissenschaftsnacht – Entwickelt an der HTWK Leipzig
Neben der HTWK Leipzig beteiligen sich wieder zahlreiche andere Forschungseinrichtungen an der Langen Nacht der Wissenschaften in Leipzig. Das gesamte Programm für die Stadt Leipzig gibt es auf der Seite www.wissen-in-leipzig.de. Erstmals ist das Programm auch in einer App zur Wissenschaftsnacht in Leipzig abrufbar. Diese befindet sich noch in der Betaphase, kann aber bereits für Android-Geräte im Playstore und im Apple-App-Store heruntergeladen werden.
Entwickelt wurde die App von Jörg Bleymehl, Professor für Angewandte Medieninformatik und Mediengestaltung an der Fakultät Informatik und Medien der HTWK Leipzig. „Die Entwicklung der App für die Lange Nacht der Wissenschaften zeigt ein hohes Engagement für den gesamten Wissenschaftsstandort Leipzig von dem alle Hochschulen und Forschungseinrichtungen profitieren werden. Im Namen der Stadt Leipzig und des Leipzig Science Network danke ich Prof. Bleymehl für seine hervorragende Arbeit“, so Dr. Torsten Loschke, Leiter des Referats Wissenspolitik der Stadt Leipzig.
Alle Absolventinnen und Absolventen der HTWK-Studiengänge Informatik, Medieninformatik und Mathematik sind zum Alumni-Treffen ab 17 Uhr eingeladen. Zum Programm und zur Anmeldung.
Seit mehr als zehn Jahren entwickelt Stahr mit der interdisziplinären Forschungsgruppe FLEX (Forschung.Lehre.Experiment) Strategien für individualisiert-automatisierte Fertigungskonzepte im Holzbau. Den Anfang bildeten Forschungen zum Zollingerdach, einer besonders materialeffizienten Dachbauweise mit gekrümmten Hölzern, der FLEX dank Digitalisierung und Weiterentwicklung eine neue Perspektive geben konnte. Daraus entwickelten sich zahlreiche weitere Projekte zum innovativen Holzbau. Der jüngste Meilenstein war schließlich die Eröffnung des HolzBauForschungsZentrums an der HTWK Leipzig im August 2024 in Leipzig-Engelsdorf. In dieser in Bezug auf ihre technologische Ausstattung alsbald einzigartigen Forschungs- und Fertigungshalle können Stahr und sein Team aus Architektur und Ingenieurwesen neue Konzepte für materialsparende Lösungen im Realmaßstab und auf Anwendungsniveau entwickeln und erproben. Damit will die Forschungsgruppe FLEX ihrem Anspruch gerecht werden, anwendungsnahe Spitzenforschung zu betreiben.
Begleitendes Fachprogramm und Forschung zum Anfassen
Um den rund 250 Gästen aus, Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft einen Einblick in diesen angewandten Forschungsbereich zu geben, folgte ein breit gefächertes Vortragsprogramm rund um digital basierte Konzepte für das ressourcensparende, kreislauffähige Bauen von morgen an der HTWK Leipzig. Zunächst sprachen Prof. Dr. Klaus Holschemacher vom Institut für Betonbau über Carbonbeton, Tobias Rudloff vom Institut für Prozessautomation und Eingebettete Systeme über „Digitalbeton“ und Prof. Dr. Ingo Reinhold vom iP³ Leipzig, dem Institute for Printing, Processing and Packaging Leipzig, über Additive Fertigung. Es folgten Vorträge der Forschungsgruppe FLEX zur Robotik im Holzbau, der Nutzung von Künstlicher Intelligenz sowie zu den Potenzialen durchgängig digitaler Wertschöpfungsketten.
Praktisch sichtbar wurde die Forschung bei Rundgängen durch das HolzBauForschungsZentrum sowie an Stationen innerhalb der Halle. Zu sehen gab es einen Industrieroboter, der mit einem Stift bestückt Portraits von Besuchenden zeichnete sowie einen kollaborativen Roboter („Cobot“) und einen „LEGO-Roboter“ im Einsatz. Darüber hinaus konnten die Gäste durch eine Mixed-Reality-Brille die „Bauanleitung“ für eine Holzständerwand sehen und ein elementiertes 3D-gedrucktes Modell des weiterentwickelten Zollingerdaches selbst zusammenbauen. Sie konnten bestaunen, wie „Double-Layer-Holzfurniere“ sich unter dem Einfluss wechselnder Luftfeuchte verformen, um in Zukunft als „natürlich gesteuerte“, einzeln austauschbare Verschattungslamellen Räume zu verschatten und Klimatisierungskosten zu reduzieren.
Zukunftslotse Thomas Strobel über den Bausektor der Zukunft
Ein weiteres Highlight war die Keynote von Thomas Strobel, Geschäftsführer der Unternehmensberatung Fenwis. In seiner Funktion als „Zukunftslotse“ warf er mit seiner Rede „Innovationsroadmap 2050“ einen Blick auf den Bausektor der Zukunft. Dabei spannte er den Bogen zwischen wichtigen Rahmenbedingungen eines Zukunftsbildes 2050, erfolgreichen Vorgehensweisen für Zukunftsplanung und den Transformationen, die dafür in den kommenden 25 Jahren erforderlich sein werden. Aus einer chancenorientierten Perspektive betrachtete er erfolgreiche Praxisbeispiele für Kreislaufwirtschaft sowie neue Anforderungen und Erfolgsfaktoren im Bausektor. Seine Keynote reicherte er mit Impulsen zu pragmatischen Zukunftsideen und interdisziplinärem, branchenübergreifendem Austausch an, damit auch Ausbildungskonzepte und Förderprogramme auf zukünftige Bedarfe ausgerichtet werden können.
Ausblick: FLEX erfindet sich neu
Zum Abschluss gab Stahr einen Ausblick auf die Pläne und Entwicklung der Forschungsgruppe FLEX. „Wir freuen uns, dass wir dabei sind, ein eigenes Institut zu gründen. Dies wird der nächste Schritt sein, um unseren Partnern zu signalisieren: Wir haben noch viel vor! Innovation und Verlässlichkeit sind die Säulen unserer langfristig ausgerichteten Handlungsstrategie.“
Hintergrund zu „Forschung trifft …“ und zum Dissertationspreis 2024
Die Jubiläumsfeier fand im Rahmen der Netzwerkveranstaltung „Forschung trifft …“ statt, bei der die HTWK Leipzig einmal im Jahr Mitarbeitende und Forschende sowie Gäste einlädt, Hochschulstandorte und die dort ansässigen Labore und Forschungsprojekte kennenzulernen. Am Forschungscampus Weigelstraße in Leipzig-Engelsdorf im Innovationspark Bautechnik Leipzig/Sachsen befinden sich zwei der größten und neuesten Forschungs- und Fertigungshallen: Das HolzBauForschungsZentrum und das Carbonbetontechnikum. Zwei Orte, an denen Innovationen zum Bauen der Zukunft mit Holz und mit Carbonbeton entstehen – und das im Realmaßstab.
Bei der Veranstaltung verlieh die Stiftung HTWK heute zugleich den Dissertationspreis 2024, mit dem sie jährlich herausragende Promotionen mit hohem Praxisbezug würdigt. Dieses Jahr ehrte die Stiftung Dr. Christoph Oefner: Der Maschinenbauingenieur befasste sich mit dem klinischen Problem der Implantatlockerung bei Patientinnen und Patienten mit Osteoporose. Er entwickelte ein digitales Vorhersagemodell zur quantitativen Lebensdauerabschätzung von Verankerungen mit Pedikelschrauben und nahm den Preis während der feierlichen Verleihung entgegen.
In seinem Eröffnungsvortrag stellte Prof. Thiele die bisherige geotechnischen Forschung an der HTWK Leipzig vor. Anschließend erläuterte er, basierend auf der Motivation und Verantwortung der Gruppe, den zukünftigen Forschungsschwerpunkt „Geotechnik und Klimawandel“ des Instituts. „Wir werden uns zukünftig im Institut verstärkt den sogenannten Ökosystem-Dienstleistungen des Bodens widmen, wie zum Beispiel seiner Fähigkeit, Wasser zu puffern, zu speichern, zu filtern und zu reinigen. Damit erlangen wir ein besseres Verständnis der klimainduzierten Belastung im urbanen Raum“, so Thiele.
Bei der Gründungsfeier hatten die rund 75 Gäste aus Praxis und Hochschule zudem die Gelegenheit, das neue GeoTechnikum am Forschungscampus in der Eilenburger Straße 13 kennenzulernen. Dieses besteht aus dem bodenmechanischen Forschungslabor, Modellständen, zwei geotechnischen Versuchshallen mit Bodenprüfgruben für Versuche im Realmaßstab sowie Werkstätten. Zum Abschluss blieb Zeit für einen persönlich und fachlichen Austausch.
Im Bereich Geotechnik finden an der Hochschule oder mit Beteiligung von HTWK-Forschenden jährlich folgende Veranstaltungen statt:
- Geotechnikseminar: Pro Semester werden fünf Fachvorträge aus der Bauwirtschaft gehalten. Eine Teilnahme ist in Präsenz und online möglich.
- Erdbaufachtagung: Hier tauschen sich Expertinnen und Experten aus Bauplanung, Ausführung und Forschung aus. Die nächste, nunmehr 20. Tagung findet am 13. und 14. Februar 2025 in Leipzig statt und widmet sich dem Fachthema „Erdbau im Wandel“.
- Deponiefachtagung: Die Leipziger Deponiefachtagung dient als Podium zur Diskussion technischer und rechtlicher Fragestellungen des Deponiebaus, der Kreislauf- und Abfallwirtschaft sowie des Umweltschutzes. Der nächste Termin ist am 11. und 12. März 2025 in Leipzig.
- 1. Leipziger Geotechnik-Symposium (LeiGS): Die neue Plattform lädt zum interdisziplinären Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis zu jährlich wechselnden fachübergreifenden geotechnischen Schwerpunktthemen ein. Das 1. LeiGS findet am 13. und 14. November 2025 statt und widmet sich dem Themenfeld „Geotechnik und Klimawandel“.
Vortrag von IfB-Mitarbeiter Dr. Steffen Rittner
Unter den Referierenden war auch Dr. Steffen Rittner, Mitarbeiter am Institut für Betonbau der HTWK Leipzig. Er hielt in Session 1 zur „Zukunft des Leichtbaus: nachhaltige Materialien und innovative Fertigungstechnologien“ einen Vortrag zur „Ressourcenschonung durch angepasste Produktionsverfahren und den Einsatz von Recyclingmaterialien“.
Demnach bietet der Einsatz von Carbonbeton und die Verwertung faserhaltiger Abfälle großes Potenzial für Ressourcenschonung und Klimaschutz im Bauwesen. Derzeit entstehen jedoch bei der Herstellung der dafür notwendigen Bewehrungsmaterialien noch zu hohe Verschnittabfälle. Des Weiteren sind Materialströme beim Recyclingprozess fehlgeleitet, wodurch ein wertvolles Ressourcenpotential bislang ungenutzt bleibt. Um dies zu vermeiden, wird das patentierte Verfahren zur Direktgarnablage weiterentwickelt, sodass zukünftig individuell einstellbare und verschnittfreie Bewehrungsstrukturen realisierbar sind.
Parallel dazu wird in weiteren Forschungsarbeiten die Aufbereitung von faser- und mineralhaltigen Abfällen zu hochwertigen Sekundärbaustoffen für den Einsatz in Carbonbeton vorangetrieben. Schwerpunkte liegen hierbei auf der Verwendung recycelter Carbonfasern und feiner Gesteinskörnungen. Die Entwicklungen umfassen einerseits anwendungsorientierte Anpassungen des robotergestützten Verfahrens zur Direktgarnablage andererseits nachhaltige Betonmischungen mit einem sehr hohen Rezyklatanteil, um mechanische und ökologische Anforderungen zu erfüllen. Die Ergebnisse zeigen eine signifikante Verbesserung der Prozesskette sowie der Betoneigenschaften. Der im Rahmen der Forschungsarbeiten am IfB, gemeinsam mit dem Projektpartner BCS Natur- und Spezialbaustoffe, neu entwickelte Beton wurde mit einem Sonderpreis zur Verleihung für den Preis der Ostdeutschen Bauindustrie im Mai 2024 gewürdigt.

Die Arbeiten leisten so einen Beitrag zur Schaffung nachhaltiger, ressourcenschonender Baumaterialien und tragen zur Transformation des Bauwesens in eine zirkuläre Wirtschaftsweise bei.
„Welche Anwendungsgebiete es für die Drucksondierung gibt, welche neue Technik dafür zur Verfügung steht und wie wir am Institut für Geotechnik der HTWK Leipzig (IGL) diese Methode in unseren Forschungsprojekten einsetzen, zeigen wir bei unserem ersten DemoDay Drucksondierung am GeoTechnikum“, sagte Ralf Thiele, HTWK-Professor für Bodenmechanik, Grundbau, Fels- und Tunnelbau sowie Leiter des IGL, bei der Begrüßung.
Aus gemeinsamer Forschung entstand Idee zum DemoDay
Der Demonstrationstag am Mittwoch, den 19. März 2025, wurde gemeinsam vom IGL und Royal Eijkelkamp B.V. veranstaltet. Das niederländische Unternehmen Eijkelkamp entwickelt und produziert seit über 110 Jahren Geräte für die Bodenuntersuchung. Seit rund zwei Jahren arbeiten Eijkelkamp und das IGL am GeoTechnikum gemeinsam an Forschungsfragen zur Verbesserung der Drucksondiertechnik. Aus dieser Kooperation entstand die Idee, das Thema in der Region stärker sichtbar zu machen.
Zum DemoDay reisten rund 35 Vertreterinnen und Vertreter von 15 Firmen aus ganz Deutschland an. Die Teilnehmenden, darunter auch Studierende der Hochschule, erhielten In Präsentationen und Demonstrationen praxisnahe Einblicke in Technik, Einsatzmöglichkeiten, Durchführung sowie Interpretation von Drucksondierungen. Sie konnten das Verfahren dabei nicht nur theoretisch kennenlernen, sondern am praktischen Beispiel in den Versuchshallen am GeoTechnikum auch live erleben und sogar selber sondieren.
Live-Demonstrationen ermöglichen Blick in den Untergrund
Gerald Verbeek von Eijkelkamp eröffnete den fachlichen Teil mit einer theoretischen Einführung. Anschließend demonstrierte er mit einem Kollegen das Verfahren mit einer kompakten Sondierraupe in der Versuchshalle des GeoTechnikums. Ein besonderes Highlight war ein innovatives Video-Modul, das während der Sondierung hochauflösende Aufnahmen aus dem Untergrund lieferte. So konnten die Teilnehmenden von der Oberfläche aus direkt in den Untergrund blicken.
Parallel dazu präsentierten Bénédict Löwe vom IGL und Marco van Lichtenberg von Eijkelkamp ein tragbares Gerät zur Messung des Eindringwiderstands bis in eine Tiefe von etwa einem Meter. Es ermöglicht Aussagen über die Befahrbarkeit oder Durchwurzelbarkeit des Bodens und kommt beispielsweise bei der Prüfung der Bettungsqualität unterirdischer Stromkabel, also erdverlegter Kabeltrassen, zum Einsatz. In der Landwirtschaft kann mit dem Gerät bewertet werden, ob der Boden ausreichend locker für die Durchwurzelung oder fest genug für den Einsatz schwerer Maschinen ist.
Für die anwesenden Praxispartner war es ein informativer und abwechslungsreicher Tag mit vielen Gelegenheiten, neueste Technik selbst auszuprobieren. „Wir spielen mit dem Gedanken, uns auch solche Geräte anzuschaffen“, berichtete ein Unternehmensvertreter im Anschluss.
Ergänzend zur Vorführung erhielten die Gäste am GeoTechnikum einen Einblick in die bodenmechanischen und umwelttechnischen Labore sowie in die beiden Versuchshallen mit umfassender Messtechnik und eigenen Geräten für die Drucksondierung der Hochschule.
Wiederholung geplant
Weitere Demonstrationstage mit Praxispartnern sind bereits in Planung. „Es freut uns sehr, dass das Thema auf so großes Interesse stößt. Für uns ist das ein deutliches Zeichen, den Austausch weiter zu fördern und die Veranstaltung zukünftig mit weiteren Themenschwerpunkten fortzusetzen“, so Professor Thiele zum Abschluss der Veranstaltung.
Hintergrund zum Institut für Geotechnik Leipzig (IGL)
Die Geotechnik ist der zweitstärkste Forschungsbereich an der HTWK Leipzig. Um die Kompetenzen der beiden Geotechnikprofessuren von Prof. Ralf Thiele und Prof. Said Al-Akel zu bündeln, gründete sich im Oktober 2024 das Institut für Geotechnik an der HTWK Leipzig (IGL). Das interdisziplinäre Team aus den Bereichen Bauingenieurwesen, Maschinenbauingenieurwesen, Geografie und Geologie befasst sich insbesondere mit umweltgeotechnischen und klimarelevanten Fragestellungen. Ebenfalls beschäftigt es sich mit Themen der Makro- und Mikromechanik von Böden und überträgt Ergebnisse auf praktische Bauprozesse und aktuell relevante Querschnittsthemen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der Geotechnik. Der DemoDay Drucksondierung schließt an das Forschungsfeld der geowissenschaftlichen Messtechnik und Baugrundverbesserung an.
Die Geotechnik ist zudem Mitglied im Transferverbund Saxony⁵ der fünf sächsischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Im Teilprojekt „Nachhaltiges Bauen“ werden Forschungsergebnisse am GeoTechnikum ‒ einem Experimentier- und Demonstrationsraum mit Freiversuchsflächen und einem bodenmechanischen Forschungslabor ‒ in großem Maßstab validiert und für Partner aus Praxis und Wissenschaft demonstriert.
Ein neues Großforschungsgerät ermöglicht der HTWK Leipzig nun, diese Pulver genauer zu analysieren: „Wir untersuchen Prozesse, bei denen das Pulver nicht nur als Baumaterial dient, sondern auch funktionale Eigenschaften besitzt. Zusätzliche Funktionen wie elektrische Leitfähigkeit können wir gezielt über einen Druckkopf einbringen. Dadurch eröffnen sich neue Möglichkeiten für die Herstellung multimaterialer und multifunktionaler Bauteile“, erklärt Ingo Reinhold, Professor für Beschichtungsprozesse an der HTWK Leipzig.
Um neuartige funktionale, 3D-gedruckte Materialien und Bauteile in einem vielfältigen und interdisziplinären Konsortium zu erforschen, bildete sich an der HTWK Leipzig der Forschungsbereich Multimaterial-AM heraus. In diesem bündeln Professoren aus den Fakultäten Informatik und Medien sowie Ingenieurwissenschaften ihre Kompetenzen. 2023 beantragten sie bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) eine Großgeräteförderung. Mit Erfolg: Als eine von 16 Hochschulen erhielt die HTWK Leipzig ab Januar 2024 eine Finanzierung in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro für Technik, um den 3D-Druck weiter zu erforschen. Zu den neuen Geräten gehören zwei 3D-Drucker und die nun eingetroffene Pulverscherzelle.
Neue Pulverscherzelle in Betrieb
Die Pulverscherzelle, ein Analyse-Gerät zur Bestimmung von Fließeigenschaften, ist Anfang März 2025 angekommen und in Betrieb genommen worden: „Mit dem Präzisionsrheometer von Anton Paar analysieren wir den Fluss von Pulvermaterialien in einer kontrollierten Temperatur- und Feuchteumgebung, um die Geschwindigkeit und Präzision der Prozesse weiter zu optimieren“, erklärt Reinhold.
Die Pulverscherzelle ermöglicht hochpräzise Rheologiemessungen im Temperaturbereich von 5 bis 120 Grad Celsius und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 5 bis 95 Prozent. Mit ihr lassen sich wichtige Parameter wie Kohäsion, Fließgrenze und Wandreibungseffekte ermitteln. Das ist besonders relevant für den High-Speed-Sintering-Druckprozess, bei dem unter anderem wasserbasierte Inkjet-Tinten eingesetzt werden. Der freigesetzte Wasseranteil kann die Fließfähigkeit des Pulvers erheblich verändern und damit die Dichte sowie die Qualität der gedruckten Bauteile beeinflussen. „Durch diese Messungen können wir gemeinsam mit unseren Partnern in der Materialforschung den Druckprozess gezielt analysieren und optimieren.“
In einer ersten Messreihe widmeten sich Reinhold und sein Team dem Alterungsverhalten von PA12-Pulvern aus dem Selective Laser Sintering (SLS). Reinhold: „Dabei konnten wir nachweisen, dass die Alterung zu einer Erhöhung der Kohäsion, also dem Zusammenhalt, führt, was die Verarbeitbarkeit mehrfach genutzter Pulver erschwert. Gleichzeitig bieten die Messdaten uns eine Grundlage, um die Wiederverwendbarkeit der Pulver gezielt zu verbessern und den notwendigen Auffrischungsgrad der Pulvermischungen zu minimieren. Zusätzlich kann die Temperatur- und Feuchteregelung auch für Versuche mit Kegel-Platte-Geometrie oder Torsion genutzt werden, um Materialkennwerte von Pasten oder Polymeren bei den entsprechenden Umgebungsparametern zu ermitteln.“
Weitere 3D-Drucker werden noch geliefert
Voraussichtlich im Sommer 2025 sollen auch die beiden neuen 3D-Drucker eintreffen. Der Drucker mit Powderbed-Fusion/IR-3D-Drucksystem kann verschiedene Pulver und Tinten durch Wärmestrahlung miteinander verschmelzen und neben der mechanischen Funktion des Bauteils auch lokal Eigenschaften definiert verändern. So können Forschende beispielsweise mit Nanopartikeln elektrische Leiter oder Sensorik in mechanische Strukturen einbringen.
Ein weiterer 3D-Drucker ist für medizinische Anwendungen vorgesehen. Er ermöglicht das Drucken komplexer Materialkombinationen in Granulat- oder Pastenform, die über die verschiedenen Druckköpfe eingespeist werden. Biomedizinerinnen und Biomedizinern erlaubt das Verfahren zum Beispiel, Knochenimplantaten Arzneimittel beizugeben, damit diese vom Körper besser angenommen werden.
Hintergrund zum Forschungsbereich Multimaterial-AM
Der Forschungsbereich Multimaterial-AM verbindet das fakultätsübergreifende Leipzig Center of Materials Science mit dem Institute for Printing, Packaging und Processing (iP3) an der Fakultät für Informatik und Medien, das bereits seit Jahren die Anwendung additiver Fertigungsverfahren im Rahmen der klassischen Druck- und Verpackungstechnik erforscht.<s> </s>
Das Team von Prof. Robert Böhm, Professor für Leichtbau mit Verbundwerkstoffen, gibt Einblicke in drei Projekte: Das europäische Forschungsprojekt EuReCOMP befasst sich mit nachhaltiger Kreislaufwirtschaft, das Iccas-Forschungsprojekt SoKoROMed mit Soft- und Kontinuumsrobotik für medizinische Anwendungen und PRINTCAP mit einer neuen Generation von 3D-gedruckten strukturellen Superkondensatoren als Energiespeicherlösungen für CO2-freie Mobilitätssysteme.
Das Team von Prof. Ingo Reinhold, Professor für Beschichtungsprozesse, zeigt Dichtungen und Transistoren. Die funktionalisierten Dichtungsmaterialien sind für den Einsatz in der Industrie 4.0 vorgesehen. Neben der dichtenden Funktion von Rohren sollen die Dichtungen Materialeigenschaften überprüfen können und somit den Wartungsaufwand minimieren. Die 3D-gedruckten Transistoren sollen wiederum für Sensoranwendungen, beispielsweise in der Medizintechnik zur Glukosemessung, genutzt werden.
Von der Arbeitsgruppe Hybride und Generative Fertigungstechnologien sind additiv hergestellte Schalldämpfer für zivile Anwendungen und eine 3D-gedruckte poröse Struktur für Zellwachstumsstudien ausgestellt. Diese sind Ergebnisse aus Projekten, in denen es um neuartige additive Leitungs- und Gehäusebauteile mit immanenten Schalldämpfungs- und Schalldämmungsstrukturen geht sowie um Design und Biofunktionalisierung von Cloud Sponge-inspirierten Scaffolds für eine verbesserte Leistung von Knochenzellen.
Zu sehen sind auch Ergebnisse aus dem Projekt AkkoLight von Prof. Johannis Zentner, bei dem Leichtbaulösungen in der Akkordeon-Fabrikationen entstehen. Auf der Messe können Besucherinnen und Besucher deshalb einen Demonstrator für ein leichtes Akkordeongehäuse aus geschäumtem Kunststoff, konkret aus LW-ASA, besichtigen. Schließlich gibt es aus dem Forschungsbereich Prozessleittechnik und Prozessführung von Prof. Tilo Heimbold einen Carbon Connector zu sehen. Dieser entstand im Projekt EMEK 3D. Hierbei geht es um ein 3D-Druckverfahren zur elektrischen Kontaktierung von Carbonfasern.
„Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit verspricht spannende Einblicke, wie neue Technologien verschiedene Branchen revolutionieren können, von erneuerbaren Energien über das Gesundheitswesen bis hin zur Fertigung“, so Dr. Dmytro Rassokhin von der Forschungsgruppe Leichtbau mit Verbundwerkstoffen
Unseren HTWK-Forschenden freuen sich auf Besucherinnen und Besucher sowie spannende Gespräche an Stand D40 in Halle 3.
Interessierte können zudem für Freitickets den kostenlosen Code „ITC25BUILDING“ nutzen.
Hintergrund zur Intec-Messe
Alle zwei Jahre treffen sich auf der Intec Fachleute aus dem Maschinen- und Anlagenbau, um sich über innovative und passgenaue Technik für die täglichen Aufgabenstellungen in der Produktion auszutauschen. Parallel zur Intec findet die Zulieferermesse Z statt, bei der Fachleute aus der Zuliefererbranche den Fokus auf Teile, Komponenten, Module, Technologien sowie industrielle Dienstleistungen legen. Damit wird also die komplette Wertschöpfungskette für die Metallverarbeitung abgebildet.
Öffnungszeiten:
- Bis 13.03.2025: 9:00 bis 17:00 Uhr
- 14.03.2025: 9:00 bis 16:00 Uhr
Weitere Bilder von der Messe
Fotoausstellung

Erstmals zeigt das Referat Forschung vom 5. bis zum 28. Februar 2025 in einer Fotoausstellung im Foyer der Hochschulbibliothek alle bisherigen Gewinnerbilder des Fotowettbewerbs, denn vor genau zehn Jahren wurde der Fotowettbewerb erstmals ausgerufen. Vom 5. bis zum 28. Februar 2025 sind die Bilder während der Öffnungszeiten der Hochschulbibliothek zu sehen. Die Vernissage am 5. Februar bot den feierlichen Anlass zur Urkundenübergabe und Gratulation der aktuellen Preisträgerinnen und Preisträger.
And the winner is …
Der erste Platz des Fotowettbewerbs geht an Florian Muschka (links), Anika Mühl (rechts) und Sammy Schließer (Fotograf). Das Foto zeigt die Masterstudentin der Druck- und Verpackungstechnik und den wissenschaftlichen Mitarbeiter von Prof. Dr. Ingo Reinhold bei der Charakterisierung von gedruckten organisch elektrochemischen Transistoren (OECTs). Die hohe Empfindlichkeit und die Kompatibilität mit wässrigen Umgebungen machen OECTs ideal für Sensoranwendungen, beispielsweise in der Medizintechnik zur Glukosemessung. Die Transistoren stellten die Forschenden mittels Tampondruck her, einem Tiefdruckverfahren aus der grafischen Industrie, das sich besonders für gewölbte und unebene Oberflächen eignet. Mühl untersucht in ihrer Masterarbeit den Einfluss von Prozessparametern die Druckqualität und Leitfähigkeit von Silberstrukturen im Tampondruck. Muschka erforscht das Druckverfahren für dichtungsintegrierte Sensorik im Projekt „IntelliSeal“ am Forschungs- und Transferzentrum Leipzig der HTWK Leipzig.
2. Platz
Den zweiten Platz erhalten die Bauingenieure Herrmann Busse (Fotografie) und Lorenz Spillecke (Bildbearbeitung) für eine Bildmontage, die ihre Vision des zukünftigen Arbeitsalltags im bodenmechanischen Labor zeigt. Durch Mixed Reality, bei der reale und virtuelle Objekte in Echtzeit miteinander interagieren, könnten Laborantinnen und Laboranten zusätzlich zur reellen Situation kontextbezogene Inhalte sehen. Mithilfe einer Mixed-Reality-Brille wird beispielsweise der Blick in die Probe hinein möglich. Diese Vision hat im bodenmechanischen Kontext ein hohes Innovationspotential, sei es für eine schnellere Verfügbarkeit und Vernetzung von Informationen oder für überfachliche und dezentrale Weiterbildungen. Busse promoviert derzeit an der Technischen Universität Berlin und an der HTWK Leipzig über die Interpretation von Drucksondierungsdaten, gemeinsam mit Spillecke entwickelt er im Projekt „RoadIT1.0“ unter der Leitung von Prof. Dr. Ralf Thiele ein Messsystem für die Beanspruchung des Straßennetzes.
2. Platz
Ebenfalls den zweiten Platz erreicht das Bild von Karl Marbach, Masterstudent im Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau/Energietechnik. Als wissenschaftliche Hilfskraft arbeitet er am Lehrstuhl für Produktions- und Logistiksysteme, geleitet von Prof. Dr. Martin Gürtler. Im Rahmen seines Masterprojekts arbeitet er daran, automatisiert Arbeitsablauf-Zeitanalysen (MTM-Analysen) aus Videosequenzen zu generieren. Dafür nutzt er unter anderem Motion Capture, ein Verfahren zur Erfassung von Bewegungen, sowie eine Objekterkennung. MTM-Analysen finden im industriellen Umfeld insbesondere bei der Planung und Bewertung von manuellen Montagetätigkeiten und bei der Ermittlung von betrieblichen Planzeiten Anwendung. Darüber hinaus werden damit Montageprozesse unter ergonomischen Gesichtspunkten bewertet. Marbach entwickelt dafür einen Algorithmus, der die erfassten Bewegungen zur Verbesserung bestehender Montage-prozesse nutzt. Auf dem Foto ist Marbach bei der Erstellung eines umfangreichen Trainingsdatensatzes zu sehen. Die Bildbearbeitung zeigt die gemessenen beweglichen Bereiche der Hand.
3. Platz
Den dritten Platz des Fotowettbewerbs erhält Niels Clasen, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsgruppe FLEX. Der Bauingenieur erforschte im Projekt „Directed Timber Pressfitting“ unter der Leitung von Prof. Dr. Alexander Stahr im Rahmen seiner Masterarbeit die Klemmwirkung von leimfreien und sortenrein trennbaren Dübel-Verbindungen aus Holz. Die Forschungsgruppe prüfte stabförmige Rundholzdübel, die sie mit Nägeln aus Kunstharzpressholz aufspreizten und fest im Bohrloch einer Furnierschichtholzplatte (LVL) verbanden. In einer Versuchsreihe prüfte Clasen die Tragfähigkeit an 80 Prüfkörpern mit verschiedenen Modifikationen des Dübels. Die ersten Versuche, den Nagel stirnseitig in den Dübel einzutreiben, führten zunächst nicht zu Erfolgen: Dübel zerrissen, Platten spalteten sich auf und Nägel brachen, wie hier im Bild zu sehen. Doch diese Fehler waren wichtig für den Erkenntnisgewinn; weitere Experimente führten zur Lösung: Vorbohrungen, genauere Abstimmungen zwischen Nagel- und Dübelgröße sowie LVL-Platten mit Querlagen konnten die Verbindung schließlich auf bis zu 2 Kilonewton Auszugsfestigkeit perfektionieren.
Die Jury
Die Jury, bestehend aus dem freien Wissenschaftsfotografen Swen Reichhold, dem Referenten für Forschung Dirk Lippik sowie Katrin Haase, Forschungskommunikation, und Dr. Franziska Böhl, Forschungsmarketing, bewerteten die eingereichten Bilder unter Gesichtspunkten wie Fotoqualität, Umsetzung der Bildidee, Einzigartigkeit und Bildkomposition.
Jetzt Foto einreichen
Auch in diesem Jahr ruft das Referat Forschung wieder alle Forschenden der HTWK Leipzig dazu auf, persönliche fotografische Eindrücke einzureichen. Die Einreichung ist ab sofort möglich. Mehr Informationen finden Sie hier.
Bildergalerie Vernissage
Kern des Projekts ist die Entwicklung kleinformatiger, leichter Carbonbetonplatten, die mechanisch mit Holzbalken verbunden werden. Durch diese Bauweise wird eine einfache Montage und Demontage möglich – ohne Klebeverbindungen. Dies macht das System besonders nachhaltig und wiederverwendbar. Carbonbeton ermöglicht zudem eine erhebliche Reduktion der Bauteildicke und des Eigengewichts, wodurch sich das System flexibel an die Anforderungen von Bestandsbauten anpassen lässt.
Nachhaltigkeit und Effizienz
HBVcarbon adressiert die Herausforderungen im Bauwesen hinsichtlich Nachhaltigkeit und Effizienz. Es bietet eine vielversprechende, kostengünstige Lösung für die Sanierung von Holzbalkendecken, die modernen Anforderungen gerecht wird. Im Projekt unterstützen die Bauingenieure der HTWK Leipzig das Unternehmen Holzbau Meyer, das die Anwendung der Carbonbeton-Fertigteile untersucht. Die HTWK Leipzig entwickelt effiziente Verbindungstechnologien, die eine zentrale Rolle im Projekt spielen.
Kreislaufgerechtes Bauen

Im Forschungsprojekt builtZero, welches am 1. März 2025 startet, entwickelt die Forschungsgruppe Nachhaltiges Bauen des Instituts für Betonbau (IfB) gemeinsam mit dem Abbund-Zentrum Oelsnitz GmbH & Co. KG und TSM Bau GmbH aus Riesa ein Bausystem für leichte und treibhausgasneutrale Gebäudemodule zum kreislaufgerechten Bauen.
Die Gebäudemodule bestehen aus einem tragenden Rahmensystem und Sandwich-Wandelementen aus effizienten, umweltfreundlichen Materialien, unter anderem Stroh als Dämmmaterial und Holz. Bei der Entwicklung stehen optimierte Produktion, reduziertes Gewicht und reversible Bauprozesse im Fokus. Neue Fügetechniken sollen eine schnelle, automatisierte Montage und Demontage ermöglichen. Besonders hervorzuheben sind dabei besonders leichte Carbonbetonelemente, modulare Rahmen und wiederverwendbare Komponenten, unterstützt durch automatisierte Fertigungsprozesse. Das Teilvorhaben der HTWK fokussiert auf die Bauphysik der Wandbauteile, auf konstruktive Fragen sowie auf den Lebenszyklus der Gebäudemodule. Dazu wird ein bauphysikalisches Modell und ein Lebenszyklusmodell der Module erstellt, womit die verschiedenen Lösungsansätze für das Wandbaukastensystem bewertet werden können. Daneben untersucht die HTWK Leipzig Möglichkeiten der Automatisierung der Montage und Demontage der Wandbauteile und führt dafür Versuche durch.
Fördervolumen
Das Projekt HBVcarbon wird bis 12/2026 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) im Rahmen des Förderprogramms Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) gefördert. builtZero wird bis 2/2028 von der Sächsischen Aufbaubank finanziert. Das gemeinsame Fördervolumen beträgt knapp 800.000 €.
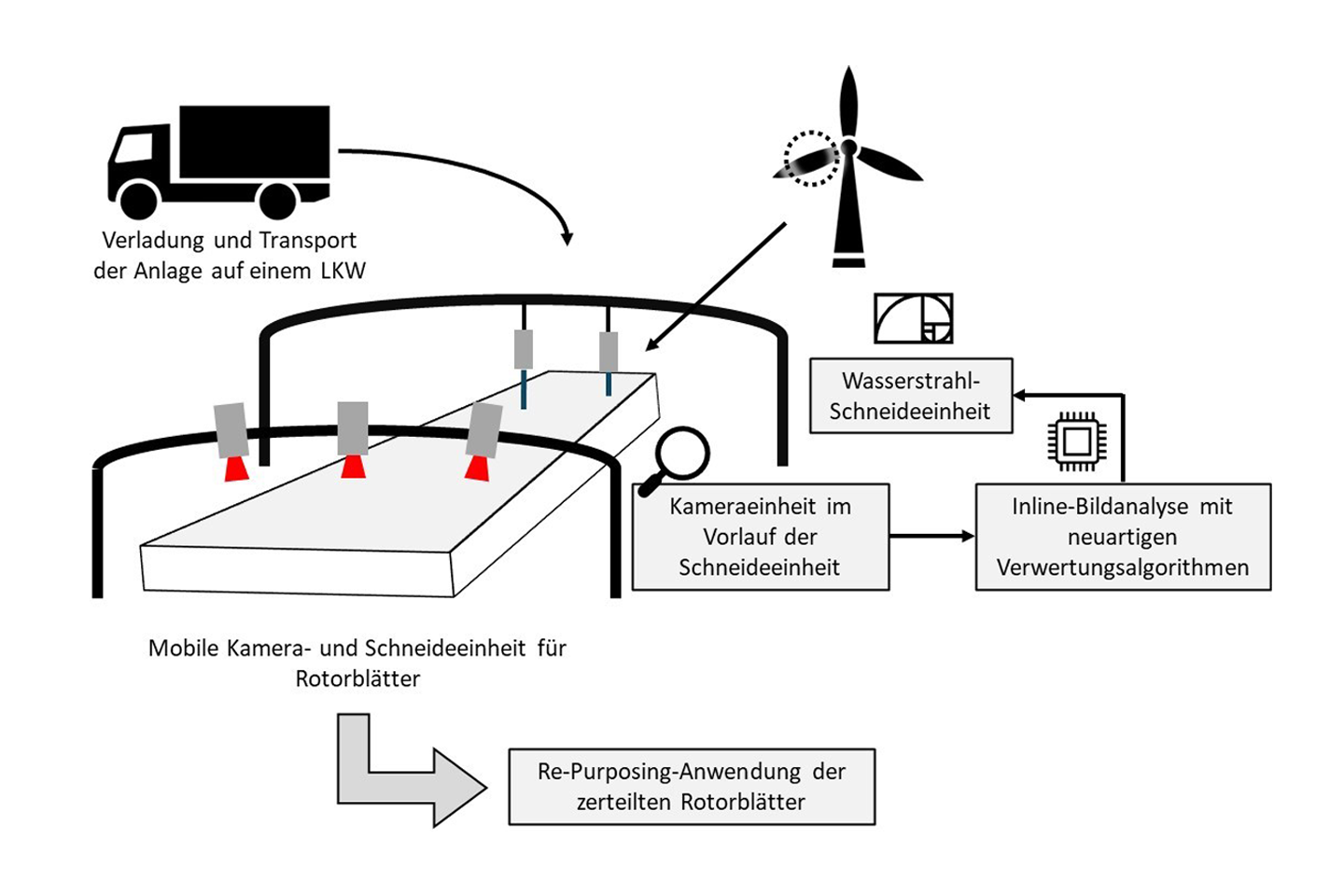
„Wir erhoffen uns von der in RecyRotor fokussierten Technologie eine Effizienzerhöhung bei der Wiederverwendung von Faserverbund-Großstrukturen. Häufig ist die Logistik, insbesondere die hohen Kosten des Transports der großen Rotorblätter vom Windpark bis zu einer Aufbereitungsstätte, der kritische Punkt, der einer Verwertung der Materialien im Sinne der Kreislaufwirtschaft bislang noch im Wege steht. Das RecyRotor-Verfahren wird diesen Nachteil in absehbarer Zeit beseitigen“, erläutert Projektleiter Prof. Robert Böhm. „Wir freuen uns, mit der Herion Engineering GmbH und der Zertrox GmbH zwei deutschlandweit führende Spezialisten auf den Gebieten Zuschnitttechnik und Bilderkennung für das Projekt gewonnen zu haben. Diese Zusammenarbeit wird die Repurpose-Technologie, die an der HTWK seit vier Jahren schrittweise zur Serienreife entwickelt wird, weiter beflügeln.“, prognostiziert der Leiter des CCL Philipp Johst. Das Vorhaben läuft bis Juni 2027 und wird im CCL Lab am Campus Eilenburger Straße durchgeführt.
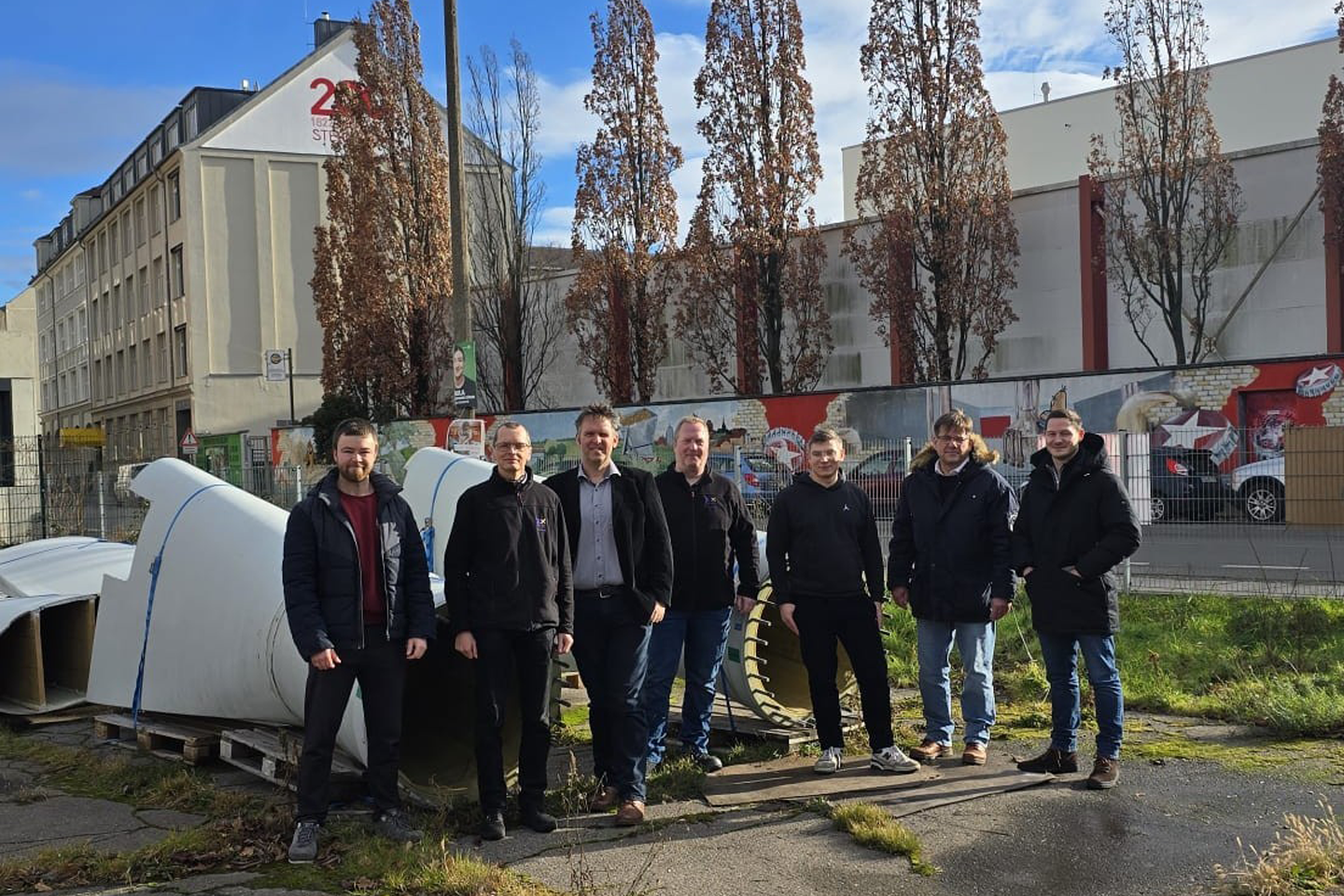

„Wir haben uns in dem Validierungsvorhaben dafür entschieden, Segmente aus ausgedienten Rotorblättern als Schwimmkörper für schwimmende Solaranlagen, sogenannte Floating PV’s, zu verwenden. Diese Repurpose-Lösung verspricht erhebliches Potenzial, da erwartet wird, die Materialkosten für Schwimmkörper zu reduzieren und gleichzeitig einen Beitrag zur Ressourcenschonung zu leisten. Wir werden in dem Vorhaben einen großskaligen Demonstrator für eine Floating PV entwickeln und unter Realbedingungen erproben.“, sagt Philipp Johst, Leiter des neu gegründeten Composite Circularity Labs an der HTWK Leipzig.
Das Validierungsvorhaben legt auch den Grundstein für die mögliche Gründung eines Start-ups, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Produkten aus wiederverwendeten Rotorblattmaterialien spezialisiert. „In enger Zusammenarbeit mit der Gründungsberatung ‚Startbahn 13‘ der HTWK werden wir in den kommenden 18 Monaten prüfen, ob unsere Repurpose-Lösungen in eine Ausgründung überführt werden können. Ein Schwerpunkt ist dabei die Bewertung der Marktchancen für Floating PV mit Schwimmkörpern aus umfunktionieren Rotorblattsegmenten. Ziel ist die Validierung einer nachhaltigen und wirtschaftlich attraktiven Lösung, die langfristig in großem Maßstab eingesetzt werden kann.“, fasst Projektleiter Prof. Robert Böhm die Idee des Validierungsvorhabens zusammen. Das Vorhaben läuft bis Mai 2026 und wird im Composite Circularity Lab am Campus Eilenburger Straße durchgeführt.
Mit dem Beginn des Jahres 2025 strukturiert sich die Forschungsgruppe Leichtbau an der HTWK neu und gründet das „Composite Circularity Lab“ (CCL) und das „Advanced Materials and Structures Lab" (AMSL). In den zwei Labs werden die Kernkompetenzen der Professur für Leichtbau fortan stärker gebündelt, um Synergien zwischen laufenden Forschungsprojekten noch besser nutzen zu können. „Die beiden Themen ‚Kreislaufwirtschaft mit Verbundwerkstoffen‘ und ‚Advanced Materials‘ haben sich in den letzten Jahren als äußerst relevante Forschungsthemen erwiesen, die sowohl in der Innovationsstrategie des Freistaats Sachsen, in der FONA-Strategie der Bundesregierung und in der Advanced Materials Initiative 2030 der EU-Kommission verankert sind. Diese Themen werden daher in der Zukunft auch an der HTWK eine noch größere Rolle als bislang spielen.“, erklärt Prof. Robert Böhm.
Das neue „Composite Circularity Lab” widmet sich in Forschung, Lehre und Transfer der Entwicklung kreislaufgerechter Ingenieurlösungen für den Faserverbundsektor. „Für verschiedene Industriezweige wie die Windenergiebranche, die Luft- und Raumfahrt und die Automobilindustrie entwickeln wir Kreislauf-Strategien, die aus den Elementen Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose und Recycling bestehen. In verschiedenen Forschungsprojekten fokussieren wir uns insbesondere auf die Eigenschaftsbewertung der Faserverbundstrukturen und die Umsetzung von Repurpose-Demonstrator-Lösungen, die wir in serienfähige Anwendungen überführen wollen.“, erläutert Forschungsgruppenleiter Philipp Johst die Ziele des CCL.

Team des Composite Circularity Labs (v.l.n.r.): Jannick Schneider, Moritz Bühl, Marten Tschatschanidse, Dimitrij Seibert, Andrej Fehler und Philipp Johst (es fehlt Pamela Voigt) © HTWK Leipzig

Team des Advanced Materials and Structures Lab (v.l.n.r.): Dmytro Rassokhin, Livia M. Doß, Sandy Schubert, Gregor Jesse, Willi Zschiebsch, Michael Kucher, Laura Schiele, Rafael Schelkow, Antonia Kirchner & Davood Peyrow Hedayati © HTWK Leipzig
Das „Advanced Materials and Structures Lab“ zielt darauf ab, durch die Anwendung virtueller Simulationsverfahren, neuer Entwurfs- und Optimierungsmethoden und einem tiefgreifenden Werkstoffverständnis Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde mit verbesserten Eigenschaften, Multifunktionalität, innovativer Verarbeitbarkeit und hoher Vielseitigkeit zu entwickeln. „Unsere Forschung umfasst ein breites Spektrum von der grundlegenden Entwicklung neuer Werkstoffe wie etwa strukturtragende Energiespeicher-Materialien oder nanopartikelverstärkte Kunststoffe über FEM-basierte Auslegungstools bis hin zur anwendungsorientierten Forschung für potenzielle Industriezweige wie Verkehr, Luft- und Raumfahrt, Energie und Umwelt, Bauwesen, Medizintechnik sowie Elektrotechnik.“, so Dr. Michael Kucher, Forschungsgruppenleiter des AMSL.
Warum mitmachen?
Die besten Bilder werden von einer Jury ausgewählt und ausgezeichnet. Außerdem werden die Gewinnerbilder im Forschungsmagazin Einblicke 2026 veröffentlicht und bei hochschulinternen Veranstaltungen präsentiert.
Wie einreichen?
Senden Sie Ihr digitales Bild bis zum 20. September 2025 an einblicke[at]htwk-leipzig.de.
Bewerbungskriterien:
- Das Bild muss druckfähig sein (Auflösung mind. 300 dpi).
- Pro Person kann nur ein Bild eingereicht werden.
- Ein aussagekräftiger Titel und eine kurze Beschreibung der Forschungsperspektive sind erforderlich.
- Urheberinnen und Urheber des Bildes müssen angegeben werden.
- Bild und Beschreibung bitte in separaten Dateien einreichen.
Wer kann teilnehmen?
Teilnahmeberechtigt sind alle Forschenden der HTWK Leipzig und des FTZ Leipzig – darunter Masterstudierende mit Forschungsinteresse, Promovierende, Postdocs, wissenschaftliche Mitarbeitende und Professorinnen und Professoren.
Inspiration gefällig?
Lassen Sie sich von den Gewinnerbildern der vergangenen Jahre inspirieren – authentische Einblicke in die Vielfalt der Forschung an der HTWK Leipzig! Nutzen Sie auch gern die Möglichkeit, sich Technik beim Referat Forschung auszuleihen. Katrin Haase und Dr. Franziska Böhl statten Sie gern mit Spiegelreflexkameras, Lichttechnik, Stativen und dergleichen aus. Sprechen Sie uns dazu gern an.
Beim Wissenschaftskino am 10. Dezember 2024 im Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig zeigte Reuther den rund 180 anwesenden kleinen und großen Besucherinnen und Besuchern noch drei weitere Actionszenen aus James-Bond-Filmen und analysierte gemeinsam mit dem Publikum die Physik dahinter. „Ich möchte vor allem jungen Menschen zeigen, dass Physik weder schwer noch unverständlich ist“, so Reuther.
James-Bond-Szenen auch in den Vorlesungen
Über Actionszenen aus James-Bond-Filmen spricht Reuther sonst in seinen Vorlesungen an der HTWK Leipzig: Dort ist er unter anderem für die physikalischen Grundlagen-Veranstaltungen angehender Ingenieurinnen und Ingenieure im ersten und zweiten Studiensemester verantwortlich. Mit Beispielen aus Filmen lockert er den theoretischen Unterricht auf und macht ihn anschaulicher. Für seine erstklassige Didaktik wurde Reuther 2023 mit dem ersten Lehrpreis der Hochschule ausgezeichnet.
Inspiriert wurde Reuther von Metin Tolan: Dieser war bis 2021 Professor für Experimentelle Physik an der Technischen Universität Dortmund und ist aktuell Präsident der Universität Göttingen. Er schrieb verschiedene Bücher wie „Die Star Trek Physik“ oder „Titanic. Mit Physik in den Untergang“. Beispiele aus James-Bond-Filmen habe Reuther gewählt, weil dieser bekannter sei als der zu seiner Studienzeit beliebte MacGyver, der sich ähnlich wie Bond in der 1980/90er-Jahre Actionserie mit besonderen Erfindungen aus brenzligen Situationen rettete.
Auflösungen durch Formeln und Berechnungen
Interessante Gadgets und andere Hilfsmittel werden für James Bond von „Q“ entwickelt. Q ist der Leiter der fiktiven Forschungs- und Entwicklungsabteilung des britischen Geheimdienstes. Zum Lieblingsgadget wurde beispielsweise einmal die Magnetuhr gewählt, die im Film „Live and Let Die“ von 1973 zu sehen ist. In der gezeigten Szene konnte Bond damit den Kaffeelöffel seines Chefs entwenden und einer Frau den Reißverschluss eines Kleides öffnen. In brenzligen Situationen sollte die Uhr hingegen Kugeln aus einigen Metern Entfernung umlenken.
Solche Effekte, wie sie bei der Uhr mit Elektromagneten laut Film möglich sein sollen, verglich Reuther auch mit Beispielen aus dem Alltag, wie sie jeder kennt. In jenem Fall mit einem MRT, bei dem ebenfalls ein starkes Magnetfeld wirkt. Während Q bei seinen Erfindungen tief in die Trickkiste griff, zeigte HTWK-Professor Reuther beim Wissenschaftskino mit Formeln und Berechnungen auf, wie so manche Actionszene wirklich hätte ablaufen müssen.
Unter den Anwesenden sorgten die Szenen und die dazugehörigen Erklärungen immer wieder für Staunen, gerade weil manche besonders spektakuläre Stuntszenen rein physikalisch möglich wären. Und es gab viele Nachfragen, vor allem von eingefleischten James-Bond-Fans, die Detailfragen hatten.
Zum Abschluss ging Reuther der wohl berühmtesten Frage auf den Grund: Warum trinkt James Bond seinen Wodka-Martini geschüttelt und nicht gerührt? Auch hier sorgten zusätzliche Informationen für ein Raunen im Saal: Wer hätte gedacht, dass diese Frage sogar in einem wissenschaftlichen Paper ausführlich besprochen worden ist? Demnach werden durch das Schütteln im Wodka-Martini die freien, gesundheitsschädlichen Radikale besser gebunden, als wenn man den Cocktail rührt. Eine weitere, nicht ganz ernst gemeinte Erklärung liefert der Paranuss-Effekt, auch Müsli-Effekt genannt. Durch das Schütteln wandern die großen Geschmacksmoleküle nach oben, wohingegen die kleinen Alkoholmoleküle sich unten im Glas ansammeln. Oder Kurzum: Für James Bond bedeutet das, dass er den Geschmack genießen kann, ohne betrunken zu werden, denn immerhin muss ein Geheimagent wie er stets einsatzbereit im Kampf gegen das Böse sein.
Nächste Veranstaltung
Die nächste Vorführung vom Wissenschaftskino, der Film- und Diskussionsreihe der Leipziger Wissenschaftseinrichtungen, findet am 4. Februar 2025 statt: Im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig wird der Film „Die Unerhörten“ gezeigt. Der Eintritt ist frei.
„Für uns als Gastgeber war es eine tolle Möglichkeit, unser im August 2024 eröffnetes HolzBauForschungsZentrum einem hochkarätigen Publikum zu präsentieren. Uns verbindet die Maxime, gute Ideen in die reale Umsetzung zu bringen. In unserem Fall sind es neue Konzepte für materialsparende Lösungen im Holzbau, die wir in unserer einzigartigen Forschungs- und Fertigungshalle im Maßstab 1:1 auf Anwendungsniveau entwickeln und erproben können“, so Prof. Alexander Stahr, wissenschaftlicher Leiter des HolzBauForschungsZentrums an der HTWK Leipzig sowie seit mehr als zehn Jahren Kopf und Vordenker der Forschungsgruppe FLEX, einem interdisziplinären Team, mit dem er Strategien für individualisiert-automatisierte Fertigungskonzepte im Holzbau entwickelt.
Nach einer Begrüßung und Keynote über das HolzBauForschungsZentrum durch Stahr folgte eine Keynote zu einem weiteren zukunftsträchtigen Werkstoff, dem Carbonbeton: Prof. Birgit Beckmann von der Technischen Universität Dresden sprach über „Wege zum ressourceneffizienten und nachhaltigen Bauen mit Beton“ und stellte neben Vorteilen des Werkstoffs unter anderem den Cube in Dresden vor.
Unter den StartUps auch r3leaf mit dem HTWK-Absolventen Tore Waldhausen
Deutlich weiter am Anfang standen die drei jungen Unternehmerinnen und Unternehmer, die in kurzen Pitches ihre Geschäftsmodelle aus den Bereichen innovative Bau- und Werkstoffe sowie Digitalisierungslösungen in der Immobilienbranche den Anwesenden vorstellten. Darunter auch Tore Waldhausen, der Gründer von r3leaf. Waldhausen studierte einst an der HTWK Leipzig Bauingenieurwesen und gründeten dann u.a. mit Unterstützung von Startbahn 13, der HTWK-Gründungsberatung, sein Start-up: r3leaf will die Transformation der Baubranche beschleunigen, indem es Unternehmen Klimarisiken für Gebäude und Grundstücke automatisiert zur Verfügung stellen, um regenerative Maßnahmen abzuleiten. Auch er sucht Investoren.
Tipps von Business Angels und aus dem Sport
Zwei der anwesenden Investoren berichteten anschließend über ihre Erfahrungen als Business Angels. Als Tipps gaben Frank Steinert, Geschäftsführer der BV Beteiligungsgesellschaft mbH in Chemnitz, sowie Cornelia Jahnel, Unternehmerin und Vorstandsmitglied bei BAM!, den jungen StartUps folgendes mit auf den Weg: sein Netzwerk zu erweitern, den passenden Business Angel suchen – denn neben Geld könne dieser mit Expertise und Netzwerken helfen –, sowie sich die Neugier am Thema zu bewahren und auch mal ins kalte Wasser zu springen.
Die Brücke von der Wirtschaft zum Sport schlug am Ende Karsten Günther, der Geschäftsführer vom SC DHfK e.V. in Leipzig, der sich mit dem Leipziger Handball-Coach Runar Sigtryggsson einig war: „Es braucht ein gutes Team, um erfolgreich zu sein.“ Ähnlich wie in einem Forschungsprojekt oder einem Unternehmen hat auch im Sport jeder seine Aufgabe und trägt entscheidend zum Gelingen bei. Am Ende müsse es passen, egal ob im Sport oder bei Ausgründungen.
Prof. Dr. Faouzi Derbel, Prorektor für Forschung und Nachhaltigkeit der HTWK Leipzig: „Es ist nicht selbstverständlich, von der DFG eine Förderung zu erhalten. Die Bedingungen sind hart und der Wettbewerb enorm – daher ist eine Förderzusage zugleich eine Würdigung herausragender Projektideen. Deshalb freut es mich sehr, dass die Hochschule sich über die Jahre hinweg einen Spitzenplatz unter den DFG-geförderten HAW erarbeiten konnte. Nichtsdestotrotz kann das nicht darüber hinwegtäuschen, dass die insgesamt von HAW eingeworbenen DFG-Mittel gering sind und unter einem Prozent des gesamten DFG-Etats liegen.“
Was sind Drittmittel?
Forschung an Hochschulen finanziert sich neben einer staatlichen Grundfinanzierung vor allem aus eingeworbenen Drittmitteln. Gerade HAW finanzieren ihre Forschungen überdurchschnittlich durch Drittmittel. Diese werden von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in wettbewerblich geleiteten Verfahren eingeworben. Die zweitgrößte Drittmittelgeberin ist hierzulande die DFG, die Forschung projektbasiert fördert. Der Förderungsetat der DFG besteht zu zwei Dritteln aus Steuergeldern vom Bund und zu einem Drittel aus Steuergeldern der Länder. In den vergangenen Jahren nahm der Anteil der Drittmittel an der Hochschulfinanzierung gegenüber den Grundmitteln deutlich zu, wobei der Anteil der Wirtschaft als Geldgeber für Forschung sprunghaft zurückging.
DFG-Projekte an der HTWK Leipzig
Die Förderungen der DFG kommen nicht von ungefähr: Die HTWK Leipzig profiliert sich seit Jahren strategisch, dabei entstanden unter anderem Kompetenzzentren zur Werkstoffforschung (Leipzig Center of Materials Science) und zur Drucktechnik (Smart Surfaces), für die die Hochschule DFG-Gelder eingeworben hat, die teilweise erst im nächsten Berichtszeitraum erfasst werden. Die aktuellen Zahlen erschienen im DFG-Förderatlas und beziehen sich auf 2020 bis 2022. Der Förderatlas 2027 wird den Berichtszeitraum 2023 bis 2025 erfassen.
Die 1,6 Millionen Euro der DFG finanzierten an der HTWK Leipzig in den Jahren 2020 bis 2022 Einzelprojekte, Forschungsgruppen und Forschungsgeräte aus den Themengebieten Bauwesen und Architektur, Informatik und Elektrotechnik sowie Geisteswissenschaften. Dank einer Großgeräte-Finanzierung erhielt die Hochschule ein neues Rasterelektronenmikroskop sowie einen Computertomographen. Die Großgeräte helfen Forschenden am Leipzig Center of Materials Science, ressourcenschonende und nachhaltige Bau- und Werkstoffe zu entwickeln.
Eine Auswahl von DFG-geförderten Projekten an der HTWK Leipzig finden Sie hier:
Theater:Raum
Architektur und Raum für die Aufführungskünste: Häuser und Orte künstlerisch-kultureller Mischnutzungen – Zugänglichkeit, Programmierung und erweiterte Szenografien
Prof. Dr. Annette Menting, Laufzeit: 01.10.2016 – 28.02.2025
Schadenslokalisation
Schadenslokalisation und Zustandsidentifikation auf Basis unscharfer Beobachtungen mit H-unendlich-Schätz- und Subspace-Methoden im Lebenszyklus instationärer, mechanischer Strukturen unter ambienter Anregung
Prof. Dr. Armin Lenzen, Laufzeit: seit 2017
Die Villa von Sette Bassi in Rom
Bauhistorische Neubearbeitung und Rekonstruktion einer Villenanlage in Rom
Prof. Dr. Ulrich Weferling, Laufzeit: 01.05.2020 – 31.10.2024
DINOBBIO
Nachhaltige Nutzung der brasilianischen Artenvielfalt - Nutzung verknüpfter Daten zum Auffinden von Naturstoffen
Prof. Dr. Thomas Riechert, Laufzeit: 01.10.2021 – 30.09.2024
Großgeräte für Werkstoffforschung
Großgeräte für mehrdimensionale und skalenübergreifende Werkstoffforschung
Prof. Dr. Robert Böhm, Laufzeit: 01.01.2022 – 31.12.2026
Hundert Plus
Verbundprojekt zum DFG-Schwerpunktprogramm „Hundert plus – Verlängerung der Lebensdauer komplexer Baustrukturen durch intelligente Digitalisierung“ (SPP 2388)
Prof. Dr. Armin Lenzen, Laufzeit: 01.09.2022 – 31.08.2025
MF Discharge
Entladungen bei Gleichspannung mit überlagerter mittelfrequenter Spannung an Grenzflächen in Hochspannungs-Isoliersystemen
Prof. Dr. Carsten Leu, Laufzeit: 01.06.2021 – 31.08.2023
Professorale Karrieremuster der Frühen Neuzeit
Entwicklung einer wissenschaftlichen Methode zur Forschung auf online verfügbaren und verteilten Forschungsdatenbanken der Universitätsgeschichte
Prof. Dr. Thomas Riechert, 2016 – 2023
Jenseits von Ost und West
Die Geokommunikation der „Heiligen Landschaften“ (Sacred Landscapes) von „Duklja“ und „Raška“ durch Raum und Zeit (11.-14. Jahrhundert)
Prof. Dr. Johannes Tripps, Laufzeit 2020 - 2024
Polymerfasern
Vorhersage und Modellierung des Einflusses thermischer und optischer Behandlungsschritte auf die strukturellen Eigenschaften optischer Polymerfasern
Prof. Dr. Christian-Alexander Bunge; Prof. Dr. Thomas Gries, Laufzeit: 2018 - 2020
Spektrale Methoden
Unsicherheits- und Sensitivitätsanalyse von gekoppelten Systemen bestehend aus einer elektromagnetischen Feldanordnung und einem dynamischen nichtlinearen Netzwerk mittels spektraler Methoden
Dr. Konstantin Weise, Laufzeit: 2016 - 2024
Antakya
Archäologische Untersuchungen im Stadtgebiet von Antakya (Antiochia am Orontes), Abschlußarbeiten und Auswertung
Prof. Dr. Ulrich Weferling, Laufzeit: 2014 - 2024
Wie schafft es James Bond beispielsweise, im freien Fall ein Flugzeug einzuholen? Wie kann er einen Widersacher über einen Lastenkran verfolgen? Oder: Stirbt ein Mensch überhaupt zwingend, wenn sein Körper ganz und gar mit Gold bemalt ist? Und kann eine Uhr mit einem Elektromagneten wirklich eine Kugel abhalten?
Mit HTWK-Professor Guido Reuther
Beantworten kann solche Fragen Guido Reuther: Er ist Professor für Angewandte Physik an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig). Dort ist er unter anderem für die physikalischen Grundlagen-Veranstaltungen angehender Ingenieurinnen und Ingenieure im ersten und zweiten Studiensemester verantwortlich. Für seine erstklassige Didaktik wurde er 2023 mit dem ersten Lehrpreis der Hochschule ausgezeichnet.
Beim Wissenschaftskino stellt er Filmstunts aus James-Bond-Filmen auf den physikalischen Prüfstand. Unter anderem wird er gemeinsam mit dem Publikum Szenen aus den Filmen „Casino Royale“ (2006), „Golden Eye“ (1995), „Live and Let Die“ (1973) oder „Goldfinger“ (1964) besprechen. Und natürlich geht er der wohl berühmtesten Frage auf den Grund: Warum trinkt James Bond seinen Wodka-Martini geschüttelt und nicht gerührt?
Format: Wissenschaftskino mit Filmausschnitten und Gespräch
Wann: Dienstag, 10. Dezember 2024, ab 19 Uhr
Wo: Zeitgeschichtliches Forum Leipzig, Grimmaische Straße 6, 04109 Leipzig
Eintritt: frei
Angewandte Holzbauforschung
Die HTWK-Forschungsgruppe FLEX um Prof. Dr. Alexander Stahr zeigt am Gemeinschaftsstand mit dem Bauunternehmen Bennert einen zweigeschossigen Pavillon, dessen Dach auf der Konstruktionsidee von Friedrich Zollinger basiert. Die Forschenden interpretierten das Dachkonzept in mehrjähriger Forschungsarbeit neu und gestalteten daraus mittels moderner Technologie in Daten- und Holzverarbeitung eine Spitztonne. Zu sehen ist das Exponat in Halle 2, Stand K 20. Den neuesten Meilenstein der Forschungsgruppe – das im August 2024 eröffnete HolzBauForschungsZentrum Leipzig – stellt Stahr am 7. November ab 10:30 Uhr im Vortrag beim denkmal-Forum vor.
Ebenso zeigt die interdisziplinäre Forschungsgruppe FLEX Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte zur Anwendung von Augmented Reality in der Montagehalle, zum Feuchte-Monitoring im Holzbau sowie zu modularen, hölzernen E-Tankstellen.
Architektur-Ausstellung
„Ostmoderne Stadt.Ansichten Leipzig“, eine Architekturausstellung der HTWK Leipzig, ist am Stand der Abteilung Denkmalpflege der Stadt Leipzig zu sehen. Prof. Dr. Annette Menting, Professorin für Architekturgeschichte, kuratierte die Gegenüberstellungen von Ansichtskarten aus den 1960er bis 1980erJahren mit aktuellen Fotografien von Louis Volkmann und von Architekturstudierenden der HTWK Leipzig. Sie zeigen Orte, Räume, Architekturen und Momente des Stadtlebens. Die Arbeiten schließen an das Instagram-Projekt „karten.der.moderne“ des Fotografen Louis Volkmann an und sind in Halle 2, Stand K 42, zu sehen. Täglich 11 Uhr laden die Abteilung Denkmalpflege, der Architektur-Studiengang der HTWK Leipzig sowie die Leipziger Denkmalstiftung zu geführten Ausstellungsrundgängen ein.
Erstmals ausgelobter Award für Ausstellungsgestaltung
Auf der Museumsfachmesse MUTEC präsentieren sich die Museologiestudiengänge der HTWK Leipzig in Halle 4, Stand B 25 unter Leitung von Prof. Dr. Gisela Weiß. Die Professorin für Bildung und Vermittlung im Museum moderiert die Podiumsdiskussion „Was geben wir weiter? – Erwartungen von und an Museen“, veranstaltet vom Arbeitskreis Bildung & Vermittlung im Deutschen Museumsbund und von der HTWK Leipzig. Weiß ist zugleich Jurymitglied beim erstmals ausgelobten MUTEC-Award. Der Preis würdigt herausragende Leistungen in der Gestaltung von Ausstellungen in Museen und ist mit 500 Euro dotiert. Die drei prämierten Projekte werden auf der MUTEC ausgestellt.
Impressionen von der denkmal und MUTEC 2024
Aufgaben und Ziele des IGL
Das neue Institut für Geotechnik widmet sich den Bereichen Lehre und Weiterbildung, Forschung und Entwicklung sowie Dienstleitung und Transfer. „Perspektivisch werden in unserer Forschung unter anderem umweltgeotechnische und klimarelevante Fragen eine noch größere Rolle spielen als bisher“, erklärt Institutsgründer Thiele. Die neuen geotechnischen Herausforderungen als Folge des Klimawandels sollen im Fokus des Instituts stehen. Der Baugrund bietet großes Potenzial als Energiespeicher. Diese Option wollen die Institutsmitarbeitenden im Zuge der energetischen Transformation wissenschaftlich untersuchen und in wirtschaftliche Anwendungen überführen.
Konkret arbeiten die Institutsangehörigen im Aufgabenfeld Forschung und Entwicklung an zukunftsorientierten übergeordneten Schwerpunktthemen wie klimawandelbedingte Effekte in der Geotechnik, Digitalisierung und KI-basierte Dateninterpretation sowie Kreislaufwirtschaft und Umweltgeotechnik. Im Bereich Dienstleistung und Transfer forcieren sie die Übertragung ihrer Forschungsergebnisse in die Praxis. Der Transfer erfolgt unter anderem durch Veranstaltungen wie das Geotechnikseminar mit regelmäßigen Vorträgen. In Lehre und Praxis geht es den Mitarbeitenden um eine innovative Wissensvermittlung – sowohl für Studierende als auch für Praxispartner. Beispielsweise wollen sie ein überregional zugängliches Schulungszentrum für Bodenmechanik aufbauen, um die geotechnische Lehre zeitgemäß weiterzuentwickeln.
Forschungsstrukturen stärken
Zum Institut für Geotechnik gehören die neu umgebauten Labor- und Bürogebäude am Forschungscampus in der Eilenburger Straße. Dort befindet sich auch das im September 2023 fertiggestellte GeoTechnikum: Dieses besteht aus dem bodenmechanischen Forschungslabor, Modellständen, zwei geotechnischen Versuchshallen mit Bodenprüfgruben für Versuche im Realmaßstab sowie Werkstätten.
„Nach der Fertigstellung des GeoTechnikums und der Umstrukturierung der Lehr- und Forschungsbereiche zur Geotechnik ist die Gründung eines eigenen Instituts ein logischer Schritt, um die Kompetenzen in Lehre und Forschung nun weiter zu bündeln und die Strukturen zukunftsfähig zu stärken“, so Prof. Faouzi Derbel, Prorektor für Forschung und Nachhaltigkeit an der HTWK Leipzig.
Nachwuchs fördern
Die Institutsleitung wird von Dr.-Ing. Alexander Knut und Bénédict Löwe unterstützt, die bisher die geotechnischen Arbeitsgruppen organisatorisch geleitet haben. Durch die gemeinsame Übernahme von Leitungsfunktionen am Institut eröffnen sich für den Nachwuchs neue Möglichkeiten zur weiteren Qualifizierung, wie beispielsweise die Übernahme von Scientific Co-Chairs beim 1. Leipziger Geotechniksymposium (LeiGS2025), das im kommenden Jahr stattfinden wird.
Hintergrund zu den beiden Geotechnikprofessuren
Der Bauingenieur Thiele entwickelte seit seiner Berufung an die HTWK Leipzig im Jahr 2006 den Forschungsbereich Geotechnik an der Hochschule. Angefangen mit Forschungsprojekten zu Walzenentwicklung und Verdichtungskontrolle entstanden schließlich mit der Zeit zwei eigenständige Arbeitsgruppen: G² Gruppe Geotechnik befasst sich vorwiegend mit Baugrund und Erkundung, während sich GEONETIC vor allem der Geomesstechnik und Simulationen widmet.
Komplettiert wird das neue Institut für Geotechnik durch Prof. Said Al-Akel: Im Jahr 2013 wurde er an die HTWK Leipzig auf die Professur für Grundbau, Bodenmechanik und Umweltgeotechnik berufen. Sein Forschungsschwerpunkt liegt in den Bereichen der Deponietechnik, Altlastensicherung sowie der Entwicklung von Energiespeichersystemen im Baugrund. In diese Forschungsprojekte bindet er aktiv auch den akademischen Nachwuchs im Rahmen von Abschlussarbeiten ein.
Im Bereich Geotechnik finden an der Hochschule oder mit Beteiligung von HTWK-Forschenden jährlich folgende Veranstaltungen statt:
- Geotechnikseminar: Pro Semester werden fünf Fachvorträge aus der Bauwirtschaft gehalten. Eine Teilnahme ist in Präsenz und online möglich.
- Erdbaufachtagung: Hier tauschen sich Expertinnen und Experten aus Bauplanung, Ausführung und Forschung aus. Die nächste, nunmehr 20. Tagung findet am 13. und 14. Februar 2025 in Leipzig statt und widmet sich dem Fachthema „Erdbau im Wandel“.
- Deponiefachtagung: Die Leipziger Deponiefachtagung dient als Podium zur Diskussion technischer und rechtlicher Fragestellungen des Deponiebaus, der Kreislauf- und Abfallwirtschaft sowie des Umweltschutzes. Der nächste Termin ist am 11. und 12. März 2025 in Leipzig.
- 1. Leipziger Geotechnik-Symposium (LeiGS): Die neue Plattform lädt zum interdisziplinären Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis zu jährlich wechselnden fachübergreifenden geotechnischen Schwerpunktthemen ein. Das 1. LeiGS findet am 13. und 14. November 2025 statt und widmet sich dem Themenfeld „Geotechnik und Klimawandel“.
Austausch mit dem KIST
Bereits am Dienstag, den 24. September 2024, trafen sich HTWK-Forschende mit jenen vom KIST für weitere Kennenlerngespräche. Mit dabei war unter anderem Prof. Faouzi Derbel, Prorektor für Forschung und Nachhaltigkeit an der HTWK Leipzig. Er verdeutlichte in seiner Begrüßung, welch wichtiger Schwerpunkt Advanced Materials mittlerweile an der Hochschule sind, und verdeutlichte, dass er sich auf die kommende, vertiefende Zusammenarbeit freut. Ähnlich sieht es auch Dr. Won-Kook Choi, neuer Generaldirektor am KIST, der mit den Sondierungsgesprächen nun den Grundstein für eine tiefere Zusammenarbeit gelegt sieht.
Neben gemeinsamer Forschung umfasst die Kooperation auch gegenseitige Studien- und Forschungsaufenthalte. Dr. Sung-Soo Kim vom KIST berichte beim Treffen über seinen einmonatigen Forschungsaufenthalt in der sächsischen Messestadt: „Es war eine unvergessliche Erfahrung.“ Er hofft, dass sowohl andere Forschende als auch Studierende künftig ähnliche Erfahrungen sammeln können. Am KIST gibt es dafür auch ein globales Mobilitätsprogramm, das Kim leitet. Zwischen dem KIST und der HTWK Leipzig war sein Aufenthalt nun auch bereits der vierte Aufenthalt von Gastforschenden bzw. HTWK-Studierenden. Je zwei Forschende aus Südkorea und Deutschland konnten bereits zwischen ein und vier Monaten an den jeweils anderen Einrichtungen arbeiten.
Größere, europäische Zusammenarbeit geplant
Die Forschenden von der HTWK Leipzig und dem KIST planen außerdem mit weiteren Partnern aus Europa, die Bewerbung um größere, europäische Forschungsprojekte: Um gemeinsame Interessen und Forschungsschwerpunkte zu identifizieren, folgte am Mittwoch, den 25. September 2024, ein eintägiger Workshop mit potenziellen Partnern aus Griechenland, Italien, Schottland und Portugal. „Wir haben in dem Workshop interessante Ideen entwickelt, unter anderem die Weiterführung unserer Forschungsthemen zur Kreislaufwirtschaft mit Verbundwerkstoffen, zum nachhaltigen Bauen und zur Entwicklung von Strukturbatterien. An der HTWK Leipzig haben wir dazu Kompetenzen aus den laufenden Projekten EuReComp, iClimabuilt, ElVis und Printcap aufgebaut. Die Partner aus Korea bringen hier ein starkes Grundlagenwissen mit ein und werden außerdem interessierte koreanische Industriepartner in das Netzwerk einbringen“, so Böhm. Bis eine Einreichung eines Projektantrages möglich ist, sei aber noch viel zu tun. Daher werden die Vernetzungsarbeiten im Jahr 2025 fortgesetzt, bis schließlich im Herbst 2025 die Einreichung der Projekte geplant ist. „Ein derartiges Leuchtturmprojekt würde die Sichtbarkeit der HTWK Leipzig in dem breiten Themenfeld ‚Advanced Materials‘ weiter steigern.“
Hintergrund: Zum Leipzig Center of Material Science und zur Kooperation mit KIST
Um die Expertise in der Werkstoffforschung an der HTWK Leipzig dauerhaft zu stärken und interdisziplinäre Forschungsprojekte auf dem Gebiet der Materialforschung anzustoßen, gründeten die vier Professoren Christian Wagner (Professur für Baustofflehre), Paul Rosemann (Professur für Werkstofftechnik), Robert Böhm (Professur für Leichtbau mit Verbundwerkstoffen) und Klaus Holschemacher (Professur für Stahlbetonbau) 2021 das „Leipzig Center of Material Science“. Gestärkt wurde die Werkstoffforschung unter anderem durch eine Millionenförderung seitens der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für zwei neue Großforschungsgeräte. Innerhalb der DFG-Initiative „Unterstützung der Internationalisierung von Forschung an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (UDIF-HAW)“, die sich explizit an HAW wendet, die sich für internationale Forschungskooperationen interessieren oder ausbauen möchten, entstand schließlich die Kooperation mit dem KIST.
Mitorganisator Prof. Dr. Björn Höhlig, Professor für Nachhaltiges Bauen/Bauen im Bestand an der HTWK Leipzig: „Die Fachtagung bietet den Teilnehmenden eine großartige Gelegenheit, sich mit aktuellen Themen des nachhaltigen Bauens und Sanierens auseinanderzusetzen und mit Fachleuten auszutauschen.“ David Pfennig, Vorsitzender des Vereins Bildungswerk für nachhaltige Entwicklung, zu dem der Naturbau-Campus gehört, hebt vor allem das Lernen aus regionalen Ansätzen hervor: „Wir zeigen auf, welche Wege bereits gegangen sind und welche Lösungsansätze aktuell in der Region entstehen. Wir wollen klären, welche Mittel und Rahmenbedingungen Bauauftraggebenden und Planenden aktuell zur Verfügung stehen und welche Hürden es zu überwinden gibt“, so Pfennig weiter.
Bauen und Sanieren mit Stroh, Lehm und Holz

Fachleute aus Forschung, Baupraxis und Verwaltung referieren zu den Themen Gebäudezertifizierung, energetische Bestandssanierung, Entwicklung im Lehmbau, die neue Holzbaurichtlinie, Altbausanierung, Energiebilanz in Sachen Holzbau, der Wald als Ressource sowie Naturbaustoffe in Theorie und Praxis. Auch Impulse zum Bauen mit Stroh, Lehm und Holz, vielfältige Ansätze und Methoden des nachhaltigen Planens und Bauens sowie zu diversen Förderprogrammen werden aufgezeigt. Am Nachmittag stehen das Netzwerken an Thementischen und die Fachausstellung im Vordergrund. Mit dabei sind Initiativen, Vereine und Herstellende, die das breite Angebot an alternativen Baustoffen und deren Potenziale darstellen.
Die Teilnahme an der Fachkonferenz ist kostenpflichtig, während die Fachausstellung und Diskussion am Nachmittag kostenfrei zugänglich sind. Die Teilnahmegebühr für die Fachkonferenz beträgt 120 Euro, ab dem 2. Teilnehmenden 90 Euro und ermäßigt 30 Euro. Unterstützende zahlen 200 Euro. Die Veranstaltung wird durch das Bundesmodellvorhaben „Unternehmen Revier“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. Sie findet an der HTWK Leipzig im Trefftz‐Bau/Haus A in der Gustav‐Freytag‐Straße 43-45, 04277 Leipzig statt.
Eine Anmeldung ist bis zum 20. September 2024 unter naturbau-campus.de/seminar möglich.
Anwesend war auch ein interdisziplinäres Forschungsteam der HTWK Leipzig. Für sie sind die Carbonbetontage eine der wichtigsten Veranstaltungen zu diesem Thema, denn hier tauschen sich Fachleute aus Bauunternehmen, Planungsbüros, Zulieferer- und Softwarefirmen sowie Bauherren und Forschende aus – also Fachleute entlang der gesamten Wertschöpfungskette. „Hier bei den Carbonbetontagen informieren wir uns über aktuelle Forschungsthemen, vernetzen uns und sprechen über neue Ideen und Kooperationen. Zudem ist es nicht leicht, eines der wichtigsten Themen zu Klima- und Naturschutz in der heutigen Zeit richtig zu kommunizieren und die Beteiligten zum Handeln zu bewegen. Dabei ist gerade die Reduzierung von Treibhausgasemissionen, beispielsweise durch Carbonbeton, essentiell für unseren Planeten, wie es auch Prof. Manfred Curbach von der TU Dresden in seiner beeindruckenden und zum Nachdenken anregenden Eingangsrede sagte“, so Dr. Alexander Kahnt, Leiter der Forschungsgruppe Nachhaltiges Bauen am Institut für Betonbau (IfB) der HTWK Leipzig. Gemeinsam mit seinen IfB-Kollegen Lukas Steffen und Dr. Steffen Rittner besuchte er die Fachtagung.
HTWK Leipzig mit einem Vortrag zum Thema Recycling
Bei der Tagung konnten die Teilnehmenden in rund 30 Vorträgen über neue Ideen und Ergebnisse staunen oder sich an Diskussionen beteiligen. Die Vorträge befassten sich mit Themen wie neue Richtlinien, Fertigteilbau, Brückenbau, Recycling, Hochbau, Instandsetzung sowie Innovationen und ein Blick in die Zukunft wurde ebenfalls gewährt, indem beispielsweise auf Herstellungsverfahren der nächsten Generation aufmerksam gemacht wurde. Ergänzt wurde die Fachtagung durch eine Ausstellung und Posterpräsentationen.
Im Themenpanel „Recycling II“ hielt IfB-Mitarbeiter Dr. Steffen Rittner einen Vortrag zu „Anwendung | Einsatz von recycelten Kohlenstofffasern und rezyklierter Gesteinskörnung für die Carbonbetonbauweise“. „Die stoffliche Verwertung produktionsbedingter faserhaltiger Abfälle ist entscheidend für die Ressourceneffizienz von carbonfaserverstärkten Kunststoffen. Der Werterhalt von recycelten Carbonfasern spielt dabei eine zentrale Rolle“, erklärt Rittner. Aktuell werden recycelte Carbonfasern vor allem als Füllstoffe in Spritzguss- oder Vliesstoffen genutzt. Ähnlich ist es mit mineralischen Abfällen aus dem Abbruch von Gebäuden: nur ein Prozent wird im Betonhochbau wiederverwendet. „Die Forschungsarbeiten vom Institut für Betonbau und von Partnern schaffen wichtige Grundlagen für den Einsatz von recycelten Carbonfasern und recycelten Gesteinskörnungen im Carbonbetonbau, um natürliche Ressourcen zu schonen und bestehende Abfallströme zu nutzen“, fasst Rittner zusammen. Künftig könnten diese beispielsweise in Verstärkungsgarnen, Bewehrungen und in Beton sowie schlussendlich in Bauteilen aus diesen aufbereiteten Materialien zum Einsatz kommen.
Hintergrund zur Carbonbetonforschung an der HTWK Leipzig
An der HTWK Leipzig forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit vielen Jahren zum innovativen Baustoff Carbonbeton. Im Gegensatz zu Stahlbeton ist Carbonbeton ressourcen-, material-, energie- und CO₂-sparender und hat damit das Potenzial, das Bauwesen zu revolutionieren und einen wesentlichen Beitrag zu Klima- und Umweltschutz zu liefern.
Damit der nachhaltigere und klimafreundlichere Baustoff schneller in die Anwendung überführt werden kann, wurde beispielsweise im September 2022 an der HTWK Leipzig das Carbonbetontechnikum Deutschland errichtet – eine einzigartige Modellfabrik in Leipzig-Engelsdorf zur Carbonbetonforschung. Hier entwickelt Massivbauprofessor Klaus Holschemacher mit seinen Mitarbeitern vom IfB automatisierte Fertigungsverfahren für Carbonbetonbauteile und arbeitet mit Kolleginnen und Kollegen anderer Institute unter anderem an der Multifunktionalität und Funktionsintegration von Bauteilen aus Carbonbeton, so zum Beispiel am Einbringen von Elektronik in diese Bauteile.
Hintergrund zum Verein C³ – Carbon Concrete Composite e. V.
Der Verein C³ – Carbon Concrete Composite e. V. geht auf das mehrfach ausgezeichnete interdisziplinäre großangelegte Forschungsprojekt C³ - Carbon Concrete Composite zurück. Es war eines von zehn geförderten Projekten im Programm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung „Zwanzig20 – Partnerschaft für Innovation“ der Initiative „Unternehmen der Region“. Darin arbeitende die HTWK Leipzig sowie mehr als 125 Partner aus Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Vereinen unter Federführung der TU Dresden mit dem Institut für Massivbau gemeinsam an der Entwicklung und Markteinführung von Carbonbeton.
Geothermie, Photovoltaik, Smart Grids
Das Team von Anke Bucher, HTWK-Professorin für angewandte Mechanik, stellte das Forschungsprojekt „EasyQuart-Plus“ vor, bei dem eine energieeffiziente Auslegung und Planung von Geothermie-Anlagen erarbeitet wird. Mathias Rudolph, Professor für Industrielle Messtechnik, gab Einblicke in seine Forschungsprojekte zur Agri-Photovoltaik, zur Solarzellenvermessung und zur organischen Photovoltaik. Das Team von Faouzi Derbel, Professor für Smart Diagnostik und Online Monitoring und Prorektor für Forschung und Nachhaltigkeit der HTWK Leipzig, zeigte, an welchen Themen das Institut für elektrische Energietechnik derzeit arbeitet – von Smart Grids bis zur Entpersonalisierung für Energie-Management-Systeme.
Auch die Start-ups AdaptIng und R3leaf, die von der HTWK-Gründungsberatung Startbahn 13 unterstützt wurden oder werden, stellten sich am Stand vor.
Das Veranstaltungsbüro der Fakultät Informatik und Medien unterstützte auch in diesem Jahr organisatorisch sowie gestalterisch. Medientechnik-Studierende produzierten Einspieler, die auf der Bühne gezeigt wurden und die medialen Präsentationen im Hauptforum unterstrichen.
Fotoimpressionen 13. Ostdeutsches Energieforum
Automatisierung – Herkunft des Holzes – modulares Bauen
Mit zwölf Vorträgen erwartet die Holzbau-Community das bisher umfangreichste interdisziplinäre Programm. Unter anderem geben Prof. Mike Sieder, Technische Universität Braunschweig, und Felix Schmidt-Kleespies, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Promovend der HTWK Leipzig, Einblicke in die Holzbauforschung und stellen eine vollständig automatisiert herstellbare, bionisch inspirierte Wandbauweise vor, die ohne metallische Verbindungsmittel und Folien auskommt. Forstwirt Andreas Padberg geht der Frage nach, wo das zu verbauende Holz herkommt und zeigt am Beispiel des Forstbezirks Leipzig, wie der Wald der Zukunft aussehen kann. Der in Leipzig ansässige Bauphysiker Daniel Kehl präsentiert unter der Überschrift „Feuchterobustes Bauen in Holz“ praxistaugliche Lösungen für dauerhaft zuverlässige Decken- und Wandaufbauten. Thomas Hübner gibt Einblicke in die industrielle Fertigung von Raumzellen und geht der Frage nach, welche Potenziale die Modulbauweise modernster Prägung für Architekten und Bauherren bietet.
Prof. Faouzi Derbel, Prorektor für Forschung und Nachhaltigkeit der HTWK Leipzig, betont in seiner Begrüßungsrede: „Der Holzbau ist ein wichtiger Pfeiler für das Bauen der Zukunft. Bauen wir jedoch in den derzeit benötigten Größenordnungen und mit den bewährten Techniken mit Holz, kostet das unsere Wälder. Daher forscht unsere Hochschule intensiv an digitalen Prozessen, die den Holzbau effizienter gestalten können.“
Netzwerken
In der begleitenden Fachausstellung erhalten Teilnehmende die Gelegenheit zum Austausch mit engagierten Marktpartnern und können die Pausen zum Netzwerken nutzen. Eingebettet in die zwei Kongresstage ist außerdem der Netzwerkabend in den Leipziger „Felix Suiten“, der einen stimmungsvollen Rahmen für den Austausch bietet und mit Blick auf den zentralen Augustusplatz ein abendliches Highlight der EASTWOOD sein wird.
Holzwege-Ausstellung
Teil der EASTWOOD ist die Ausstellung „,Holzwege‘ – Zukunftsfähiger Holzbau in Mitteldeutschland“. In der Hochschulbibliothek der HTWK Leipzig werden beispielhafte Projekte in und aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gezeigt. Initiiert vom Arbeitskreis Nachhaltiges Planen, Bauen und Zertifizieren der Architektenkammer Sachsen und in Zusammenarbeit mit den Architektenkammern von Sachsen-Anhalt und Thüringen soll die Ausstellung den Holzbau in Mitteldeutschland darstellen.
Forschungsgruppe FLEX der HTWK Leipzig
Die Forschungsgruppe FLEX ist ein interdisziplinäres Team aus Architektur, Bau- und Wirtschaftsingenieurwesen sowie studentischen Mitarbeitenden unter der Leitung von Alexander Stahr, HTWK-Professor für Tragwerkslehre. FLEX forscht zur digitalen Verknüpfung von Planungs- und Ausführungsprozessen, mit dem Ziel, Ressourcen in Architektur und Bautechnik effizienter zu nutzen. Die Forschungsgruppe ist zudem Mitglied im 2018 gestarteten Transferverbund Saxony⁵ der fünf sächsischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften und im deutschlandweit agierenden „Informationsverein Holz“, außerdem ist sie Mitglied der „International Association of Shell and Spatial Structures“ (IASS) und des internationalen Forschungsnetzwerks „Robots in Architecture“ (RiA).
HolzBauForschungsZentrum
Im August 2024 feierte die Forschungsgruppe passend zum zehnjährigen Bestehen die Einweihung des HolzBauForschungsZentrums der HTWK Leipzig in Leipzig-Engelsdorf. In der rund 1.100 Quadratmeter großen Halle können die Forschenden im Realmaßstab neue Konstruktionslösungen auf Anwendungsniveau entwickeln und erproben. Das interdisziplinäre Team entwickelt dort fortan Strategien für individualisiert-automatisierte Fertigungskonzepte im Holzbau.
Programm EASTWOOD 2024 vor Ort und digital
Das vollständige Programm sowie die Tickets finden Sie unter eastwood-leipzig.de.
Für die Präsenzveranstaltung sind aktuell noch Restkarten unter eastwood-leipzig.de/anmeldung erhältlich. Das komplette Kongressprogramm ist auch per Livestream als kompakte Digitalveranstaltung online erlebbar. Die Architekten- sowie Ingenieurkammern von Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Berlin-Brandenburg erkennen eine Teilnahme am Holzbau-Event als Fortbildungsveranstaltung an.

Mit dem erfolgreichen Kick-off des Projekts „SoKoRoMed – Soft und Kontinuums Robotik in der Medizin“ ist am 03. September 2024 der Startschuss für ein gemeinsames Forschungsvorhaben der Fakultät Ingenieurwissenschaften der HTWK Leipzig und des Innovation Center Computer Assisted Surgery (ICCAS) der Universität Leipzig gefallen. Ziel des Projekts ist die Entwicklung weicher robotischer Endeffektoren für den klinischen Einsatz, wobei die gebündelten Ressourcen und Kompetenzen beider Kooperationspartner hier eine zentrale Rolle spielen.
Für SoKoRoMed leistet die HTWK durch ihre Expertise in Regelungstechnik (Prof. Jäkel), Simulation (Prof. Schönfelder) und Materialwissenschaft (Prof. Böhm) einen entscheidenden Beitrag in der technischen Umsetzung der Systemkomponenten. Das ICCAS (Projektleitung Prof. Thomas Neumuth) fokussiert sich auf die klinischen Anforderungen, den Systementwurf und die klinische Integration.
Das Forschungsvorhaben zielt auf die Etablierung definierter Prozessketten für die Herstellung patienten- bzw. anwendungsspezifischer weicher Endeffektoren ab. Dazu werden neue Werkstoffe, geeignete Berechnungsverfahren und eine angepasste 3D-Drucktechnik entwickelt. Die Soft- und Kontinuums-Roboter werden im Projekt konzipiert und in Kombination mit konventioneller Medizin- und Robotertechnik in einem klinischen Gesamtdemonstrator für spezifische Interventionen zur Anwendung gebracht. Über die Definition von Standards zur System- und Funktionsbeschreibung soll die klinische Translation erleichtert werden.
Soft- und Kontinuums-Roboter (SKR) aus weichen Polymeren erlauben eine erhöhte Beweglichkeit und Manövrierfähigkeit sowie eine verbesserte Präzision bei komplexen chirurgischen Eingriffen. Obwohl bereits verschiedene Ansätze und Steuerungsmethoden für solche SKR erforscht wurden, befinden sich aufgrund zahlreicher Herausforderungen nur wenige der bestehenden Konzepte in klinischer Translation. Ein wesentlicher Grund dafür ist der hohe Zeitaufwand bei der Herstellung weicher Roboter, bedingt durch die Vielzahl an Teilarbeitsschritten. Zudem stellen der Entwurf, die Simulation und die korrekte Ansteuerung dieser Systeme weitere wissenschaftliche Herausforderungen dar.
Das Projekt wird bis Sommer 2026 von der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank (SAB) gefördert und von der Europäischen Union kofinanziert.
Zur Spezialausgabe heißt es von Moderator Jack Pop: „Es war nur eine Frage der Zeit: Das meist genutzte Buzzword aktueller Technik-Hypes und Zukunftsdebatten hat endlich auch uns eingeholt und deshalb laden zu einer ‚KI-Spezialausgabe‘ ein.“ Zur Vorbereitung auf die Show hat sich Jack Pop durch Musikprogramme, Video-Editoren, Protein-Software und viele weitere KI-Apps geklickt, um ein unterhaltsames Best-of der aktuellen Trends zusammenzustellen.
Hingucker: die HTWK Robots, ein Roboterhund und ein vernetzter Krankenwagen
Bereits ab 19 Uhr gibt es im Foyer des Kupfersaals verschiedene Mitmachstationen: An einer zeigen die Fußballroboter der HTWK Leipzig ihr fußballerisches Können. Sie dribbeln Bälle, schießen Tore und stehen für Fotos mit Gästen bereits. Per Greenscreen können sich Gäste direkt ins Spielfeld der HTWK Robots projizieren lassen und so ein digitales Andenken mitnehmen.
Außerdem wird „Spot“, der bekannteste Roboterhund der Welt, umherlaufen und vor dem Saal steht ein mobiles Labor in Form eines realen Krankenwagens. Dieser beinhaltet die Medizintechnik von morgen. Das Innovationszentrum ICCAS von der medizinischen Fakultät der Universität Leipzig präsentiert darin, wie miteinander vernetzte Medizingeräte zu einer besseren Patientenversorgung führen können.
Vorträge auf der Bühne
In Ergänzung zu den Einblicken in den Krankenwagen erklärt ICCAS-Forscher Tobias Pabst bei einem Bühnenvortrag während der Show, wie die Vernetzung genau funktioniert und was ohne sie derzeit alles schiefläuft. Denn Medizingeräte sind zwar oft hoch entwickelte und ausgereifte Produkte, aber noch kommunizieren sie nicht gut miteinander. Um jedoch große Datenmengen aufzuzeichnen und auszutauschen, sind gut vernetzte Systeme notwendig.
Was der Unterschied zwischen Schlagworten wie KI, Machine Learning oder Large Language Model (ChatGPT) ist, erklärt Martin Clauß. Er ist Informatiker und arbeitet am Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie in Bonn im Bereich IT-Sicherheit. Mit seiner Arbeitsgruppe entwickelt er unter anderem Verfahren und Werkzeuge, um Schwachstellen in Soft- und Firmware aufzuspüren.
Zur Abrundung der Show gibt es wie gewohnt Musik – und diesmal zusätzlich auch im Live-Experiment: Wie es klingt, wenn Jack Pop mit sechs miteinander verbundeneren Akkuschraubern Gitarre spielt, können die Gäste selbst beurteilen. Tickets sind über die Website der Show erhältlich.
Hintergrund zum „Circus of Science“

Der „Circus of Science“ ist eine Infotainment-Show in Leipzig. Sie bietet „Hirnfutter für Nerds und Noobs, für Galileo-Gucker und Gar-nichts-Checker, für Akademiker und Schulabbrecher“, wie es auf der Webseite heißt. Dafür lässt Moderator Jack Pop Forschung mit Fakten, Gags und Live-Musik lebendig werden, damit das bunt gemischte Publikum am Ende mit Erkenntnisgewinnen nach Hause geht. Zusätzlich treten jeweils mehrere Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler auf, die in Form eines Science Slams ihr Fachgebiet vortragen. Dabei können sie alle Hilfsmittel nutzen: von Power-Point-Präsentationen bis hin zu Live-Experimenten. Das Publikum kann ebenfalls aktiv sein: Vor Showbeginn dürfen sie vor Ort an verschiedenen Stationen selbst Experimente ausprobieren und während der Show können sie an interaktiven Quizrunden teilnehmen, bei denen es manchmal ganz schön wild, aber stets lehrreich zugeht.
Auch wenn die Veranstaltung für externe Gäste bereits ausverkauft ist, dürfen sich weiterhin Medienvertretende anmelden, um die aktuellen Entwicklungen zum Thema Fassadenbau vor Ort oder auch digital mitzuverfolgen, denn die Veranstaltung findet erstmals hybrid statt.
Photovoltaik, künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit
Beim Leipziger Fassadentag werden elf Referentinnen und Referenten aus Forschung, Bauaufsicht und Praxis sprechen und unterschiedliche Themen des Fassadenbaus beleuchten. Dabei stehen in diesem Jahr Photovoltaik, künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit im Fokus.
Mit Monica Rossi-Schwarzenbeck, Professorin für konstruktives Entwerfen und energieeffizientes Bauen, und Alexander Stahr, Professor für Tragwerkslehre, geben zwei Forschende der HTWK Leipzig Einblicke in ihre aktuellen Projekte. Während Rossi-Schwarzenbeck den Fokus darauf richtet, wie Fassaden Gebäude besonders gut kühlen und damit den zunehmenden Hitzeperioden gerecht werden können, erforschte Stahr gemeinsam mit einem Forschungskonsortium im Projekt „FutureFacade“, wie funktional integrierte Fassadenpaneele aus Stahl Sonnenenergie für Warmwasser und Wärme nutzen können – Stichwort Solarthermie.
Weiterbilden und vernetzen
Ziel des Leipziger Fassadentags als anerkannte Fort- und Weiterbildungsveranstaltung ist es, Fachleute und Interessierte des Fassadenbaus zusammenzubringen. Neben Vorträgen und Fachausstellungen von 17 Unternehmen des Fassadenbaus steht das Netzwerken im Mittelpunkt. Im Vorfeld können Interessierte die Brandprüfstelle der MFPA Leipzig besuchen und Prüfstände zur Beurteilung des Brandverhaltens von Baustoffen und Bauprodukten, insbesondere von Fassadenelementen, besichtigen. Während des Fassadentags ist außerdem das BIM-Labor der HTWK Leipzig für Besuchende geöffnet. Dort können Gäste des Leipziger Fassadentags, Studierende und Lehrende unterschiedliche virtuelle Technologien kennenlernen und anwenden.
Programm
- 09:00 Uhr Begrüßung und Moderation, Dr. Mathias Reuschel, Vorsitzender der S&P Gruppe
- 09:15 Uhr Bauordnungsrechtliche Anforderungen an normalentflammbare Außenwandbekleidungen nach § 28 Absatz 5 MBO, Dr. Hans-Alexander Biegholdt / Konstanze Schenk, Landesdirektion Sachsen | Landesstelle für Bautechnik
- 09:45 Uhr: WDVS kann nachhaltig?!, Antje Proft, S&P Gruppe
- 10:10 Uhr: FutureFacade – Prototypische Entwicklung solarthermisch aktiver Fassadenpaneele aus Stahl, Prof. Alexander Stahr, HTWK Leipzig
- 11:30 Uhr: Photovoltaik an der Gebäudehülle – Alles klar?!, Thomas Kühnert, IFBT GmbH
- 12:00 Uhr: Brandschutztechnische Beurteilung von Fassadenkonstruktionen mit PV-Modulen – Bauordnungsrechtliche Einordnung und mögliche Nachweisführung. Michael Juknat, MFPA Leipzig GmbH / Jan Riemesch-Speer, DIBt
- 13:50 Uhr: Geheimnisvolle Unterwasserwelten – Aquatische Ökosysteme, Unterwasservulkane und Bauwerksprüfungen In situ, Dr. Thomas Pohl, GEO-DIVE
- 14:20 Uhr: Möglichkeiten des nachhaltigen Bauens unter der neuen EU-BauPVO, Brigitte Strathmann, DIBt
- 15:20 Uhr: Evaporative cooling. Wie eine Fassade den Komfort im Innen- und Außenbereich verbessern kann, Prof. Monica Rossi-Schwarzenbeck, HTWK Leipzig
- 15:50 Uhr: Die Fassade in Zeiten von Nachhaltigkeit und künstlicher Intelligenz“ sowie „Kriterien der Jury des Deutschen Fassadenpreises des FVHF 2024, Prof. Jan R. Krause, Office for architectural thinking Berlin
- 16:20 Uhr: Schlusswort und Ende der Veranstaltung
Erste Station der Wanderausstellung ist die Hochschulbibliothek der HTWK Leipzig, wo sie vom 9. September bis 1. Oktober 2024 zu sehen sein wird. Zur Vernissage am 9. September, 17:00 Uhr und zur Finissage am 1. Oktober, 17:00 Uhr sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten der Bibliothek besichtigt werden.
Holzbau in Mitteldeutschland stärken
Initiiert vom Arbeitskreis Nachhaltiges Planen, Bauen und Zertifizieren der Architektenkammer Sachsen und in Zusammenarbeit mit den Architektenkammern von Sachsen-Anhalt und Thüringen soll die Ausstellung den Holzbau in unserer Region voranbringen. Bis Ende April 2024 konnten Architektinnen und Architekten ihre Projekte einreichen. Aus den 72 Einreichungen wählte eine fünfköpfige Jury 38 zukunftsweisende Arbeiten aus. Dabei berücksichtige die Jury sowohl Projekte, die von Büros aus den drei genannten Bundesländern eingereicht als auch welche, die in den drei Ländern realisiert wurden.
Jedes der ausgewählten Projekte wird in der Wanderausstellung auf einem Roll-up in deutscher und englischer Sprache präsentiert. Zu den Veranstaltungen an den verschiedenen Ausstellungsorten sind zudem die jeweiligen Architekten und Architektinnen eingeladen, um ihre Projekte vorzustellen.
Als weitere Ausstellungsorte sind unter anderem Magdeburg, Halle/Saale, FH Erfurt, Bauhaus-Universität Weimar, ZfBK Sachsen in Dresden, Chemnitz, FH Aachen, Dresdens Partnerstadt Coventry, TH Prag, Universität Wien in Planung. Sie haben einen Ausstellungsort für uns? Nehmen Sie gern Kontakt auf unter dresden@aksachsen.org.
Weitere Informationen zur Ausstellung: aksachsen.org/aktuelles/ausstellungen
Branchentreff EASTWOOD 2024
Die Ausstellung wird auch beim Holzbau-Branchentreff EASTWOOD zu sehen sein. Am 19. und 20. September 2024 treffen sich Fachleute aus Bauplanung, Architektur, Wohnungswirtschaft und Forschung an der HTWK Leipzig und erörtern die Chancen des Holzbaus in Zeiten von Digitalisierung und zunehmender Kreislaufwirtschaft. Das Format wird bereits zum vierten Mal von der RM Rudolf Müller Medien sowie der Forschungsgruppe FLEX an der HTWK Leipzig veranstaltet. In der Schnittmenge von Holzbaupraxis und angewandter Forschung versteht sich EASTWOOD als kommunikative Plattform für den Austausch und Wissenstransfer. Mit zwölf Vorträgen erwartet die Holzbau-Community das bisher umfangreichste interdisziplinäre Programm.
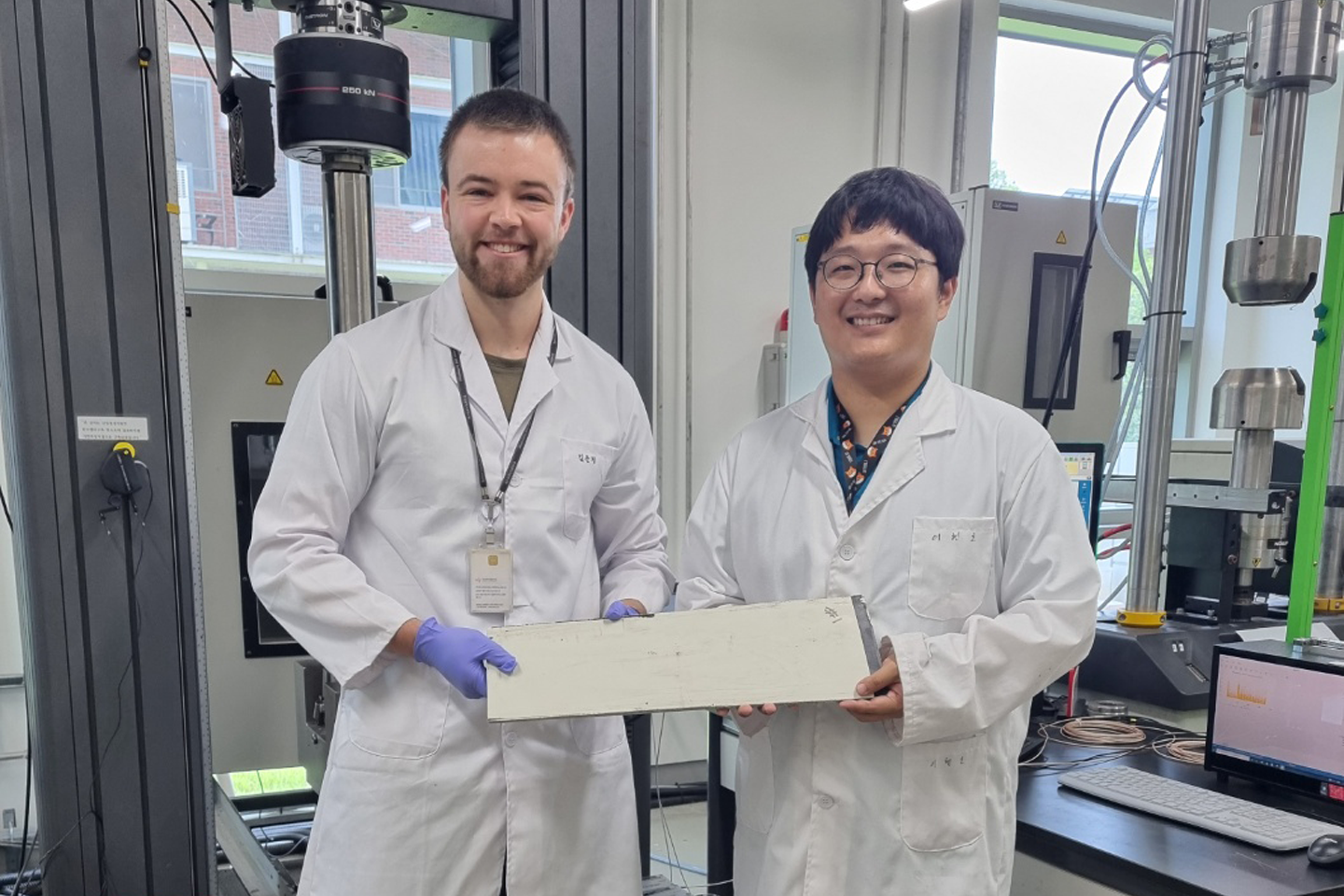
Dank der langjährigen Kooperation zwischen dem Institute of Advanced Composite Materials KIST (Jeonbuk, Südkorea) und der Fakultät Ingenieurwissenschaften der HTWK Leipzig konnte Philipp Johst einen zweimonatigen Forschungsaufenthalt realisieren und vertieft zum Rotorblatt-Recycling forschen.
Philipp Johst verbrachte von Juli bis August 2024 mit der koreanischen Forschungsgruppe von Dr. Wonjin Na vom KIST in Jeonbuk, um weiter an Methoden zur strukturellen Wiederverwendung ausgedienter Faserverbundkomponenten aus Rotorblattstrukturen zu forschen, die mit den Inhalten des EuReComp-Projekts in Verbindung stehen. Der Forschungsaufenthalt wurde vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) finanziell unterstützt.
Philipp Johst ist Teil der Forschungsgruppe um Prof. Böhm. In einer aktuellen Publikation konnte die Forschungsgruppe aufzeigen, wo und in welchen Mengen ausgediente Faserverbundmaterialien von ausgedienten Rotorblattstrukturen zu erwarten sind. Bemerkenswert ist, dass diese Materialien weniger aufgrund stark verschlechterter mechanischer Eigenschaften, sondern vielmehr aus wirtschaftlichen Gründen ausgemustert werden. Untersuchungen haben gezeigt, dass sich die Materialien noch in einem sehr guten mechanischen Zustand befinden, was die Forschungsgruppe dazu veranlasst, sich verstärkt mit der Wiederverwendung dieser Materialien zu beschäftigen.
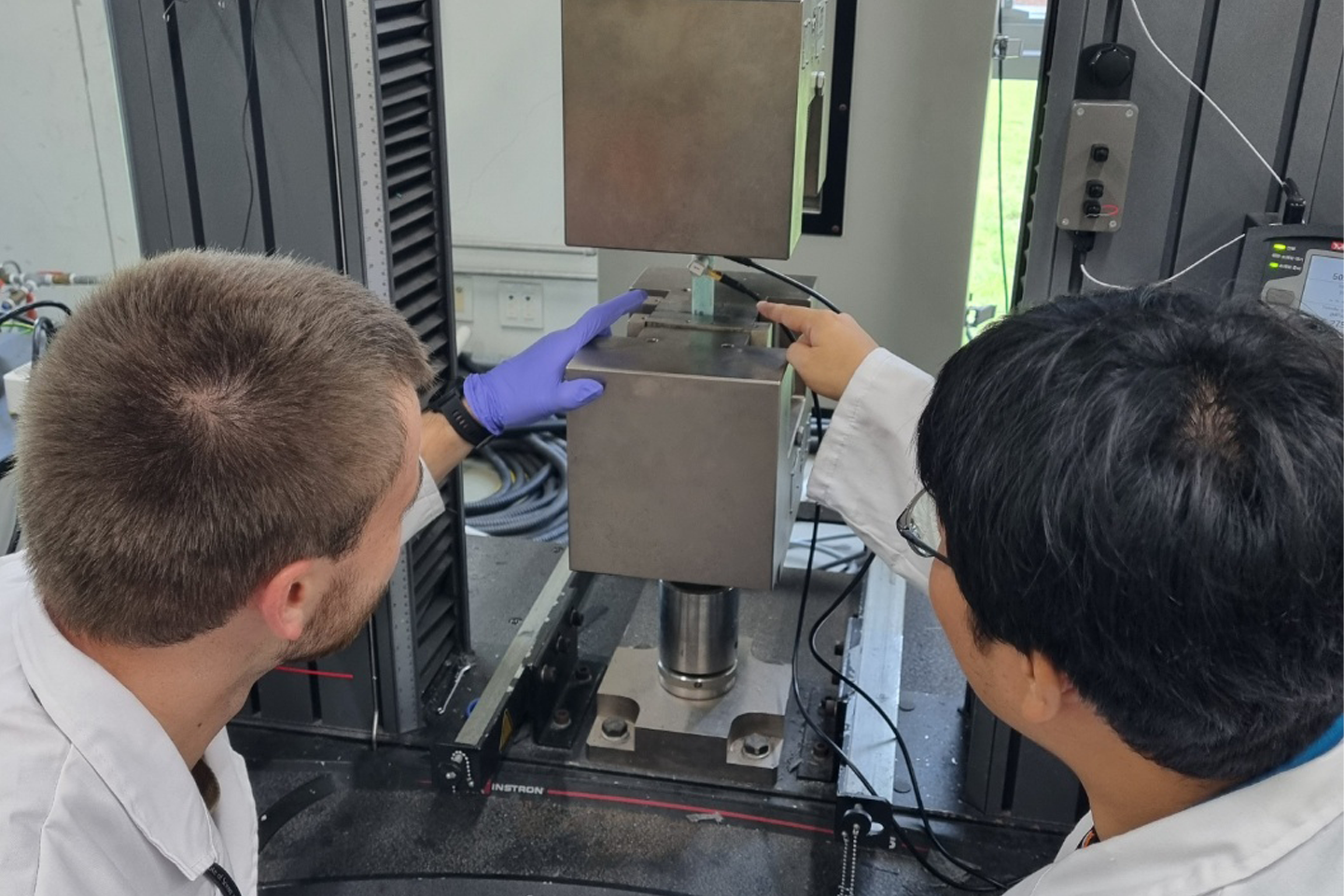
Während des Forschungsaufenthalts am KIST konnte Philipp Johst in Zusammenarbeit mit Dr. Na experimentelle Untersuchungen an Proben von ausgedienten Rotorblattstrukturen durchführen, um Methoden des Structural Health Monitoring für wiederverwendete Rotorblattkomponenten zu etablieren. Mit Hilfe der hervorragend ausgestatteten gerätetechnischen Infrastruktur des KIST-Instituts konnten vielversprechende Daten gewonnen werden. Derzeit arbeiten die an den Untersuchungen Beteiligten an einer Publikation, um die Ergebnisse der Wissenschaftscommunity zugänglich zu machen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung eines Indikators zur Zustandsbeschreibung, der eine sichere Wiederverwendung und Weiternutzung von Rotorblattkomponenten ermöglichen soll. Zukünftige Arbeiten zielen darauf ab, die durchgeführten Experimente auf eine prototypische Ebene zu skalieren. Hierzu wird die Initiierung eines gemeinsamen Forschungsprojekts zwischen dem KIST und der HTWK angestrebt, um die weiteren Schritte zu koordinieren und eine Finanzierung sicherzustellen.
Darüber hinaus konnte Philipp Johst in der Forschungsgruppe von Dr. Na Experimente für andere laufende Forschungsprojekte an der HTWK Leipzig initiieren und durchführen. Diese Untersuchungen dienen nicht nur als Grundlage für aktuelle Arbeiten, sondern stellen auch wertvolle Vorarbeiten für zukünftige mögliche Projekte dar.

Neben der sehr guten wissenschaftlichen Zusammenarbeit werden Philipp Johst die Erlebnisse insbesondere durch die ausgesprochene Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft der südkoreanischen Kollegeninnen und Kollegen des KIST langfristig positiv in Erinnerung bleiben.
Der traditionsreiche Baustoff Holz gilt als Hoffnungsträger, um die Baubranche nachhaltiger zu machen. In seiner Herstellung und Nutzung ist er klimafreundlicher als andere Baustoffe, wie zum Beispiel der energie- und ressourcenintensive Stahlbeton. Die Nachfrage nach Holzbauten wächst – mit zunehmender Geschwindigkeit – seit Jahren an. Um die steigenden Bedarfe und Bedürfnisse der Nutzer zu decken, braucht es neue Konstruktionslösungen.
Fünf Millionen Euro Fördermittel

Der sächsische Staatsminister für Wissenschaft Sebastian Gemkow sprach bei der Eröffnung über gemeinsame Forschung zwischen Hochschulen und regionaler Wirtschaft mit Investitionen zur Zukunftssicherung des Freistaates. „Das HolzBauForschungsZentrum wurde bewusst an diesem Standort errichtet, um Innovationen schnell in den Markt zu bekommen. Es wird Sachsen als Standort einer innovativen Holzbauforschung mit deutschlandweiter Strahlkraft neu definieren.“ Gemeinsam mit seinem Kollegen Thomas Schmidt, Sachsens Staatsminister für Regionalentwicklung, übergab er der HTWK Leipzig vor Ort einen Zuwendungsbescheid über fünf Millionen Euro aus dem europäischen Just Transition Fund. Mit Hilfe der Förderung werden hochsensible, digital gesteuerte Fertigungsanlagen angeschafft und so der Wissens- und Technologietransfer von der angewandten Wissenschaft in die Praxis beschleunigt. Dazu Staatsminister Thomas Schmidt: „Die Investition ist eingebettet in die Holzbauinitiative des Freistaats Sachsen. Holz ist ausreichend hier in Sachsen vorhanden. Unser Ziel ist es, diesen nachwachsenden und nachhaltigen Baustoff als starken Treiber eines nachhaltigen Bauens zu verankern.“
Forschungs- und Fertigungshalle für den Holzbau der Zukunft
Über die Fertigstellung der Halle und die Fördermittelzusage freute sich Prof. Alexander Stahr ganz besonders: Der wissenschaftliche Leiter des HolzBauForschungsZentrums an der HTWK Leipzig ist seit zehn Jahren Kopf und Vordenker der Forschungsgruppe FLEX und entwickelt gemeinsam mit einem interdisziplinären Team Strategien für individualisiert-automatisierte Fertigungskonzepte im Holzbau. In der rund 1.100 Quadratmeter großen Halle können er und sein Team diese nun realmaßstäblich prototypisch testen. Parametrische digitale Modelle spielen dabei eine zentrale Rolle, um alle Schritte vom Entwurf über die Planung bis zur effizienten Vorfertigung sowie Logistik und Montage auf der Baustelle lückenlos zu vernetzen. So soll das Bauen mit Holz perspektivisch deutlich mehr von den positiven Effekten der Digitalisierung profitieren. „Technologisches Alleinstellungsmerkmal der Modellfabrik ist die enorm platzsparende Vorfertigungsstrategie, über die wir zentral in der Halle jeden Punkt einzeln ansteuern und damit Bauteile aus Holz in Maßanfertigung herstellen können“, so Stahr. Solch individualisierte Holzbauelemente entstehen nach dem an der HTWK Leipzig entwickelten Konzept der „Smart Fixed Position Fabrication“. Bei diesem Verfahren bleibt das Werkstück – im Gegensatz zur Fließbandproduktion – an einer Position und sowohl das Material als auch die Werkzeuge werden mittels Robotertechnik zum Bauelement bzw. zum Montagetisch gebracht.
Innovationsfeld und Antrieb für die regionale Wirtschaft
Dr. Mathias Reuschel, Gesellschafter der MFPA Leipzig GmbH und Gründungsmitglied des Fördervereins HolzBauForschungsZentrum Leipzig e.V.: „Auf der Grundlage unserer Kooperationsverträge ist die MFPA eingebettet im regionalen Firmencluster, mit dem IFBT und der S&P Gruppe, mit der Universität Leipzig, der HTWK Leipzig, aber auch der Berufsakademie eng verbunden. Es freut uns, mit einem weiteren Investment nach dem Carbonbetontechnikum, nun auch das HolzBauForschungsZentrum für die HTWK mit ermöglichen zu können. In dieser regionalen Gemeinsamkeit von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft ist es möglich, Innovationen in der Bauwirtschaft im internationalen Maßstab zu entwickeln und in die gesicherte Marktfähigkeit zügig zu überführen. Made in Sachsen für aktive Wertschöpfung und umweltbewusste Lebensräume.“
Burkhard Jung, Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, ergänzte zur hohen Bedeutung der Vernetzung der HTWK Leipzig mit der regionalen Wirtschaft: „Das HolzBauForschungsZentrum der HTWK Leipzig inmitten des InnovationsParks • Bautechnik • Leipzig/Sachsen ist ein Innovationsfeld für den modernen Holzbau und ein Antrieb für die regionale Wertschöpfung. Mit Vorfreude blicke ich auf spannende Bauprojekte, in denen die neuen Lösungen sowohl hier in der Stadt als auch in der Region sichtbar werden und schließlich eine Transformation des Gebäudebestands hin zu mehr Klimaneutralität vorantreiben.“
Prof. Dr. Mark Mietzner, Rektor der HTWK Leipzig: „Das HolzBauForschungsZentrum verkörpert unsere Vision der HTWK Leipzig als Ort des dynamischen Wissenstransfers. Eingebettet in unser stetig wachsendes Forschungs-Ökosystem, steht es exemplarisch für die Symbiose von Wissenschaft und Praxis. Seit 2019 haben wir als Hochschule für Angewandte Wissenschaften mit Projekten wie dem Carbonbetontechnikum, dem GeoTechnikum oder dem Smart Manufacturing Lab kontinuierlich unsere Schnittstellen zwischen Theorie und Anwendung ausgebaut. Dank der gemeinsamen Anstrengungen des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung, des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus, des Staatsbetriebs Immobilien- und Baumanagement (SIB) und der MFPA Leipzig GmbH ist das HolzBauForschungsZentrum weit mehr als nur ein Projekt der HTWK Leipzig – es ist ein Vorhaben, das von der gesamten Region getragen wird und in sie hineinwirkt.“
Oliver Gaber, Geschäftsführer des Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB), ergänzt: „Als öffentlicher Immobilien- und Bauherrenvertreter des Freistaates Sachsen schaffen wir Räume, welche die Entwicklung neuartiger Bauweisen und Fertigungsprinzipien ermöglichen, den Austausch von Ideen fördern, die Gemeinschaft stärken und nachhaltige Lösungen unterstützen. Die schnelle Umsetzung und die heutige Eröffnung der neuen Forschungs- und Fertigungshalle für die HTWK Leipzig unterstreichen diesen Anspruch.“
„Das Treffen war ein wichtiger Schritt zur Stärkung unserer Zusammenarbeit und zur Sicherung des Erfolgs unserer gemeinsamen Bemühungen um eine nachhaltige Entwicklung. Gemeinsam wollen wir die Qualität der Graduiertenausbildung verbessern, die Forschungskooperation ausbauen und eine starke Verbindung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft fördern“, sagt Thiel.
Im angestrebten Projekt zwischen der HTWK Leipzig und der USC soll es insbesondere um die Bereiche Bildung, wirtschaftliches Wachstum, nachhaltige Produktion, Industrie und Innovation sowie Geschlechtergerechtigkeit gehen. Kernstück des Projekts ist die Gründung eines Forschungs- und Transferzentrums an der USC, das als Plattform für den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft, Industrie und Gesellschaft dient.
Dies umfasst neben einer Förderung von Forschungskooperationen und der Vernetzung mit regionalen und internationalen Wirtschaftsverbänden auch die Verbesserung der Graduiertenausbildung. So sollen Studierende an der USC künftig besser auf die Arbeitswelt vorbereitet werden, indem ihnen während des Studiums praxisnahes Lernen ermöglicht wird, indem sie beispielsweise Laboreinrichtungen auch für Ausbildungszwecke nutzen können. Das Treffen im Juni 2024 stellte die Weichen für die zukünftige Forschungskooperation.
Im Frühjahr 2025 werden Forschende der USC an die HTWK Leipzig kommen, um weitere Schritte zu besprechen.
Hintergrund zum DAAD-Förderprogramm SDG-Partnerschaften
Um eine nachhaltige Partnerschaft zu etablieren, reichten die HTWK Leipzig und die USC einen Förderantrag beim Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) für eine SDG-Partnerschaft ein. Der DAAD fördert mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Hochschulpartnerschaften zu Themenbereichen, die sich den „Sustainable Development Goals“ der Vereinten Nationen, also den Zielen für nachhaltige Entwicklung, zuordnen lassen. Dies soll zu einer nachhaltigen Entwicklung und zum Aufbau leistungsfähiger und weltoffener Hochschulen in den Partnerländern und in Deutschland beitragen.
Von Wärmepumpen und kommunaler Wärmeplanung
Einen Einblick in die Vorteile und Funktionsweise von Wärmepumpen gab Dr. Martin Sabel vom Bundesverband Wärmepumpen im ersten Redebeitrag. Dabei wagte er auch einen Ausblick, inwieweit sich diese Art der Heizung zukünftig in Deutschland etablieren wird. Bis sich die Wärmepumpe als Standartheizung durchsetzt, werde es allerdings noch viele Jahre dauern, so Sabel.
Im Anschluss sprach Dr. Volker Bartsch, Leiter Politik, Klimastrategie und Energieeffizienz beim DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfachs) über den Ausbau des deutschlandweiten Klimanetzes. Er betonte die Wichtigkeit einer vollständigen Wärmeplanung in Städten. Darauf folgte ein Vortrag des Geschäftsführers der MITNETZ GAS/STROM, Dirk Sattur zum aktuellen Stand sowie den Herausforderungen bezüglich der Versorgungsnetze.
Fragen der Gäste beantworteten die Referenten im Anschluss in einer kurzen Diskussionsrunde. „Es gab viele Wortmeldungen und Fragen aus dem gut besuchten Publikum. Die Rückmeldungen waren durchweg positiv", fasste Moderator Prof. Dr. Robert Huhn von der HTWK Leipzig die Diskussion zusammen. In der Frühstückspause konnten alle Teilnehmenden die Ausstellungsstände der beteiligten Unternehmen wie zum Beispiel Bosch besuchen, die ihre wasserstofffähige Thermotechnik vorstellten.
Von Strom bis Gas
Wie im vergangenen Jahr übernahm Huhn auch die Moderation des Fachforums Gas. Dabei standen besonders die Themen der zukünftigen Wärmeversorgung von Städten, Transformationsstrategien großer Unternehmen oder der Einsatz von Wasserstoff und Biomethan im Vordergrund.
Zeitgleich leitete Prof. Dr. Faouzi Derbel, Prorektor Forschung der HTWK Leipzig, das parallellaufende Fachforum Strom. Hier zeigten die Referenten unter anderem, wie die Strom- und Wärmeversorgung großer Gebäude mithilfe von Solarmodulen und Hochtemperatur-Wärmepumpen gelingen kann, oder was Elektromobilität für Mehrfamilienhäuser bedeutet.
Nachhaltige Energieträger kombinieren
Die eine Lösung gebe es hierbei nicht, so die Referierenden. Vielversprechend für eine krisensichere und nachhaltige Energieversorgung sei vielmehr die Kombination aus nachhaltigen Energieträgern wie Wasserkraft, Wind, Photovoltaik, Wasserstoff, Biomethan oder die Wärmepumpen. Die Referenten aus der Wirtschaft forderten vereinfachte Verfahren zur Genehmigung und Planung, sodass die Energiewende vollzogen werden kann.
Die diesjährige Fachtagung im Congress Center Leipzig endete nach einem Tag, der geprägt war von fachlich spezifischen Vorträgen, angeregten Diskussionen und Kontakte-Knüpfen beim gemeinsamen Essen. „Wie auch im letzten Jahr war die 24. Fachtagung „Energie Umwelt Zukunft“ ein voller Erfolg,“ blicken Huhn und Derbel auf die Veranstaltung zurück.
Autorenschaft: Elisabeth Bott, Leonard Christopher Stadler (Fakultät Informatik und Medien)
Kooperationen mit dem KRICT und dem KIST (Südkorea)
Nach dem Erfolg des 1st International Symposium on „Development of nanomaterial-based in-vitro diagnostic technology for thrombosis in various stages” im Februar 2024 in Leipzig erfolgte am Korea Research Institute of Chemical Technology (KRICT) in Daejeon im Juni die zweite Ausgabe des internationalen Symposiums. Das KRICT, bekannt für seine wegweisende Forschung und Entwicklung in der Chemietechnologie, empfing die deutsche Delegation, zu der auch Prof. Sabine Steiner und Dr. Ronny Baber von der Universität Leipzig gehörten, zur Vertiefung der Forschungszusammenarbeit bei der Entwicklung von Biosensoren.

Im Anschluss erfolgte ein Besuch des langjährigen Kooperationspartners Korea Institute of Science and Technology (KIST) in Jeonbuk. Organisiert von Dr. Hwang vom KIST erfolgten vertiefte Gespräche zu Forschungsideen zum Thema nachhaltige Energiespeicherlösungen. Auf diesem Forschungsgebiet arbeiten HTWK und KIST bereits länger zusammen. Zurzeit absolviert der HTWK-Masterstudent Simon Willenbrink einen Forschungsaufenthalt am KIST.
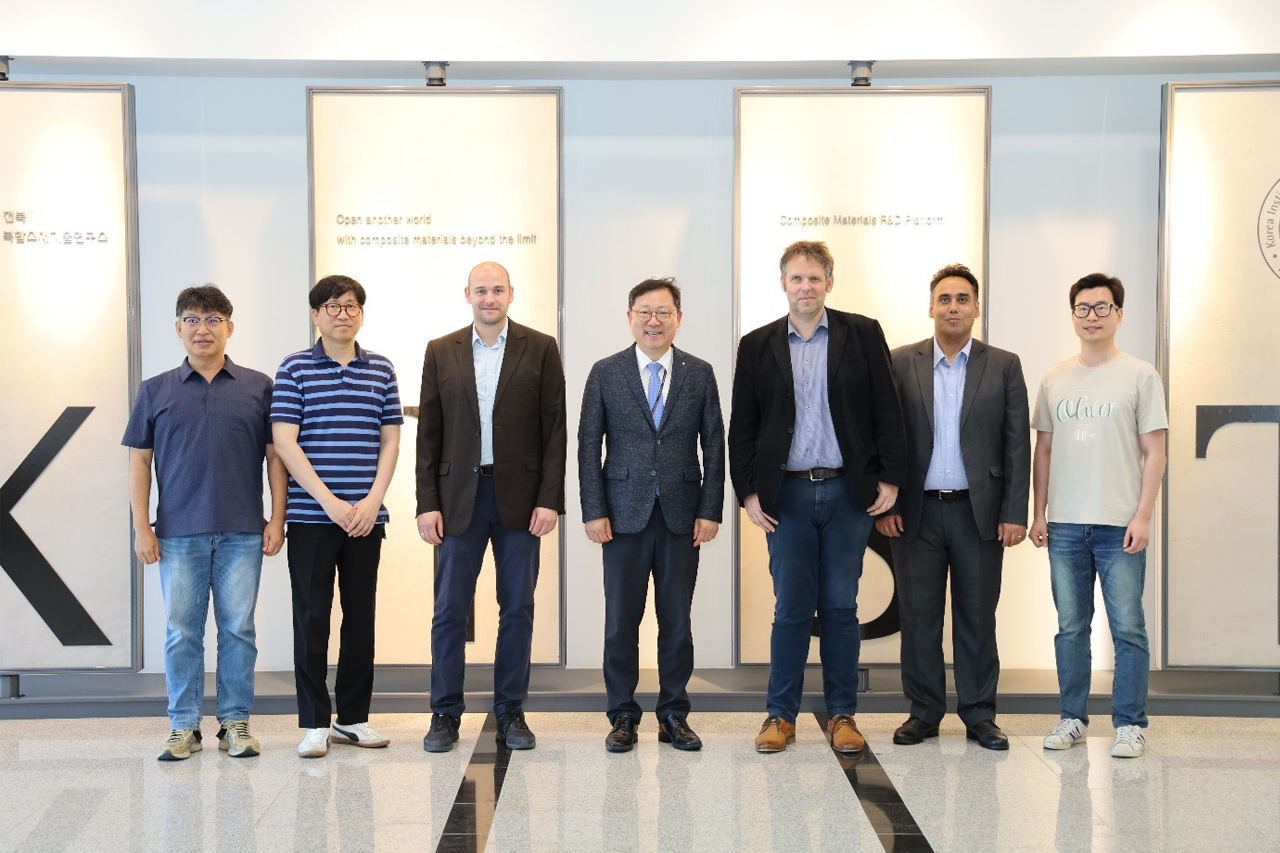
Forschung zu nachhaltiger Energiespeicherung mit der MCUT (Taiwan)
Der zweite Teil der Reise führte die Delegation an die Ming Chi University of Technology (MCUT) in New Taipeh City, Taiwan. Hier ging es um nachhaltige und grüne Energiespeicherlösungen, insbesondere um die Entwicklung von Batterien. In den Treffen mit Prof. Dr. Kuo wurde die Bedeutung nachhaltiger Ansätze bei der Entwicklung bauteilintegrierter Batteriespeicher und deren Potenziale für Elektromobilitätslösungen herausgearbeitet.

Engagement der HTWK Leipzig für nachhaltige Forschung
Mit der Gründung des Vize-Rektorats für Forschung und Nachhaltigkeit im Jahr 2023 hat sich die HTWK Leipzig bereits zur Ausrichtung ihrer Forschungsschwerpunkte auf das Thema Nachhaltigkeit in den kommenden Jahren bekannt. Die Forschung an multifunktionalen Verbundwerkstoffen ist in dem Zusammenhang bedeutsam, weil mit der damit einhergehenden Gewichtseinsparung in Strukturen in der Regel reduzierte Emissionen einhergehen. Die HTWK Leipzig wird in Zukunft mit ihren internationalen Partnern KRICT, KIST und MCUT auf diesem Gebiet zusammenarbeiten.
Die diesjährige gastgebende Fakultät war die Fakultät Digitale Transformation (FDIT). Sie ist die jüngste der sechs Fakultäten der HTWK Leipzig: 2018 wurde sie von der Deutschen Telekom AG gestiftet und widmet sich seitdem den digitalen Veränderungsprozessen in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft und Alltag. „Wir haben uns sehr gefreut, bei ‚Forschung trifft …‘ sowohl unsere Fakultät als solche als auch Projekte aus Forschung und Lehre einerseits der Hochschulöffentlichkeit und andererseits auch vor externen Partner präsentieren zu können, denn viele von ihnen waren noch nicht hier am Standort“, so Prof. Oliver Crönertz, Prodekan der FDIT.
Was gab es 2024 zu sehen?
Zu den geöffneten Laboren gehörten das Cloud- und das EMV-Labor im Shannon-Bau sowie das Optik- und das Mobilfunk-Labor im Hopper-Bau. In letzterem gab beispielsweise Prof. Michael Einhaus Einblicke in die digitale Datenanalytik und zeigte an Hand des Forschungsprojekts Tri5G, wie es im Leipziger Nordraum um die Dienstgüte in Mobilfunknetzen steht.
Zudem präsentierten sich im Erdgeschoss des Hopper-Baus weitere Einrichtungen und Projekte: So stieß beispielsweise die interaktive und virtuelle Roomtour, bei der die Angebote der HTWK-Gründungsberatung Startbahn 13 und vom Mittelstand-Digital Zentrum Leipzig-Halle (MDZ) entdeckt werden konnten, auf reges Interesse. Max Polter vom MDZ berichtete nach der Veranstaltung: „Bei unserem Stand vom Mittelstand-Digital Zentrum Leipzig-Halle konnte ich viele neue interessante Kontakte knüpfen: Forschungsgruppen zu Nachhaltigkeitsthemen und digitalen Technologien sind für uns als Transferprojekt besonders interessant, um zu erfahren, welche neuen Innovationen gerade im Kommen sind. Im Gespräch mit Start-Ups, die aus der HTWK heraus gegründet haben, kommen da natürlich die Ideen für Synergien ganz von alleine. Ich habe auf jeden Fall viel mitgenommen und freue mich darauf, unser Netzwerk in die HTWK hinein weiter wachsen zu lassen.“
Für Gesprächsstoff sorgten auch die Demonstrationen und interaktiven Prätentionen vom Projekt FAssMII. Ziel des Projekts ist es, dieHochschullehre durch Digitalisierung und unter Berücksichtigung hochschuldidaktischer Prinzipien innovativ weiterzuentwickeln.Außerdem konnten sich Interessierte Poster ansehen, darunter zum Vorhaben „samarbeid“, das die Digitalkompetenz fördern will, oder zu ausgewählten Bachelorarbeiten zum Thema „Mit maschinellem Lernen gegen den Klimawandel“.
Weitere Angebote
Wenige Meter weiter hatten die HTWK Robots ihren Stand aufgebaut. „Sie sind die HTWK-Botschafter der digitalen Transformation“, so Crönertz. Vor 15 Jahren gründete sich die Gruppe als studentisches Projekt und entwickelt seitdem die Software für die Fußball-Roboter stets weiter, so dass die HTWK Robots regelmäßige Erfolge im weltweiten Roboterfußball feiern. Bei „Forschung trifft …“ konnten Interessierte die Roboter selbst steuern, Fotos mit ihnen machen oder sich selbst per Green Screen in Echtzeit digital auf Robotergrößer schrumpfen und in ein Spielfeld teleportieren lassen.
Erstmals vorgestellt hat sich vor Ort die Promovierendenvertretung (ProV) der HTWK Leipzig. Promovierende standen den Interessierten in Form eines Science-Speed-Datings Frage und Antwort. „Es war spannend zu erfahren, mit welchen Projekten sie sich befassen, wie groß die Vielfalt und wie hoch die Qualität ist. Dies hat sich auch wenige Tage später bei der diesjährigen Nachwuchswissenschaftlerkonferenz anhand der Vielzahl der Beiträge und den zwei gewonnenen Preisen gezeigt“, so Derbel.
Im Sommer 2025 wird es die vierte Ausgabe von „Forschung trifft …“ geben – wo, das bleibt noch geheim.
Das Kompetenzzentrum ist eine Symbiose aus dem GRAVOmer-Netzwerk sowie drei zur HTWK Leipzig gehörenden Bereichen: dem iP³ Leipzig – Institute for Printing, Processing and Packaging Leipzig, dem Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Zentrum und dem Kompetenzzentrum für Werkstoffforschung, so iP³-Institutsleiter Prof. Dr. Lutz Engisch. Viele Schritte aus der alten Welt der Druck- und Verpackungstechnik seien bekannt, nun können sie mit dem Zentrum ins Heute übertragen werden. Dazu beitragen wird auch die neue Beschichtungsanlage, mit der künftig neue Ideen in Bildung, Wissenschaft und Entwicklung implementiert werden können. „Wir machen damit einen weiteren Schritt in Richtung Fortschritt“, fasst Prof. Dr. Swantje Rother, Kanzlerin der HTWK Leipzig, die Einweihung zusammen. Fortschritt entstehe an Schnittstellen, an denen wie an der HTWK Leipzig interdisziplinär ausgebildet und geforscht werde.
Die Beschichtungsanlage „MicroFLEX“
Die Beschichtungsanlage der „MicroFLEX“-Reihe von 3D Micromac ist Teil des neuen Kompetenzzentrums „Smart Surfaces“. Sie steht nun im Drucksaal der HTWK Leipzig für Lehre und Forschung zur Verfügung. Optisch erinnert sie an eine Druckmaschine, bei denen Papierbahnen automatisch von Rolle zu Rolle geführt werden, dabei verschiedene Druckwerke durchlaufen und am Ende vierfarbig in einem Durchgang bedruckt herauskommen – nur verbindet die neue Beschichtungsanlage mehrere unterschiedliche Druckverfahren und kann neben Papier auch Folien und Glas befördern und diese mit zum Beispiel elektrisch leifähigen, halbleitenden oder biologisch aktiven „Farben“ bedrucken.
Die Beschichtungsanlage ist zwölf Meter lang und verfügt über acht einzeln zugängliche Module, in denen die Materialbahn vielseitig geführt und optimal verarbeitet werden kann. „Derzeit ist die MikroFLEX mit Flexo-, Schlitzdüse-, Sieb-, Tintenstrahldruck und Laminierungsfunktionen ausgestattet und bietet zahlreiche Möglichkeiten. Außerdem haben wir zwei leere Module, an denen wir neue Ideen umsetzen können, um beispielsweise Lösungen für effiziente Trocknung, neuartige Beschichtungsverfahren oder Kapselungen für gedruckte Elektronik zu finden“, sagt Ingo Reinhold, HTWK-Professor für Beschichtungsprozesse und Leiter des Centers for Smart Surfaces der HTWK Leipzig.
Anwendung in Lehre und Forschung
„Die Maschine bietet eine Experimentierbühne für Druck- und Beschichtungsprozesse und ist eine große Chance für uns, die Studierenden und die Industrie“, ergänzt Reinhold. Studierende können an der Maschine die Verarbeitung von bahnförmigen Stoffen in industrienaher Komplexität erfahren, sodass sie praktische Erfahrungen sammeln können, die in der jetzigen und kommenden technologischen Entwicklung in der additiven Fertigung notwendig sind. Das reicht von Bahnsteuerung über passende Verfahrensparameter und effiziente Trocknung bis hin zur Vermeidung oder Nutzung von Instabilitäten in dünnen, flüssigen Filmen.
Außerdem können Forschende an der Hochschule sowohl wissenschaftliche Untersuchungen an neuen Bahnmaterialien, Druckfarben und -lacken als auch Pilotproduktionen für die Überführung in industrielle Prozesse durchführen, beispielsweise sind Prozesskombinationen und Funktionalisierungen möglich. Durch die Kombination von Materialien und Verfahren können sie zudem neue Konzepte für die Herstellung gedruckter Elektronik, die Beschichtung für nachhaltige Verpackungskonzepte oder mikrofluidische Medizintechnikkomponenten entwickeln und testen.
Ermöglicht wurde die Anlage insbesondere durch eine Beteiligung der HTWK Leipzig, der 3D-Micromac AG, des GRAVOmer-Netzwerks, der Gutenberg Verlag & Druckerei GmbH und der Reisewitz Beschichtungsgesellschaft mbH.
Hintergrund zum GRAVOmer-Netzwerk
Die Anlage ist ein integraler Bestandteil des virtuellen Kompetenzzentrums von GRAVOmer, einem Netzwerk für mikrostrukturierte Funktionsoberflächen, und stellt einen wichtigen Meilenstein für dessen Weiterentwicklung dar. Das Kompetenzzentrum unterstützt Unternehmen bei der Erschließung neuer Märkte und bei der Durchführung von Pilotprojekten in der Industrie. Darüber hinaus liegt ein Schwerpunkt auf der Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitenden und Partnern. Auch Transferprojekte mit externen Industriepartnern können nun gemeinsam durchgeführt werden. Zum Netzwerk gehören rund 70 Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft, zumeist aus dem mitteldeutschen Raum, darunter die HTWK Leipzig, das Forschungsinstitut für Leder und Kunststoffbahnen (FILK) in Freiberg, die Technische Universität Dresden oder das Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung (IOM) in Leipzig.
In dieser Ausgabe richten wir den Fokus auf den Strukturwandel. Denn die Welt, unser Land und unsere Region durchleben seit Jahren Wandlungsprozesse auf mehreren Ebenen – beeinflusst vom Klimawandel, dem demografischen Wandel oder vom Ausstieg aus der Braunkohleverstromung. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der HTWK Leipzig begegnen den daraus resultierenden Herausforderungen mit Lösungsvorschlägen und schaffen mit ihren Forschungen Möglichkeiten für neue Wege, Technologien, Methoden und Visionen.
Lesen Sie beispielsweise, wie die HTWK Leipzig den Mittelstand bei der digitalen und nachhaltigen Transformation stärkt, wie die Geotechnik Kippenböden in stillgelegten Braunkohleabbaugebieten fest und sicher für Neues macht, wie im Norden Leipzigs ein Reallabor der Netztechnologie 5G entsteht und wie AAL-Technologien ein selbstbestimmtes Wohnen im Alter ermöglichen können.
Neben der Forschungsstatistik 2023 finden Sie wie immer auch die Gewinnerbilder des Fotowettbewerbs Forschungsperspektiven sowie viele weitere spannende Einblicke in unsere vielfältigen Forschungsthemen.
Viel Lesevergnügen wünscht Ihnen die Einblicke-Redaktion des Referats Forschung!
Keine Ausgabe verpassen
Gern können Sie kostenfrei die Einblicke postalisch oder digital abonnieren unter htwk-leipzig.de/einblicke
Die Einblicke erscheint einmal im Jahr.
Wie gefällt Ihnen die Einblicke?
Ihre Meinung interessiert uns! Schreiben Sie uns gern – ob Lob oder Kritik – an einblicke (at) htwk-leipzig.de
Prof. Dr.-Ing. Robert Huhn und Prof. Dr.-Ing. Faouzi Derbel, beides Professoren der Hochschule, leiten die Fachforen zu den Themen Gas und Strom. Prof. Derbel ist zudem als Prorektor Forschung Mitglied des Rektorats der HTWK Leipzig. Diskutiert wird über aktuelle Möglichkeiten und Herausforderungen von Energiewirtschaft und Energiepolitik.
Die Veranstaltung eröffnet enviaM-Vorstand Patrick Kather. Im Eröffnungsforum am Vormittag wird über Themen wie „Die Zukunft ist elektrisch – Die Wärmepumpe auf dem Weg zur Standardheizung“ (Dr. Martin Sabel, Bundesvorstand für Wärmepumpen) oder die „Energiezukunft im Netz“ (Dirk Sattur, Geschäftsführer MITNETZ GAS/STROM).
Im Mittelpunkt der Tagung stehen Fachforen zu Strom und Gas. Prorektor Derbel wird im Fachforum Strom über die Smartifizierung des Stromnetzes, technologisches Potenzial von Solarmodulen sowie Wärmepumpen und Hybriden in Bestandsgebäuden referieren. Ebenso werden die Ladeinfrastruktur und die sichere Funkvernetzung von Sensoren der kritischen Infrastruktur Thema sein. Prof. Robert Huhn referiert im Fachforum Gas über Wasserstoff und grüne Gase.
Interview
Vorab hatten Studierende der HTWK Leipzig Gelegenheit, die Energieexperten zu interviewen:
Was dürfen wir von der 24. Fachtagung Energie Umwelt Zukunft erwarten?
Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm mit Fachvorträgen zur aktuellen und zukünftigen Gas- und Elektrizitätsversorgung sowie spannenden Diskussionen mit allen, die referieren, und Gästen. Zudem bieten die Ausstellungen Kontaktmöglichkeiten zu Firmen und Verbänden im Energiesektor.
Wo liegen Ihre Forschungsschwerpunkte in diesen Bereichen? Welche Rolle spielt hierbei die HTWK?
Prof. Huhn: Mein Fachbereich umfasst Gas- und Wärmeversorgung, die eng miteinander verknüpft sind. Mit meinen Mitarbeitenden forsche ich zur Umstellung der Erdgasinfrastruktur auf 100 Prozent Wasserstoff sowie an der Nutzung und Speicherung von Abwärme, z.B. aus Elektrolyseuren, in kommunalen Wärmenetzen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die ganzheitliche ökologische Bewertung.
Prof. Derbel: Ich habe die Professur für Smart Diagnostik und Online Monitoring inne. Mit meinem Team forsche ich zu verteilten Mess- und Sensorsystemen, speziell zu Monitoring und Diagnostik elektrischer Anlagen und Betriebsmittel. Energieeffiziente, drahtlose Sensornetzwerke und Signalverarbeitungsmethoden in Embedded Systems mit begrenzten Ressourcen spielen dabei eine große Rolle.
Mit der zunehmenden Technologisierung ergibt sich ein immer höherer Bedarf an Energie. Wie stellen wir diesen Bedarf – im Idealfall nachhaltig – sicher? Was muss sich in Bezug auf Nachhaltigkeit und Energieverbrauch ändern?
Wir sollten zunächst Energie sparen, wo es möglich ist. Die Nutzung heimischer erneuerbarer Ressourcen, insbesondere lokaler Potenziale, sollte im Vordergrund stehen. Auf längere Sicht werden wir jedoch Energieimporte benötigen. Diversifizierung und Technologieoffenheit sind dabei wichtig. Ganzheitliche Bewertungen der Wertschöpfungsketten der Energieversorgung, sogenannte Life Cycle Assessments, können nachhaltige Entscheidungen unterstützen. Energieverbrauchsoptimierung und intelligente Netzsteuerung sind besonders im Hinblick auf erneuerbare Energiequellen zwingend notwendig.

Welche großen Änderungen und Entwicklungen finden in den Bereichen der Energieversorgung Gas und Strom statt?
Wir transformieren von fossilem Erdgas zu grünen Gasen wie Biogas, Biomethan und grünem Wasserstoff. Jetzt müssen wir die richtigen Entscheidungen treffen und die Weichen für die Zukunft stellen.
Die Energiewende erfordert vernetzte Energiesysteme mit Speichertechnologien und durchgängige Digitalisierung basierend auf geeigneten Informations- und Kommunikationstechnologien. So kann eine intelligente Netzsteuerung zur Optimierung des Energieflusses und Integration erneuerbarer Energien basierend auf Vorhersagen von Energiebedarf und -produktion realisiert werden.
Welche Änderungen ergeben sich für Verbrauchende in den kommenden Jahren?
Endverbraucher müssen sich auf geänderte regulatorische Vorgaben und vorübergehend steigende Energiekosten einstellen. Transparente Kommunikation der energie- und klimapolitischen Ziele und Rahmenbedingungen ist notwendig, um alle Akteure der Energiewende mitzunehmen.
Der Anteil der erneuerbaren Energien steigt in Deutschland. Vor welchen Herausforderungen stehen wir dennoch in Zukunft und was sind Lösungsmöglichkeiten?
Wir fokussieren oft nur den Stromsektor, aber 100 Prozent erneuerbarer Strom ist nicht die gesamte Energiewende. Auch die Energieträger in Verkehr, Industrie und Wärmeversorgung müssen defossilisiert werden. Technologieoffenheit, intelligente Vernetzung der Energiesektoren, geeignete Energiespeicher und ein besseres Bewusstsein für Energieeinsparung sind Lösungen. Reduzierte Bedarfsmengen müssen nicht substituiert werden.
Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Organisatorisches
Neben der HTWK Leipzig sind MITGAS und MITNETZ GAS, enviaM und MITNETZ STROM, Bosch und Buderus Partner der Fachtagung. Sie richtet sich an Energieversorgungsunternehmen, Gewerbe und Industrie, Hochschulen und Studierende. Der Tagungsbeitrag beträgt 49 Euro. Für Studierende, Sponsoren und Partner ist der Eintritt frei.
Tagungsprogramm und Anmeldeformular gibt es unter www.energiefachtagung.com. Anmeldeschluss ist der 11. Juni 2024.
Autorinnen und Autoren: Leonard Christopher Stadler, Luisa Oppenhym, Elisabeth Bott, Niklas Röthig
Für Mittwoch, den 22. Mai 2024, hat sich der Entertainer vier Forschende in den Leipziger Kupfersaal eingeladen, die bei der lebendigen Wissenschafts-Show in Form von Science Slams kurzweilig und anschaulich über ihre Fachgebiete informieren. Auf der Bühne zu erleben ist auch HTWK-Professor Jens Schneider.
Können uns erneuerbare Energien retten?
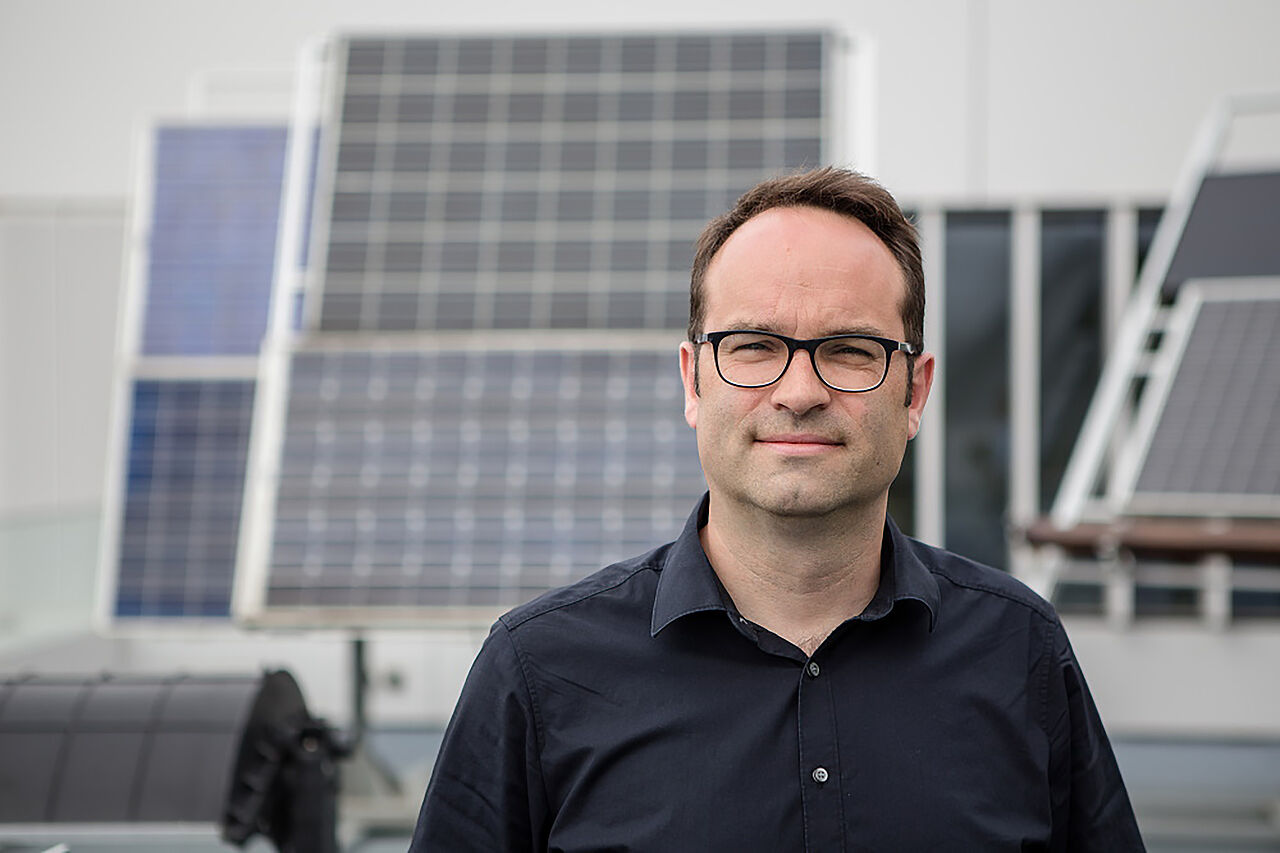
Jens Schneider ist Professor für Vernetzte Energiesysteme an der HTWK Leipzig. Am Institut für Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik forscht er zu erneuerbaren Energien und der Optimierung von Energieerzeugung. Für eine klimaschonende Energieversorgung will er neue Lösungen für eine erfolgreiche Vernetzung der Energiesysteme entwickeln. „Der Ausbau erneuerbarer Energien geht aktuell gut voran. Jetzt müssen wir Flexibilität belohnen, um in Zeiten von Überschüssen viel Energie zu verbrauchen, die wir in knappen Zeiten einsparen. Mit den richtigen Marktregeln liegen hier große Potentiale für Innovationen. Diese zu entwickeln macht viel Spaß und bietet Chance, selbst etwas für unsere Zukunft zu bewegen“, so Schneider.
In seinem Vortrag geht er der Frage nach, wie der Energiehaushalt von morgen aussehen könnte und ob uns erneuerbare Energien wirklich retten können. Zugleich gibt er Tipps, wie jede einzelne Person einen Beitrag leisten kann.
Weitere Science Slams
Neben Schneider tritt Dr. Roland Schrödner vom Leibniz-Institut für Troposphärenforschung auf. In der Abteilung „Modellierung atmosphärischer Prozesse“ beschreibt er mit Modellsystemen komplexe atmosphärische Vorgänge. Zur Veranschaulichung wird er gemeinsam mit Moderator Jack Pop ein Bühnenexperiment durchführen und eine Mini-Erde modellieren. An dieser zeigt er, wie Kohlenstoffdioxid (CO₂) dafür sorgt, den Planeten zu erwärmen.
Mit einem sehr speziellen Thema befasst sich Dr. Marcus Schwarz vom Institut für Rechtsmedizin der Universität Leipzig. Er ist einer von nur vier forensischen Entomologen, die es in Deutschland gibt, und er hat vor wenigen Jahren das Buch „Wenn Insekten über Leichen gehen – Als Entomologe auf der Spur des Verbrechens“ veröffentlicht. Darin beschreibt er seine Arbeitsweise und rekonstruiert einige Ermittlungsfälle. Im Vortrag gibt er Einblicke in seine Arbeit.
Schließlich hält Silke Oppermann von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde einen Vortrag. Sie ist Expertin für nachhaltige Ernährung und Klimaneutralität und hat bereits Erfahrungen in Science Slams. So gehört sie beispielsweise zu den Finalisten der Deutschen Science Slam Meisterschaften 2023. Sie befasst sich im Vortrag mit Lebensmittelkennzeichnungen und wird erklären, warum solche Labels nicht zur Einhaltung der Klimaziele von Paris beitragen – Stichwort: Greenwashing.
Hintergrund zum „Circus of Science“

Der „Circus of Science“ ist eine Infotainment-Show in Leipzig. Sie bietet „Hirnfutter für Nerds und Noobs, für Galileo-Gucker und Gar-nichts-Checker, für Akademiker und Schulabbrecher“, wie es auf der Webseite heißt. Dafür lässt Moderator Jack Pop Forschung mit Fakten, Gags und Live-Musik lebendig werden, damit das bunt gemischte Publikum am Ende mit Erkenntnisgewinnen nach Hause geht. Zusätzlich treten jeweils mehrere Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler auf, die in Form eines Science Slams ihr Fachgebiet vortragen. Dabei können sie alle Hilfsmittel nutzen: von Power-Point-Präsentationen bis hin zu Live-Experimenten. Das Publikum kann ebenfalls aktiv sein: Vor Showbeginn dürfen sie vor Ort an verschiedenen Stationen selbst Experimente ausprobieren und während der Show können sie an interaktiven Quizrunden teilnehmen, bei denen es manchmal ganz schön wild, aber stets lehrreich zugeht.
Die Vorträge im Sommersemester

Die Vorträge in diesem Sommersemester beinhalten aktuelle Themen wie die Prozessdigitalisierung in der Geotechnik zur Integration aller geotechnischen Daten und Abläufe, vorgestellt von Dipl.-Inf. Simon Buss, Geschäftsführer bei GGU am 17.04.2024.
Nach einer vierwöchigen Pause geht es weiter am 15.05.2024 mit Dipl.-Geog. Florian Köllner, Technischer Referent und BIM Manager beim Fernstraßen-Bundesamt und dem Thema „BIM in Planung und Genehmigung von Straßenbauvorhaben“. Auch bei Tiefbauprojekten dieser Art kann das Building Information Modelling durch vereinfachte Planung, Ausführung und Überwachung die Effizienz von Straßenbauprojekten verbessern.
Am 29.05.2024 wird von Dipl.-Ing. Yves Koitzsch, Senior Consultant Infra/Geotechnik bei CDM Smith der ehemalige Braunkohletagebau Nachterstedt/ Schadeleben vorgestellt, welcher im Jahr 2009 durch die tragische Böschungsrutschung Aufsehen erregte. CDM Smith ist hierbei für die geotechnische Begleitung der Sanierung zuständig.
Zwei Wochen später, am 12.06.2024, erfahren Sie von Dipl.-Ing. Lars Lindstädt (ArcelorMittal Träger und Spundwand GmbH), warum Spundwände bei ihrer Anwendung auf der Baustelle sowohl nachhaltig als auch vielseitig einsetzbar sind.
Den spannenden Abschluss in diesem Sommersemester bietet am 29.06.2024 Dipl.-Ing. Sabine Kulikov, Referentin beim SMWA (Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr) mit dem maßgeblich vom Freistaat Sachsen initiierten europäischen Infrastrukturgroßprojekt – der Schienenneubaustrecke von Dresden nach Prag.
Teilnahme am Geotechnikseminar an der HTWK Leipzig
Beginn des Geotechnikseminars ist jeweils 17:15 Uhr im Trefftz-Bau (ehemaliges HfTL-Gebäude in der Gustav-Freytag-Straße 43), Raum 2.28 (2. Stock) / Haus A.
Eine Online-Teilnahme ist über Zoom möglich (je 17:00 bis 19:00 Uhr, https://htwk-leipzig.zoom-x.de/j/67984273121, Meeting-ID: 679 8427 3121).
Das Geotechnikseminar wird bei der Ingenieurkammer Sachsen als Weiterbildungsveranstaltung angemeldet; ein Fortbildungsnachweis kann erstellt werden.
Die Teilnahme ist kostenlos.
Geowissenschaften an der HTWK Leipzig
Die Geowissenschaften an der HTWK Leipzig sind als interdisziplinäres Team aus den Bereichen Bauingenieurwesen, Maschinenbauingenieurwesen, Geografie und Geologie aufgestellt. Sie beschäftigt sich mit Themen der Makro- und Mikromechanik von Böden und übertragen ihre Ergebnisse auf praktische Bauprozesse und aktuell relevante Querschnittsthemen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der Geotechnik.
Die Geowissenschaften sind zudem Mitglied im Transferverbund Saxony⁵ der fünf sächsischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Im Teilprojekt „Nachhaltiges Bauen“ werden Forschungsergebnisse am GeoTechnikum ‒ einem Experimentier- und Demonstrationsraum mit Freiversuchsflächen und einem bodenmechanischen Forschungslabor ‒ in großem Maßstab validiert und für Partner aus Praxis und Wissenschaft demonstriert.
Sowohl die York University als auch die HTWK Leipzig haben einen starken Forschungsschwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Die York University wurde im Times Higher Education (THE) Impact Ranking 2023 als eine der weltweit führenden Universitäten auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit genannt (Top 40-Platzierung). Die HTWK Leipzig hat ihr Prorektorat für Forschung und Nachhaltigkeit ebenfalls im Jahr 2023 neu eingerichtet, um ihre Forschungsschwerpunkte im Hinblick auf Nachhaltigkeit für die nächsten Jahre zu reflektieren.
In diesem Zusammenhang spielt die Forschung zu Verbundwerkstoffen eine wichtige Rolle, denn Verbundwerkstoffe unterstützen den Weg in eine klimaneutrale Zukunft, da der Faserverbundleichtbau zur Emissionsreduktion beiträgt und gleichzeitig leistungsfähige Produkte schafft. Die Lebensdauer von Leichtbauprodukten kann um Jahrzehnte verlängert werden, da Verbundwerkstoffe korrosionsbeständig und langlebig sind.
Im August 2024 wird Prof. Robert Böhm (Professor für Leichtbau mit Verbundwerkstoffen) daher nach Toronto reisen. Ein Gegenbesuch von Prof. Garrett Melenka ist für den Herbst 2024 geplant.
Hintergrund
Die DFG-Initiative „Unterstützung der Internationalisierung von Forschung an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (UDIF-HAW)“ wendet sich explizit an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW), die sich für internationale Forschungskooperationen interessieren oder diese ausbauen möchten.
Auch die HTWK Leipzig war mit mehreren Exponaten und zwei Meet-A-Scientist-Angeboten vertreten: Zum einen in der ersten Etage auf der Sonderausstellungsfläche, auf der auch die anderen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) sowie der Transferverbund Saxony5 waren. Zum anderen gab es eine Etage tiefer, im sogenannten „Machwerk“, weitere HTWK-Angebote zu bestaunen.
Spannende Themen und interaktive Exponate
Die Geotechnik-Sprungkiste kam gut an: „Das Publikumsinteresse war durchweg sehr groß. Über 500 Sprünge von Kindern und Erwachsenen in unserer Sprungkiste zählte unsere App. Es war schön zu sehen, dass so viele Interesse am Thema Bodenverdichtung gezeigt haben“, sagt Sophie Bachmann vom Geotechnik-Team der HTWK Leipzig. Direkt daneben hatte die Forschungsgruppe FLEX ihren Stand und präsentierte dort den InNoFa-2.0-Demonstrator – sowohl zum Anfassen als auch virtuell. Anhand des Knotenelements erklärten die Forschenden, wie mit einem neu entwickelten 3D-Druckverfahren flexiblere, materialsparendere und damit ressoucenschondendere Stahlkonstruktionen gedruckt werden können. Wie eine vollständige Fassade nach dem Prinzip des InNoFa-2.0-Demonstrators aussehen kann, konnten sich die Gäste schließlich mithilfe einer AR-Brille als Hologramm ansehen.
Auch beim Meet-A-Scientist-Stand von Florian Junker vom Institut für Betonbau konnten die Interessierten etwas in die Hand nehmen: eine textile Gleitschicht, die im Forschungsprojekt SlideTex entwickelt wird und die die Rissgefahr von Bodenplatten vermindern soll. „Wasserführenden Risse können erhebliche Schäden verursachen, die den Menschen, der Elektronik und dem Lagergut schaden können“, erklärt Junker. Spannend war auch das Thema von Dr. Konstantin Weise, der die Vertretungsprofessur für Grundlagen der Elektrotechnik innehat. Er erklärte, welche Rolle die Elektrotechnik in den Neurowissenschaften spielt, denn ohne ein grundlegendes Verständnis elektrotechnischer Erscheinungen wäre moderne Neurowissenschaft schließlich undenkbar.
„Die HTWK Leipzig ist toll“
Mit einer ebenfalls spannenden Frage ging es bei den HTWK-Ständen im Erdgeschoss weiter: „Wie bekomme ich Beton zum Leuchten?“ fragten sich viele Besuchende und probierten das Leuchtbetonbauteil aus, das vom Institut für Betonbau und vom PAES | Institut für Prozessautomation und Eingebettete Systeme entwickelt wurde. „Die Besuchenden fanden die Idee sehr cool. Viele überlegten auch direkt, was man noch daraus machen kann“, so Tobias Rudloff vom PAES. Das besondere dahinter ist die verbaute Struktur, die es auch zu sehen gab.
Währenddessen sich vor allem die Erwachsenen – darunter auch viele Personen, die im Bauwesen arbeiten – über Carbonsensorik, funktionalisierte Bauteile und die Forschung zum neuen Werkstoff Carbonbeton unterhielten, standen die Kinder und Jugendlichen bei den benachbarten Ständen teilweise bis zu 20 Minuten an: So hatte das Institut für Betonbau noch VR-Brillen dabei, bei denen sich Interessierte beispielsweise den CUBE in Dresden ansehen konnten, das weltweit erste aus Carbonbeton gebaute Haus.
Groß war das Kinderaugenleuchten auch nebenan bei den HTWK Robots: Die Nao-Roboter spielen sonst selbstständig Fußball gegen Teams aus aller Welt und erproben dabei spielerisch Ansätze der künstlichen Intelligenz, beim Wissenschaftsfestival in Dresden konnten alle Interessierten aber auch einmal selbst die Fußballroboter steuern. Diese Chance ließ sich auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer nicht nehmen. „Die HTWK Leipzig ist toll“, so sein Fazit vom kurzen Besuch am Freitagmittag. Das Team der HTWK Robots hatte zudem die Ehre, am Freitagabend bei der Science Night auftreten zu dürfen und vor einem vollen Saal mit rund 200 Gästen ebenfalls anschaulich zu erklären, wie Fußball und künstliche Intelligenz zusammenhängen. Die Botschaft der HTWK Robots war dabei klar: Sie wollen mit den Nao-Robotern 2050 Weltmeister im Menschenfußball werden.
Hintergrund
Mit der Kampagne „SPIN2030. Wissenschaftsland Sachsen“ möchte das sächsische Wissenschaftsministerium die Vielfalt, Exzellenz und Attraktivität des Forschungsstandortes Sachsen einem breiten Publikum nahebringen. Universitäten, Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, die Berufsakademie Sachsen und außeruniversitäre Einrichtungen aus dem gesamten Bundesland beteiligen sich daran.
Forscherinnen und Forscher aus Südkorea, den USA, Großbritannien und Deutschland diskutierten dabei, wie sich Thrombose-Erkrankungen durch neuartige Biosensoren frühzeitig erkennen lassen. Es erfolgte ein Austausch von Expertinnen und Experten aus der Medizin, der Materialforschung und der Sensorentwicklung. Das Ziel der Expertengruppe besteht darin, eigens entwickelte Nanowerkstoffe in den Sensoren zu verwenden, um das Auftreten bestimmter, für Thrombosen typischer Biomarker so früh wie möglich zu erkennen.
Im Juni 2024 ist in Daejeon (Südkorea) eine Folgeveranstaltung geplant. Die Expertengespräche sollen dabei helfen, ein größeres deutsch-koreanisches Forschungsvorhaben vorzubereiten. Die Durchführung der Kolloquien werden von der koreanischen Regierung und vom sächsischen Transfervorhaben Saxony5 unterstützt.
]]>
„Die Grundsteinlegung ist für uns ein bedeutender Moment. Seit knapp zehn Jahren beschäftigt sich die HTWK-Forschungsgruppe FLEX mit digital basierten Konzepten für das individuell automatisierte Bauen. Exemplarisch dafür steht das ressourcenschonende Zollingerdach, unter dem wir heute stehen. Um die gewölbte Dachkonstruktion aus Holz zukunftsfähig zu machen, haben wir vernetzte digitale Methoden genutzt. Unsere besondere Expertise mündet nun im HolzBauForschungsZentrum. Im Reallabor wollen wir das Bauen mit Holz im Maßstab 1:1 auf Anwendungsniveau entwickeln und den Transfer von der angewandten Wissenschaft in die Praxis deutlich beschleunigen“, so Prof. Alexander Stahr, Leiter der Forschungsgruppe FLEX an der HTWK Leipzig und Projektleiter des HolzBauForschungsZentrums.
Bis zum Sommer 2024 soll das HolzBauForschungsZentrum fertig gebaut sein und damit pünktlich zum zehnjährigen Bestehen der Forschungsgruppe FLEX an die HTWK Leipzig übergeben werden. Unweit des Zollingerdaches und in direkter Nachbarschaft zum Carbonbetontechnikum der HTWK Leipzig wird damit eine weitere Forschungseinrichtung im InnovationsPark • Bautechnik • Leipzig/Sachsen stehen. Der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) ist Auftraggeber des Investors MFPA Leipzig GmbH und ermöglicht damit der HTWK die schnelle Nutzbarkeit einer neuen Forschungsstätte für den Holzbau. Initiator sind das Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung und das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus mit der sächsischen Holzbauinitiative und der Förderung angewandter Forschung.
Neues Reallabor für den Holzbau der Zukunft

Das HolzBauForschungsZentrum wird eine Grundfläche von etwa 1.100 Quadratmetern haben. In der Halle entsteht eine frei konfigurierbare Arbeitsfläche für den großformatigen digitalen Holzbau. An einem Brückenkran hängend befestigte Industrieroboter bilden das „technologische Herz“ des Technikums. Sie sind über eine zentrale Steuerung untereinander und mit dem Kran verbunden, sodass jeder Punkt in der Halle zur Ausführung von Bearbeitungsschritten digital angesteuert werden kann. Mit dieser bislang kaum erprobten, aber enorm platzsparenden Vorfertigungsstrategie wird das Technikum ein technologisches Alleinstellungsmerkmal aufweisen. Ergänzend befinden sich in den Nebenräumen eine moderne Tischlerei sowie ein additives Fertigungslabor mit unterschiedlichen 3D-Druck-Technologien.
Im HolzBauForschungsZentrum will die Forschungsgruppe FLEX automatisierte Fertigungsstrategien entwickeln und realmaßstäblich prototypisch testen. Parametrische digitale Modelle spielen dabei eine zentrale Rolle, um alle Schritte vom Entwurf über die Planung bis zur effizienten Vorfertigung sowie Logistik und Montage auf der Baustelle lückenlos zu vernetzen. So soll das Bauen perspektivisch deutlich mehr von den positiven Effekten der Digitalisierung profitieren.
„Neben dem Hauptforschungsthema ergibt sich ein umfassender Forschungs- und Transferbedarf aus Informatik, Mathematik, Maschinenbau, Automatisierungstechnik und Wirtschaft. Das Prinzip der interdisziplinären Zusammenarbeit innerhalb der Hochschule – aber auch mit regionalen, nationalen und internationalen Wissenschafts- und Wirtschaftspartnern – wird damit zu einem wesentlichen wissenschaftlich-organisatorischen Grundbaustein des Projekts“, erklärt Stahr. Daneben sollen Fortbildungen zu aktuellen Forschungsergebnissen für Mitarbeitende aus Holzbau-Unternehmen und Baubehörden sowie für Fachleute aus Architektur und Ingenieurwesen angeboten werden.
Thomas Schmidt, Sächsischer Staatsminister für Regionalentwicklung: „In Nachhaltigkeit und Digitalisierung liegen die Schlüssel für Wettbewerbsfähigkeit und Regionalisierung im Bauwesen. Ich bin davon überzeugt, dass Sachsen in der ‚Bauwende‘ mit zuverlässigen Bauprodukten sowie praxisfähigen Produktions- und Fertigungsprozessen der nächsten Generation ganz vorn mitspielen kann, wenn Forschung, Unternehmen und Bauaufsichten intensiv miteinander kooperieren. Mit dem HolzBauForschungsZentrum entsteht im Innovationspark Bautechnik in Leipzig-Engelsdorf eine hochmoderne Forschungsstätte für die Erforschung und Weiterentwicklung von Produktionsverfahren für den Holzbau. Das Besondere an diesem Standort ist die Möglichkeit, mit den ansässigen Prüfanstalten die Innovationen schnell und direkt in den Markt zu bringen. Diese gelebte Kooperation ist ein echter Wettbewerbsvorteil und stärkt unsere regionale Wirtschaft.“
Prof. Dr. Mark Mietzner, Rektor der HTWK Leipzig: „In den vergangenen fünf Jahren ist die Hochschule wichtige Partnerschaften mit der regionalen Wirtschaft eingegangen, wodurch das HolzBauForschungsZentrum erst möglich wurde. Dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit dem Sächsischen Bau- und Immobilienmanagement (SIB) und der tatkräftigen Unterstützung durch die regionale Wirtschaft, kann heute der Grundstein für die Umsetzung dieses richtungsweisenden Vorhabens gelegt werden. Das Forschungszentrum unterstreicht die Rolle der HTWK Leipzig als Initiatorin von Innovationen und als Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Die Begeisterung und das Engagement unserer Forschenden, verbunden mit der praktischen Anwendung in der Region spiegeln die erfolgreiche Umsetzung meiner Strategie wider, die HTWK Leipzig als Zentrum für Wissenstransfer und Innovation in der Region und darüber hinaus zu positionieren."
Dr. Mathias Reuschel, Geschäftsführung der Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH (MFPA Leipzig GmbH) und Gründungsmitglied des Fördervereins HolzBauForschungsZentrum Leipzig: „Es freut mich sehr, dass durch das gemeinsame vertrauensvolle Handeln der Mandatsträger aus der regionalen Wirtschaft, der Wissenschaft und der Politik in kürzester Zeit die Idee eines Forschungszentrums Umsetzung findet. Im Sommer 2024 werden wir ein Zentrum einweihen, was in der Symbiose zwischen der HTWK und der MFPA den Strukturwandel, weg vom Kohleabbau hin zu einer gestärkten regionalen Holzwirtschaft, maßgeblich unterstützen wird. Genau so geht sächsisch“
Hintergrund zum Bauen mit Holz
Holz gilt als Hoffnungsträger, um die Baubranche nachhaltiger zu machen. In seiner Herstellung und Nutzung ist der traditionsreiche Baustoff klimafreundlicher als der energie- und ressourcenintensive Stahlbeton. Mit den sich verändernden gesellschaftlichen Zielen wächst die Nachfrage nach Holzbauten überdurchschnittlich stark. Gleichwohl sind die bekannten Konstruktionslösungen kaum geeignet, diese Bedarfe zu decken, da auch Holz als nachwachsender Rohstoff nur begrenzt zur Verfügung steht und die Konkurrenz um die industrielle Nutzung des Materials stark zunimmt. Es braucht daher zwingend neue Konzepte, um den wachsenden Bedarf mit deutlich weniger Holz decken zu können.
Der moderne Holzbau ist ein künftiges Innovationsfeld und Antrieb für die regionale Wertschöpfung. Deshalb hat die Sächsische Staatsregierung im Koalitionsvertrag vereinbart, den modernen Holzbau in Sachsen zu stärken. Die Sächsische Holzbauinitiative ist darauf ausgerichtet, für den Einsatz von Holz bei Bauprojekten zu werben, den Einsatz zu erleichtern und so die Nachfrage nach Bauholz in Sachsen zu erhöhen. Sie reiht sich ein und steht in Wechselwirkungen mit den nationalen und europäischen Strategien für eine sogenannte Bauwende: für klima- und ressourcenschonendere zirkuläre und serielle Bauweisen, für die Transformation des Gebäudebestandes bis zur Klimaneutralität und – nicht zuletzt – für bezahlbaren Wohnraum.
„Mit unserer Kampagne ‚SPIN2030. Wissenschaftsland Sachsen‘ zeigen wir erstmals die Breite und Leistungsfähigkeit der hochschulischen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen im ganzen Freistaat. Das Interesse unserer Einrichtungen, sich am Wissenschaftsfestival zu beteiligen, war riesig. Wir wollen für Wissenschaft und Forschung begeistern, zum Staunen bringen und auch zum Diskutieren einladen. Das Wissenschaftsland Sachsen hat sich inzwischen zu einer Marke entwickelt, die wir noch viel bekannter machen wollen – bei uns in Sachsen, aber auch weit darüber hinaus. Ich freue mich auf zwei Tage ganz im Zeichen der sächsischen Wissenschaft und lade herzlich dazu ein, vorbeizukommen“, so Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow.
Das Programm der HTWK Leipzig
Beim ersten gesamtsächsischen „Wissenschaftsfestival SPIN2030“ beteiligen sich auch mehrere Forschungsgruppen der HTWK Leipzig. Zum detaillierten Programm.
In der ersten Etage befinden sich auf der Sonderausstellungsfläche die Exponate der Forschungsgruppen Geotechnik und FLEX. Bei den Geotechnikerinnen und Geotechnikern können kleine und große Besucherinnen und Besucher auf einen interaktiven Sandkasten springen und dabei mehr zur Bodenverdichtung erfahren, denn die zentrale Frage hier ist: Welche Methode ist effektiver, Boden zu verdichten, ein Riesensprung oder eine Serie kleiner Sprünge? Daneben zeigt die Forschungsgruppe FLEX am Gemeinschaftsstand mit dem Laserinstitut der Hochschule Mittweida, wie mit einem neu entwickelten 3D-Druckverfahren ressourcenschonender gebaut werden kann.
Neben Exponaten gibt es hier auch einen Stand für das Format „Meet a Scientist“: Dr. Konstantin Weise, der die Vertretungsprofessur für Elektrotechnik innehat, erklärt, welche Rolle Elektrotechnik in den Neurowissenschaften spielt und Florian Junker vom Institut für Betonbau spricht darüber, wie sich die Gefahr von Rissen in Bodenplatten vermeiden lässt.
Von der Sonderausstellungsfläche gelangen die Gäste in das „Machwerk“ im Erdgeschoss. Hier gibt es vor allem Roboter zu bestaunen. Die HTWK Robots, die mit ihrer Nao-Fußballmannschaft 2023 deutscher Vizemeister geworden ist, zeigen ihr fußballerisches Können und demonstrieren, was Fußball und Künstliche Intelligenz bewirken. Nebenan baut ein Roboter der Forschungsgruppe Nachhaltiges Bauen und vom PAES | Institut für Prozessautomation und Eingebettete Systeme live vor Ort ein Gelege für ein Bauteil aus Carbonbeton – dem Baustoff der Zukunft. Aus diesem wurde bereits ein ganzes Haus gebaut, das mit einer VR-Brille vor Ort auch besichtigt werden kann. Der Werkstoff Carbonbeton kann aber noch viel mehr: Denn Bauteile aus Carbonbeton können auch Leuchten oder Heizen. Ein Bauteil, das leuchtet, ist vor Ort. Die Gäste können hier selbst herausfinden, wie es angeht, denn einen Lichtschalter gibt es nicht.
Science Night
Ein weiteres Highlight gibt es am Freitagabend: die Science Night im Emuanuel-Goldberg-Saal in der 5. Etage. Neben einer Podcast-Liveaufzeichnung, mehreren Science Slams, einem Quiz und einer Vorführung zur Forensik treten hier die HTWK Robots auf. Von 17:45 bis 18:15 Uhr geben sie eine weitere Show.
Das gesamte Programm
Insgesamt rund 50 wissenschaftliche Einrichtungen und Verbände beteiligen sich am ersten gesamtsächsischen Wissenschaftsfestival.
Wer gezielt die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Sachsen sucht, findet diese in der Nähe des Stands der HTWK Leipzig in der Sonderausstellungsfläche in der ersten Etage. Hier gibt es auch den Stand des Verbundprojektes Saxony5, in dem alle fünf HAW Mitglieder sind.
Öffnungszeiten:
- Freitag: 12-22 Uhr (inklusive Science Night)
- Samstag: 10-18 Uhr
Veranstaltungsort:
- Technische Sammlungen Dresden, Junghansstraße 1-3, 01277 Dresden
Die Leipziger Deponiefachtagung ist eine technisch-wissenschaftliche Veranstaltung mit Fachvorträgen. Die Tagung dient als Podium zur Diskussion technischer und rechtlicher Fragestellungen des Deponiebaus, der Kreislauf- und Abfallwirtschaft sowie des Umweltschutzes.
Sie richtet sich an Expertinnen und Experten aus Baubetrieben, Planung, Produktherstellung, Anlagenbetrieb, Forschung und Politik.
Wie hat sich die Tagung und die Themen in den letzten 20 Jahren entwickelt? Was sind heutige Herausforderungen?
Die Leipziger Deponiefachtagung begleitet die Entwicklungen im Bereich des Deponiebaus und der Abfallwirtschaft. Die anfänglichen Themen waren überwiegend an der Erfassung und Beseitigung der Abfälle orientiert. Heute stehen weitere Themen wie Abfallvermeidung, die stoffliche und energetische Verwertung des Abfalls und Nachhaltigkeit beim Umgang mit primären Stoffen im Mittelpunkt der Diskussionen. Diese schließt auch Regularien in der Abfallwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und den Umgang mit schwer abbaubaren Chemikalien und schwer recycelbaren Verbundstoffen ein.
Was erwartet die Gäste bei der 20. Ausgabe der Fachtagung?
Die HTWK Leipzig, der Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen und die Stadt Leipzig möchten im Jubiläumsjahr der Leipziger Deponiefachtagung hervorheben, welchen hohen Stellenwert der Umweltschutz im Deponiebau und in der Kreislauf- und Abfallwirtschaft hat.
Im Mittelpunkt der Vorträge stehen die gesetzlichen Regularien im Deponiebau und bei Geokunststoffen, der Einsatz von Ersatzbaustoffen in der Baubranche, der Umgang mit Deponiegas, Innovationen und Nachhaltigkeit im Deponiebau sowie die Schaffung von neuen Deponiekapazitäten. Auch Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung für Deponien werden diskutiert.
Schirmherr der 20. Leipziger Deponiefachtagung ist Bürgermeister Heiko Rosenthal, Vorsitzender des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Westsachsen und Beigeordneter für Umwelt, Klima, Ordnung und Sport der Stadt Leipzig.
Welche Rolle spielen Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Deponiebau?
Beide Themen sind nicht mehr aus unserem täglichen Handeln wegzudenken. Der Wirtschaftskreislauf, die Reduzierung von Treibhausgasen und Abfallmengen sind Hauptthemen der Tagung. Momentan wird das Deponieren als letzte Option in der Wertschöpfungskette angesehen. Jedoch bieten die heutigen Deponien immer noch den effektivsten Weg für eine umweltfreundliche Beseitigung von Schadstoffen aus der Natur. Nicht zu Unrecht werden die Deponien öfter als Schadstoffsenken bezeichnet.
Wie viel Platz haben wir noch für Deponien und welche Orte sind dafür geeignet?
Geeignete Standorte sind wegen der hohen Umweltauflagen und der konkurrierenden Nutzungen tatsächlich rar geworden. Zurzeit sind ehemalige Steinbrüche als Deponiestandort geeignet. Auch das Prinzip „Deponie auf Deponie“, also der Bau einer neuen Deponie auf einer alten Deponie sowie die Erweiterung von vorhandenen Deponien sind möglich.
Die HTWK Leipzig fungiert als Gastgeberin und Tagungsort. In welchen Studiengängen und Forschungsprojekten werden Deponien thematisiert?
Im Bachelorstudium Bauingenieurwesen werden die Studierenden in die Thematik Abfallwirtschaft eingeführt. Im Masterstudium der Studiengänge Bauingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen wird vertieftes Wissen im Deponiebau und Altlastensanierung vermittelt. Forschungsprojekte zu den Themen Deponiegas, alternative Abdichtungssysteme sowie zur Kapazitätserweiterung von vorhandenen Deponien sind Gegenstand von abgeschlossenen und noch laufenden Forschungsprojekten.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Katrin Haase.
Mehr Informationen zur Tagung finden Sie unter deponiefachtagung.de
Zahlreiche Referentinnen und Referenten bieten Einblicke in ambitionierte Bauprojekte, komplexe Vorschriften und neue Technologien. An ausgewählten praktischen Beispielen stellen sie innovative Lösungsansätze vor und informieren über aktuelle Normenänderungen. Zudem werden Erfahrungen aus einem Schadensfall, Erkenntnisse aus dem Bereich der angewandten Forschung und ausgewählte vergaberechtliche Fragen des Erdbaus vorgestellt und diskutiert.
Die Fachtagung wird von einer Fachausstellung und der traditionellen Abendveranstaltung umrahmt. Die Erdbaufachtagung wird seitens der Architektenkammer Sachsen und der Ingenieurkammer Sachsen als Weiterbildung anerkannt.
Mehr Informationen zum Programm finden Sie auf der Website der Bauakademie Sachsen
Mit der Förderung stärkt die Hochschule ihre jahrelange Expertise im Bereich der additiven Fertigung. Bei diesem Verfahren werden Materialien wie Polymere, Zellkulturen, Hydrogele oder Metalle Schicht für Schicht aufgetragen, um dreidimensionale Gegenstände zu erzeugen. Andere gängige Bezeichnungen sind 3D-Druck oder englisch „additive manufacturing“. Der 3D-Druck findet in zahlreichen Lehr- und Forschungsbereichen der HTWK Leipzig Anwendung, darunter im Maschinenbau, im Leichtbau, in der Druck- und Verpackungstechnik, in der Architektur, im Bauwesen sowie in der Elektro- oder Energietechnik. „Der Vorteil des 3D-Drucks im Vergleich zu konventionellen Fertigungsverfahren resultiert aus seiner Multifunktionalität, die in einem einzigen Fertigungsschritt umsetzbar ist. Nahtlos können mehrere Materialien miteinander gedruckt werden, die verschiedene Eigenschaften und Funktionen kombinieren und die Produkte somit ‚smart‘ machen“, so Reinhold, der das Förderprojekt verantwortet und mehr als 15 Jahre Expertise aus der Inkjet- bzw. Tintenstrahl-Technologie einbringt.
Neben Reinhold sind am Förderprojekt beteiligt: Prof. Fritz Peter Schulze (Professur für Werkzeugmaschinen und Fertigung), Prof. Lutz Engisch (Professur für Werkstoffe), Prof. Paul Rosemann (Professur für Werkstofftechnik) und Prof. Faouzi Derbel (Professur für Smart Diagnostik und Online Monitoring).
Moderne Forschungsgeräte für den 3D-Druck
Konkret gehört zu den neuen Großgeräten ein 3D-Drucker mit Powderbed-Fusion/IR-3D-Drucksystem. Dieser kann verschiedene Pulver und Tinten durch Wärmestrahlung miteinander verschmelzen und neben der mechanischen Funktion des Bauteils auch lokal Eigenschaften definiert verändern. So können Forschende beispielsweise mit Nanopartikeln elektrische Leiter oder Sensorik in mechanische Strukturen einbringen.
Ein weiterer 3D-Drucker ist für medizinische Anwendungen vorgesehen. Er ermöglicht das Drucken komplexer Materialkombinationen in Pastenform, die über die verschiedenen Druckköpfe eingespeist werden. Biomedizinerinnen und Biomedizinern erlaubt das Verfahren zum Beispiel, Knochenimplantaten Arzneimittel beizugeben, damit diese vom Körper besser angenommen werden.
Mit einem weiteren Großgerät, dem Präzisionsrheometer, analysieren die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Fluss von Pulvermaterialien, um die Geschwindigkeit und Präzision der Prozesse weiter zu optimieren.
Forschungsbereich Multimaterial-Additive-Manufacturing
Die neuen Großgeräte sind im Forschungsbereich Multimaterial-AM angesiedelt. AM steht für „additive manufacturing“. Hier werden fakultätsübergreifend Forschungsideen generiert, Synergien identifiziert und die Nutzung der Geräte für interessierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der HTWK Leipzig sowie für Externe ermöglicht.
Zudem verbindet der Forschungsbereich Multimaterial-AM das fakultätsübergreifende Kompetenzzentrum für Werkstoffforschung mit dem Institute for Printing, Packaging und Processing (iP3) an der Fakultät für Informatik und Medien, das bereits seit Jahren die Anwendung additiver Fertigungsverfahren im Rahmen der klassischen Druck- und Verpackungstechnik erforscht. Im Bereich der Werkstoffforschung konnte bereits in der ersten Förderung der DFG-Großgeräteaktion eine Förderung von rund einer Million Euro eingeworben und davon ein Rasterelektronenmikroskop und ein Computertomograph beschafft werden.
Prof. Dr. Mark Mietzner, Rektor der HTWK Leipzig: „Die HTWK Leipzig hat als forschungsstarke Hochschule in den vergangenen Jahren immer wieder neue Drittmittelrekorde eingeworben, zuletzt 2022 mit insgesamt 21,12 Millionen Euro. Deshalb freut mich die zweite Förderung innerhalb der DFG-Großgeräteaktion umso mehr, denn so kann das neue Jahr bereits mit einer ganz besonderen Erfolgsmeldung beginnen. Insbesondere freut es uns, dass wir als Hochschule für Angewandte Wissenschaften unsere DFG-Förderungen ausbauen können und unsere Leistungen auf dem Gebiet des 3D-Drucks entsprechende Anerkennung erfahren.“
Prof. Dr. Faouzi Derbel, Prorektor für Forschung und Nachhaltigkeit der HTWK Leipzig: „Die zweite DFG-Förderung von Großgeräten freut uns sehr. Die neuen Geräte im Forschungsbereich Multimaterial-AM können dazu beitragen, das Ingenieurwesen zu transformieren, ähnlich wie es beispielsweise der Einsatz von KI oder Big Data machen kann, denn additive Fertigung hat das Potenzial, mit neu kombinierten Materialien gänzlich neue Lösungen zu erschaffen.“
Hintergrund zur DFG-Förderung
Mit der Förderung unterstützt die DFG Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, indem sie die vorhandene Geräteinfrastruktur ergänzt und vorhandene Forschungsschwerpunkte gezielt fördert. In der dritten und damit letzten Ausschreibungsrunde wurden in einem Begutachtungsprozess der DFG aus 65 beantragenden Hochschulen lediglich 16 für die Förderung ausgewählt.
Neben namhafter Repräsentanten verschiedener akademischer Institutionen und des Ministers für höhere Bildung und Wissenschaft besuchte auch der deutsche Botschafter in Marokko, Robert Dölger, den Konferenzauftakt.
Zunächst stellten Referenten Best-Practice-Beispiele einer internationalen Zusammenarbeit mit verschiedenen afrikanischen Hochschulen vor. Darauf aufbauend diskutierten die Konferenzteilnehmer darüber, welche Aspekte die Hochschulbildung bereits abbildet, welche Erfahrungen aus afrikanischen Nationen und Industrien vorhanden sind, und wie die Einstellung junger Menschen in Unternehmen direkt nach dem Abschluss die zukünftige Lehre beeinflussen wird. Dabei beleuchteten sie besonders, welche Diskrepanzen sich aus der theoretischen Ausbildung und der Praxis in der Industrie sowohl in Deutschland als auch in den Partnerländern ergeben.
]]>„Der Anteil der seriell gebauten Bauteile nimmt derzeit deutlich zu“, erläutert Prof. Dr. Klaus Holschemacher, Direktor des Instituts für Betonbau (IfB) an der HTWK Leipzig, im Interview ab Minute 2:00 des Berichts und erläutert die Gründe: „Wir haben Kostenvorteile, wir haben Effizienzvorteile, wir sparen Material ein.“
Mit der IfB-Forschungsgruppe „Nachhaltiges Bauen“ und zahlreichen Forschungspartnern setzt er sich im Carbonbetontechnikum in Leipzig-Engelsdorf dafür ein, den im Vergleich zum Stahlbeton ressourcenfreundlicheren Carbonbeton in die praktische Anwendung zu bringen. Regelmäßig laden die Forschenden Interessierte ein, um zu zeigen, wie ein Betonwerk seine Produktionsstätten umbauen muss, um serielle oder individuelle Carbonbetonbauteile herzustellen.
Beitrag auf MDR Umschau
Dieser Link führt zum Beitrag in der ARD Mediathek, der dort bis zum 8. Januar 2025 sichtbar ist. Erstmals ausgestrahlt wurde der Bericht von Thomas Falkner am 9. Januar 2024 im MDR Fernsehen.
Ergänzung vom 23.1.24:
Beitrag im RTL Nachtjournal
Auch im RTL Nachtjournal ist in der Sendung vom 17. Januar 2024 ab Minute 15:00 das Carbonbetontechnikum zu sehen. Dieser Link führt zur Sendung auf RTL Plus.
Wer an geotechnischen Entwicklungen interessiert ist, kann im Januar an zwei Fachvorträgen des 15. Geotechnikseminars an der HTWK Leipzig teilnehmen. Die Vorträge von und für die Bauwirtschaft sollen neue Einblicke sowie Raum für Fragen und Diskussionen bieten. Zugleich fördern sie die Vernetzung zwischen Wissenschaft und Praxis und sollen zum Wissensaustausch zwischen Unternehmen, Forschenden und Studierenden anregen.
Die nächsten Termine und Themen
Am 10. Januar 2024 referiert Ingenieur Lutz Roßteuscher von der DB Netz AG über „Tunnelbau bei der Deutschen Bahn“ und wird über Neubau und Bestand berichten. Seitens der Geotechnik verbessert der Bau von Tunneln die Infrastruktur, denn durch Tunnel können Straßen, Schienenwege sowie Wasser- und Abwasserleitungen unter Hindernissen wie Bergen, Flüssen und städtischen Gebieten hindurchführen. So können große Umwege und zugleich Ressourcen vermieden werden.
Zwei Wochen später, am 24. Januar 2024, spricht die Geologin Ulrike Nohlen von der Firma MTS Schrode AG Hayingen über „Building Information Modeling (BIM) in der Geotechnik – digital vom geologischen Modell über Homogenbereiche bis in Ersatzbaustoffkataster“. Mit BIM ist auch in der Geotechnik eine ganzheitliche Planung und Koordination möglich. Durch einen effizienteren Datenaustausch fördert BIM so die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Projektbeteiligten und ermöglicht eine präzisere Entscheidungsfindung sowie die Optimierung von Bauabläufen. Die frühzeitige Identifikation von Risiken und die Möglichkeit zur Kosteneinsparung durch präzise Planung tragen schließlich zu effizienteren, kosteneffektiveren und nachhaltigeren Bauprojekten bei.
Teilnahme am Geotechnikseminar an der HTWK Leipzig
Beginn des Geotechnikseminars ist jeweils 17:15 Uhr im Trefftz-Bau (ehemaliges HfTL-Gebäude in der Gustav-Freytag-Straße 43), Raum 2.28 (2. Stock) / Haus A.
Eine Online-Teilnahme ist über Zoom möglich (je 17:00 bis 19:00 Uhr, https://htwk-leipzig.zoom.us/j/4450471709 Meeting-ID 445 047 1709).
Das Geotechnikseminar wird bei der Ingenieurkammer Sachsen als Weiterbildungsveranstaltung angemeldet; ein Fortbildungsnachweis kann erstellt werden.
Die Teilnahme ist kostenlos.
Geowissenschaften an der HTWK Leipzig
Die Geowissenschaften an der HTWK Leipzig sind als interdisziplinäres Team aus den Bereichen Bauingenieurwesen, Maschinenbauingenieurwesen, Geografie und Geologie aufgestellt. Sie beschäftigt sich mit Themen der Makro- und Mikromechanik von Böden und übertragen ihre Ergebnisse auf praktische Bauprozesse und aktuell relevante Querschnittsthemen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der Geotechnik.
Die Geowissenschaften sind zudem Mitglied im Transferverbund Saxony⁵ der fünf sächsischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Im Teilprojekt „Nachhaltiges Bauen“ werden Forschungsergebnisse am GeoTechnikum ‒ einem Experimentier- und Demonstrationsraum mit Freiversuchsflächen und einem bodenmechanischen Forschungslabor ‒ in großem Maßstab validiert und für Partner aus Praxis und Wissenschaft demonstriert.
HTWK Leipzig beim Sächsischen Transferforum
Zu den Ausstellenden gehörten auch Vertreterinnen und Vertreter der HTWK Leipzig: Am Messestand der Hochschule waren Startbahn 13, die Gründungsberatung der HTWK Leipzig, sowie die Forschungsgruppe FLEX anwesend. Yvonne Hahn, Gründungsberaterin der Startbahn 13 resümiert: „Das Transferforum bot für uns eine gute Gelegenheit, zu zeigen, dass eine Ausgründung eine hervorragende Möglichkeit ist, aus der Forschung gewonnene Erkenntnisse in die praktische Anwendung zu überführen.“
Die Forschungsgruppe FLEX präsentierte dort parametrisch definierte Knotenelemente zur Anwendung im Stahl-, Fassaden- und Anlagenbau. In einer mehr als dreijährigen Zusammenarbeit entwickelte FLEX gemeinsam mit dem Laserinstitut Hochschule Mittweida eine parametrische Planungsmethodik und ein neues Verfahren für den 3D-Druck (Makro-SLM). Durch die lückenlose Verknüpfung von digitalen Planungs- und Ausführungsprozessen können Material, Personal und Zeit gespart und individuelle großformatige Bauteile für praxisrelevante Anwendungen automatisiert sowie qualitativ hochwertig gefertigt werden.
Darüber hinaus informierte FLEX-Mitarbeiter Martin Dembski am Stand über das geplante Holzbauforschungszentrum. Dieses soll ab Juli 2024 im Leipziger Stadtteil Engelsdorf entstehen und ist inhaltlich der fertigungsbezogenen Forschung mittels individualisierter Automatisierung gewidmet. Das Projekt basiert auf einer mittlerweile rund 10-jährigen Expertise im Kontext der Entwicklung digitaler Strategien für das Bauen mit Holz. Die Vision des Leiters der Gruppe, Prof. Alexander Stahr, zielt auf die Etablierung einer ressourcenschonenden und auf einer werkstattgestützten Vorfertigung beruhenden Bauweise. Auf der Basis eines ganzheitlichen Ansatzes unter expliziter Berücksichtigung der Kompetenzen und Strukturen des Zimmererhandwerks sollen dabei regionale Stoff- und Wirtschaftskreisläufe gestärkt sowie Forschung und Ausbildung intensiver miteinander vernetzt werden. „Hier bei futureSAX konnten wir mit vielen kleinen und mittleren Unternehmen aus der Region in Kontakt kommen, die ebenfalls mit Holz arbeiten, und sie über unsere aktuellen Forschungsergebnisse und Entwicklungen informieren“, sagt Martin Dembski von der Forschungsgruppe FLEX der HTWK Leipzig.
Im Kontext des Klimawandels, der stetig wachsenden Bevölkerungszahlen und der Endlichkeit natürlicher Ressourcen steht die Welt vor immensen Herausforderungen. Gesucht und gefragt sind mehr denn je Lösungsansätze, welche helfen, das gestörte natürliche Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage wiederherzustellen. Die Bauwirtschaft steht dabei in einer besonderen Verantwortung, denn sie schafft das infrastrukturelle Rückgrat unserer Gesellschaft. Gleichsam ist sie der größte Verbraucher materieller Ressourcen und für einen immensen Anteil der Treibhausgasemissionen verantwortlich.
In diesem Zusammenhang ist das Bauen mit nachhaltigen und nachwachsenden Rohstoffen zunehmend deutlicher nachgefragt. Der Holzbau erlebt eine Renaissance, nicht zuletzt wegen seines immensen Einsparpotentials in Bezug auf CO2. Gleichsam braucht es jedoch zwingend und zeitnah neue Ideen und Ansätze um Planung- und Ausführungsprozesse besser zu verzahnen und darauf aufbauend zum einen die Wettbewerbsfähigkeit der Bauweise und zum anderen die Attraktivität für potenzielle Bauherren zu erhöhen.
Einladung zum Werkstattgespräch: Lösungsansätze diskutieren
Über mögliche Lösungsansätze reden am Donnerstag, den 16. November 2023, ab 18 Uhr vier Experten beim Werkstattgespräch „Forum Holz“ im Zentrum für Baukultur Sachsen im Kulturpalast (ZfBK) im Dresden mit den anwesenden Gästen. Dort wird noch bis Anfang Dezember die HTWK-Ausstellung „SHAPING TOMORROW – Lehm und Holz neu gedacht“ präsentiert. Zu den anwesenden Experten gehören:
- Olaf Reiter, Architekt BDA, und Inhaber der Reiter Architekten GmbH,
- Ludwig Hahn, Zimmerermeister und Gesamtgeschäftsführer der Tischlerei & Zimmerei Auerbach und Hahn,
- Dominic Steinhäuser, Bauleiter bei Bennert GmbH, sowie
- Marius Zwigart, Architekt und stellvertretender Leiter der Forschungsgruppe FLEX an der HTWK Leipzig.
Diese halten zunächst Impuls-Vorträge, im Anschluss ist die Diskussion für alle geöffnet. Der Eintritt zum Werkstattgespräch ist frei.
„SHAPING TOMORROW – Lehm und Holz neu gedacht“ ist eine Ausstellung der Fakultät Architektur & Sozialwissenschaften der HTWK Leipzig. Noch bis zum 2. Dezember 2023 bietet sie Einblicke in Lehr- und Forschungsaktivitäten in den Architekturstudiengängen an der HTWK Leipzig. Präsentiert werden Pavillonentwürfe von Masterstudierenden für das Sächsische Staatsweingut Schloss Wackerbarth.
Weitere Termine der Forschungsgruppe FLEX in Leipzig
Interessierte sind zudem zu zwei weiteren Expertengesprächen mit der Forschungsgruppe FLEX der HTWK Leipzig eingeladen: Am Montag, den 13. November 2023, laden die Forschenden zur Vortragsreihe „FLEX meets …“ ein. Diesmal ist Jan Knippers zu Gast. Er leitet das Institut für Tragkonstruktionen und Konstruktives Entwerfen (ITKE) an der Universität Stuttgart und spricht über „Integriertes Computerbasiertes Planen und Bauen für eine ressourceneffiziente Architektur“, denn in Zeiten wachsenden Handlungsdrucks durch Klimaveränderungen sowie interne und externe Migration bedarf es neuer Bauweisen, um die wachsenden Bedarfe mit geringerem Ressourceneinsatz decken zu können. Beginn ist 18 Uhr im Lipsius-Bau der HTWK Leipzig (4. OG, Li415). Bereits ab 17 Uhr gibt es einen Empfang mit Getränken und Snacks im Foyer der Architekturetage.
Am Donnerstag, den 16. November 2023, findet außerdem wieder das interaktive Gesprächsformat „EASTWOOD.talks“ statt. Professor Alexander Stahr, Leiter der Forschungsgruppe FLEX der HTWK Leipzig spricht ab 16 Uhr mit Hannsjörg Pohlmeyer, dem Projektleiter des Holzbaucluster Rheinland-Pfalz, der sich im Rahmen der Charta für Holz engagiert. Sein Thema „Serielles Sanieren – keine Angst vor schicken Start-ups – Holzbau-Kernkompetenz zieht!“. Eine Teilnahme ist sowohl vor Ort als auch online per Stream möglich. Die Teilnahme ist dieses Mal kostenfrei, um Anmeldung wird gebeten.
Die Forschungsgruppe FLEX an der HTWK Leipzig
Die Forschungsgruppe FLEX ist ein interdisziplinäres Team aus Architektur, Bau- und Wirtschaftsingenieurwesen sowie studentischen Mitarbeitenden unter der Leitung von Prof. Alexander Stahr. FLEX forscht zur digitalen Verknüpfung von Planungs- und Ausführungsprozessen, mit dem Ziel, Ressourcen in Architektur und Bautechnik effizienter zu nutzen. Die Forschungsgruppe ist zudem Mitglied im 2018 gestarteten Transferverbund Saxony⁵ der fünf sächsischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften sowie Mitglied der „International Association of Shell and Spatial Structures“ (IASS) und des internationalen Forschungsnetzwerks „Robots in Architecture“ (RiA).
Das Einsatzfeld des industriellen 3D-Drucks wächst: Um sich über neue Entwicklungen auszutauschen, treffen sich vom 7. bis 10. November 2023 in Frankfurt am Main wieder über 840 Ausstellerinnen und Aussteller und voraussichtlich mehr als 30.000 Besucherinnen und Besucher. Mit dabei ist erstmals auch die Forschungsgruppe FLEX der HTWK Leipzig auf der Sonderschau des BE-AM-Netzwerks der TU Darmstadt (Halle 11, Stand F49). „Die formnext ist die größte Bühne für moderne, intelligente, auf dem Prinzip des 3D-Drucks basierende Fertigungslösungen in Deutschland. Hier können wir – gemeinsam mit 9 namhaften Firmen der Branche, 9 Universitäten und 2 Forschungseinrichtungen – unsere neuesten Forschungsergebnisse einem breiten Publikum präsentieren“, so Alexander Stahr, Professor für Tragwerkslehre und Leiter der Forschungsgruppe FLEX an der HTWK Leipzig.
Vorstellung des weiterentwickelten ParaKnot3D-Knoten
Auf der formnext-Messe stellt die Forschungsgruppe FLEX ihren weiterentwickelten ParaKnot3D-Knoten vor. ParaKnot3D ist ein Konzept zur bidirektionalen Verschränkung von Parameter gestützten Planungstools und additiven Fertigungsverfahren. Das Besondere an dem ausgestellten individuellen Knotenelement aus Stahl ist das „Makro-SLM“-Fertigungsverfahren, welches in Zusammenarbeit mit dem Laserinstitut Hochschule Mittweida entwickelt wurde. Die auf dem Prinzip des „Selektive-Laser-Melting (SLM)“ basierende 3D-Druck-Technologie reduziert die Materialkosten um 90 Prozent und verkürzt die Druckzeit für Bauteile durch eine deutliche höhere Aufbaurate in signifikantem Maße. FLEX zeichnet in der Kooperation für die Entwicklung parametrisierter Geometrie-Modelle verantwortlich. Die Verfahrensentwicklung liegt beim Team von Prof. Dr. André Streek am Laserinstitut Hochschule Mittweida.
Das neu entwickelte Verfahren wurde für die Anwendung im „architektonisch-bautechnischen Maßstab“ entwickelt. Es ist daher vor allem für makroskopische Bauteile attraktiv. Mit der Möglichkeit, nun mit erheblicher Kosten- und Zeitersparnis Knotenelemente aus Stahl zu fertigen, sind die Konstruktionselemente vor allem für den Stahlbau interessant, denn diese sind stark belastbar, einsatzfähig und individuell. Zugleich sind sie wirtschaftlich, denn das 3D-Druck-Verfahren senkt den Materialverbrauch und die Materialkosten, steigert dadurch den Materialumsatz während des Prozesses erheblich und reduziert zudem die Druckzeit um ein Vielfaches.
Perspektivisch wollen die Forschenden das System weiterentwickeln und verlässliche Prüfverfahren erarbeiten, um schlussendlich Zulassungen für die so herstellbaren Bauteile zu erwirken, damit diese dann in der Praxis verwendet werden können.
Forschungsgruppe FLEX mit Know-how im 3D-Druck und in digitaler Fertigung
Die Forschungsgruppe FLEX an der HTWK Leipzig ist ein interdisziplinäres Team aus Architekten sowie Bau- und Wirtschaftsingenieuren. Unter Leitung von Prof. Alexander Stahr ist die Forschung zur digitalen Verknüpfung von Planungs- und Ausführungsprozessen – mit dem Ziel, Ressourcen in Architektur und Bautechnik effizienter zu nutzen, – das wissenschaftliche Kernthema des 13-köpfigen Teams. Die Forschungsgruppe FLEX ist Mitglied im Transferverbund Saxony⁵ der fünf sächsischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften und erweitert diesen durch ihr Know-how auf den Gebieten 3D-Druck und digitale Fertigung, nachhaltige Konstruktionen und parametrisches Design in der Architektur. An den Verbund können sich Akteurinnen und Akteure aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft wenden, um Forschungs- und Entwicklungsprojekte in unterschiedlichen Bereichen zu realisieren.
Es war ein Tag, der ganz im Sinne des Wissens- und Technologietransfers stand: Beim Jahrestreffen am 23. Oktober 2023 des Transferverbundes Saxony⁵ trafen sich Forschende und Mitarbeitende sowie externe Gäste aus Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft im Carbonbetontechnikum der HTWK Leipzig und blickten zurück auf das endende erste Jahr der zweiten Projektphase.
Was das Ziel des Transferverbundes ist, erklärte Saxony⁵-Projektgeschäftsführerin Susanne Stump im einführenden Pitch: „Mit dem Transferverbund wollen wir die Vernetzung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft unterstützen, die Anzahl an Kooperationen erhöhen und die Verwertung von Forschungsergebnissen steigern. So werden einerseits die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Sachsen und ihre Forschungsergebnisse noch sichtbarer und andererseits wird es für Unternehmen einfacher, Zugang zu Forschungsergebnissen zu erhalten. – Kurzum: Das ist gelebter Wissens- und Technologietransfer, den wir im Verbund stärken wollen.“
Pitches, Ausstellungen und Exponate
Zur besseren internen Vernetzung fand am Vormittag zunächst ein Treffen für alle Saxony⁵-Projektbeteiligten statt. Diese kamen aus den Verbund-HAW in Leipzig, Dresden, Mittweida, Zittau/Görlitz und Zwickau. In Pitches stellten Vertreterinnen und Vertreter der Teilprojekte aus den Anwendungsbereichen Produktion, Umwelt und Energie ihre ersten Transferergebnisse vor. Beispielsweise berichtete Jessica Haustein aus dem Teilprojekt „Resiliente Fertigung“, an dem auch die HTWK Leipzig beteiligt ist, wie resiliente, menschenzentrierte Fertigungsszenarien unter Verwendung modernster IoT-Technologien realisiert und zugänglich gemacht werden sollen. Um Unternehmen und andere Interessierte darüber zu informieren, werden unter anderem regelmäßig Führungen durch die „Industrie 4.0 Modellfabrik“ an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden durchgeführt.
Während einer ausgedehnten Mittagspause blieb den Anwesenden ausreichend Zeit, um sich in einer Posterausstellung über die Teilprojekte zu informieren und um verschiedene Exponate auszuprobieren. So erklärte zum Beispiel Lars Baldauf vom Teilprojekt „Ökologische Gewässerentwicklung“ an Hand eines kleinen Modells einer bepflanzten Schwimminsel, wie solch schwimmende Vegetationsbestände als naturnahe Habitatstrukturen den ökologischen Zustand von Gewässern verbessern können. Die Forschungsgruppe FLEX der HTWK Leipzig bot zudem einen Rundgang zum Zollingerdach an, das sich nur wenige Meter entfernt vom Veranstaltungsort befindet. Marius Zwigart brachte den Gästen dort nahe, was das besondere an den gekrümmten Holzdächern ist und wie die Forschungsgruppe der Bauweise mit Digitalisierung neues Leben eingehaucht hat.
Vorträge, Diskussionen und Vorführungen unter dem Motto „Nachhaltiges Bauen“
Der Nachmittag stand unter dem Motto „Nachhaltiges Bauen“ – passend zum besonderem Veranstaltungsort, dem Carbonbetontechnikum der HTWK Leipzig – denn nachhaltiges Bauen hat das Ziel, den enormen Energie- und Ressourcenverbrauch, den die Bauindustrie verursacht, zu reduzieren. Dazu beitragen kann die Verwendung des noch recht neuen Werkstoff Carbonbeton. Über die technischen und wirtschaftlichen Aspekte des Bauens mit Carbonbeton sprach Dr. Frank Schladitz, Geschäftsführer des Verbands „C³ – Carbon Concrete Composite“, im einführenden Vortrag. Anschließend erklärte Dr. Alexander Kahnt vom Institut für Betonbau (IfB) der HTWK Leipzig, wie im Carbonbetontechnikum nachhaltige Baukonstruktionen für die Zukunft entstehen, denn in der weltweit einzigartigen Modellfabrik für Carbonbeton am Standort in Leipzig-Engelsdorf wird die automatisierte Fertigung von Carbonbetonbauteilen erprobt. Eine Live-Demonstration der Anlage folgte durch IfB-Mitarbeiter Otto Grauer.
Um jedoch eine größere Bandbreite rund um das „Nachhaltige Bauen“ zu bieten, gab es noch weitere Vorträge am Nachmittag, die gespannt von den Anwesenden verfolgt worden sind, darunter Gäste vom sächsischen Wissenschaftsministerium, vom sächsischen Ministerium für Regionalentwicklung, von der Handwerkskammer Dresden sowie weiteren kleinen und mittleren Unternehmen. Unter anderem sprach Philipp Thiem vom Institut für Textil- und Ledertechnik der Westsächsischen Hochschule Zwickau über die Entwicklung von Flächenelektroden aus Karbon für elektrochemische Applikationen im Bauwesen, Professor Robert Böhm von der HTWK Leipzig präsentierte das EU-Forschungsprojekt iClimabuilt mit der Vision von Nullenergiegebäuden und Alexander Knut von den Geowissenschaften der HTWK Leipzig erklärte, wieso nachhaltiges Bauen bereits im Boden beginnt.
Mehr zum Transferverbund Saxony⁵ und zu den Teilprojekten auf der Webseite: https://saxony5.de/
Die Geotechnik ist im Wandel: Aktuelle Herausforderungen, wie das Monitoring von Gefährdungsbereichen in Tagebaufolgelandschaften, die dauerhafte Überwachung von kritischer Straßen-Infrastruktur oder die messtechnische Begleitung des Herstellungsprozesses im Erdbau fordern interdisziplinär erarbeitete Lösungsansätze. Neben einer guten messtechnischen Lösung ist vor allem clevere Dateninterpretation gefragt, um den Anwenderinnen und Anwendern praxisnahe Kennwerte zu liefern. Im Rahmen des 15. Geotechnikseminars stellen Vanessa Fock und Hermann Busse von der HTWK Leipzig im ersten Vortrag der Reihe Ansätze ihrer aktuellen Forschung zur Geomesstechnik vor.
Die Anwendungspotenziale beleuchten die HTWK-Forschenden am Beispiel eines fiktiven Bauprojekts. Dabei zeigen sie, wie großflächig angelegte Verdichtungsmaßnahmen durch Drohnenbeflug bewertet weden können oder wie ein neues Online-Monitoring-System im Straßenoberbau die echte Beanspruchung einer Straße dauerhaft erfasst. „Durch den zielgerichteten Einsatz von Geomesstechnik können wir bereits im Prozess erkennen, wo Handlungsbedarf besteht und zielgerichtet den Bauablauf anpassen, um somit ressourcen- und zeiteffizient zu bauen“, sagt Fock.
Das Geotechnikseminar an der HTWK Leipzig
Der Vortrag der beiden Forschenden ist der Auftakt des nunmehr 15. Geotechnikseminars. Bei diesem werden Fachvorträge von der Bauwirtschaft für die Bauwirtschaft gehalten. Diese sollen neue Einblicke sowie Raum für Fragen und Diskussionen bieten. Zugleich fördern diese die Vernetzung zwischen Wissenschaft und Praxis und sollen zum Wissensaustausch zwischen Unternehmen, Forschenden und Studierenden anregen.
Im Wintersemester 2023/24 geht es um neue Ansätze und Methoden in der Geomesstechnik (1.11.), geotechnische Herausforderungen bei der Sanierung der Nordböschung im Restlochkomplex Mücheln (15.11.), Echtzeitmodellierung der Materialverteilung in Kippen des Braunkohlenbergbaus (6.12.), Tunnelbau bei der Deutschen Bahn (10.1.) sowie Building Information Modelling (BIM) in der Geotechnik (24.1.).
Beginn ist jeweils 17:15 Uhr im Trefftz-Bau (ehemaliges HfTL-Gebäude in der Gustav-Freytag-Straße 43), Raum 2.28 (2. Stock) / Haus A.
Eine Online-Teilnahme ist über Zoom möglich (je 17:00 bis 19:00 Uhr, https://htwk-leipzig.zoom.us/j/4450471709 Meeting-ID 445 047 1709).
Das Geotechnikseminar wird bei der Ingenieurkammer Sachsen als Weiterbildungsveranstaltung angemeldet; ein Fortbildungsnachweis kann erstellt werden.
Die Geowissenschaften an der HTWK Leipzig
Die Geowissenschaften an der HTWK Leipzig sind als interdisziplinäres Team aus den Bereichen Bauingenieurwesen, Maschinenbauingenieurwesen, Geografie und Geologie aufgestellt. Sie beschäftigt sich mit Themen der Makro- und Mikromechanik von Böden und übertragen ihre Ergebnisse auf praktische Bauprozesse und aktuell relevante Querschnittsthemen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der Geotechnik.
Die Geowissenschaften sind zudem Mitglied im Transferverbund Saxony⁵ der fünf sächsischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Im Teilprojekt „Nachhaltiges Bauen“ werden Forschungsergebnisse am GeoTechnikum ‒ einem Experimentier- und Demonstrationsraum mit Freiversuchsflächen und einem bodenmechanischen Forschungslabor ‒ in großem Maßstab validiert und für Partner aus Praxis und Wissenschaft demonstriert.
Im Rahmen der Ausstellung „SHAPING TOMORROW – Lehm und Holz neu gedacht“ werden sich am Donnerstag, den 26. Oktober 2023, dazu Expertinnen und Experten austauschen: In vier kurzen Vorträgen werden sie beim „Forum Lehm“ inhaltlich unterschiedlich gelagerte Perspektiven auf das Bauen mit Lehm in der Gegenwart und in der Zukunft geben. Im Anschluss soll Raum und Zeit für einen intensiven Gedanken- und Erfahrungsaustausch aller Teilnehmenden des Werkstattgesprächs sein. Mit dabei ist unter anderem Alexander Stahr, Professur für Tragwerkslehre an der HTWK Leipzig und Leiter der interdisziplinären Forschungsgruppe FLEX.
Die Ausstellung „SHAPING TOMORROW – Lehm und Holz neu gedacht“
Die Ausstellung „SHAPING TOMORROW – Lehm und Holz neu gedacht“ bietet Einblicke in Lehr- und Forschungsaktivitäten in den Architekturstudiengängen an der HTWK Leipzig. Präsentiert werden Pavillonentwürfe von Masterstudierenden für das Sächsische Staatsweingut Schloss Wackerbarth. In dem Seminar war der Fokus auf den Einsatz der Baustoffe Lehm und Holz als umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Materialien gerichtet. In einem inhaltlich eng angebundenen Seminar mit konzeptionell wissenschaftlicher Ausrichtung und mit technischer Unterstützung der Forschungsgruppe FLEX entwickelten die Studierenden parallel zu den Pavillon-Entwürfen digitale Konzepte für Stampflehmanwendungen in nicht orthogonal-ebenen Schalungen. In einem dritten Bereich werden in der Ausstellung anhand von Modellen, Plänen und Animationen Projekte der Forschungsgruppe FLEX an der Schnittstelle von digitaler Planung und Fertigung – vornehmlich in Holz – vorgestellt.
Die Ausstellung der Fakultät Architektur & Sozialwissenschaften der HTWK Leipzig kann noch bis zum 2. Dezember im Zentrum für Baukultur Dresden (ZfBK) besichtigt werden. Neben dem Werkstattgespräch am 26. Oktober folgt ein zweites am 16. November 2023 zum Thema Holz. Der Eintritt ist frei.
Die Forschungsgruppe FLEX an der HTWK Leipzig
Die Forschungsgruppe FLEX ist ein interdisziplinäres Team aus Architektur, Bau- und Wirtschaftsingenieurwesen sowie studentischen Mitarbeitenden unter der Leitung von Prof. Alexander Stahr. FLEX forscht zur digitalen Verknüpfung von Planungs- und Ausführungsprozessen, mit dem Ziel, Ressourcen in Architektur und Bautechnik effizienter zu nutzen. Die Forschungsgruppe ist zudem Mitglied im 2018 gestarteten Transferverbund Saxony⁵ der fünf sächsischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften sowie Mitglied der „International Association of Shell and Spatial Structures“ (IASS) und des internationalen Forschungsnetzwerks „Robots in Architecture“ (RiA).
HTWK-Rektor Prof. Mark Mietzner, Prof. Faouzi Derbel, Prorektor für Forschung und Nachhaltigkeit, und Prof. Alexander Stahr, Professor für Tragwerkslehre und Leiter der Forschungsgruppe FLEX, begrüßten Sebastian Gemkow im Smart Manufacturing Lab, das Stahr mit einem Augenzwinkern mit Steve Jobs` Garage verglich. „Hier können wir unsere Ideen für mehr Nachhaltigkeit im Bauwesen experimentell überprüfen und weiterentwickeln“, so Stahr.
Das Smart Manufacturing Lab der HTWK Leipzig
Das im Mai 2023 eröffnete „Smart Manufacturing Lab“ (SML) der HTWK Leipzig in eine Experimentalwerkstatt. In dieser erprobt die Forschungsgruppe FLEX digitale Fertigungskonzepte mit dem Ziel, sowohl den Ressourcenverbrauch am Bau signifikant zu reduzieren als auch die Produktivität deutlich zu erhöhen. Alexander Stahr: „Wir wollen die Vorteile des natürlichen, nachhaltigen und klimaschonenden Baustoffs Holz mit denen der Digitalisierung verbinden. Durchgängig digitale Prozessketten von der Planung bis zur Fertigung definieren den zentralen organisatorisch-technologischen Ansatz der hier vorangetriebenen Forschungsvorhaben.“ So kann das Bauen von morgen digitaler, effizienter und deutlich ressourcenschonender werden, denn neue, konsequent digital gedachte Abläufe können gleichsam Materialverbräuche, Emissionen und Abfallmengen signifikant reduzieren.
Beim Besuch des SML konnte Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow flexible Robotik für den individuell-automatisierten Holzbau sowie ein praxisnah entwickeltes Konzept zur Nutzung von Augmented Reality für die handwerkliche Fertigung von Holzständerwänden erleben. Dabei sah er live, wie ein Roboter ein vollständig aus Holz und Holzwerkstoffen bestehendes Wandelement fertigt, welches dank bionischer Analogie 50 Prozent – eine effiziente Struktur mit Vorbildern aus der Natur – weniger Material verbraucht, als aktuelle Holzständerwände. Zudem legte Gemkow an der „OptiPaRef-Showwall“ selbst Hand an und montierte mithilfe einer Augmented-Reality-Brille mit Begeisterung selbst Teile einer Holzrahmenwand– ähnlich wie es im digitalen Holzbau von morgen zum Einsatz kommen kann.
Besichtigung auch an der HTW Dresden
Neben dem SML an der HTWK Leipzig besuchte Gemkow die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (HTWD): Dort beschäftigen sich Forschende beispielsweise mit Extremwetterereignissen wie Hochwasser und Starkregen und arbeiten an nachhaltigen Modellen zur besseren Vorbereitung auf solche Extremwetter. Im Chemielabor ließ er sich Gemkow zudem zeigen, mit welchen Methoden Mikroplastikpartikel in Sedimentproben aus Elbe und Neiße schneller und kostengünstiger erkannt werden und damit Aussagen zu möglichen Umweltbelastungen in Gewässern getroffen werden können.
Hintergrund FLEX
Die Forschungsgruppe FLEX an der HTWK Leipzig ist ein interdisziplinäres Team aus Architektur, Bau- und Wirtschaftsingenieurwesen sowie studentischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Unter Leitung von Prof. Alexander Stahr hat sich die Forschung zur digitalen Verknüpfung von Planungs- und Ausführungsprozessen – mit dem Ziel, Ressourcen in Architektur und Bautechnik effizienter zu nutzen – in den vergangenen knapp zehn Jahren zur Kernaufgabe der Forschenden entwickelt.
Die Forschungsgruppe FLEX ist Mitglied im 2018 gestarteten Transferverbund Saxony⁵ der fünf sächsischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften sowie Mitglied der „International Association of Shell and Spatial Structures“ (IASS) und des internationalen Forschungsnetzwerks „Robots in Architecture“ (RiA).
Spurensuche und Neugestaltung
Die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig) beteiligt sich aktiv an der Erforschung und Neugestaltung: Wissenschaftler erfassten unter der Leitung von Geotechnik-Professor Ralf Thiele die bisherige Gestaltungsgeometrie des Friedhofs und glichen diese mit den ehemaligen Bauplänen ab. „Im Laufe der wechselvollen Geschichte des Ortes fanden während der NS-Zeit schlecht dokumentierte Bestattungen und Urnenbeisetzungen statt, die nun aufgearbeitet und in die Neugestaltung des Ortes sensibel integriert werden müssen“, erläutert Eta Zachäus die Herausforderung. Dazu zählen mutmaßlich auch Kinderbestattungen und ein Gräberfeld mit geschändeten Grabsteinen des ersten jüdischen Friedhofs. Mittels Bodenradarmessungen ist es den HTWK-Forschern gelungen, einen Blick in den Untergrund zu werfen, ohne den Boden umzuschichten. Die Geräte geben Auskunft über die oberflächennahe Struktur des Bodens, woraus geschlussfolgert werden kann, ob sich an den vermuteten Stellen tatsächlich Urnen oder Gebeine befinden könnten. Nach dem Einmessen und den geophysikalischen Untersuchungen erarbeitet Architekt Ronald Scherzer-Heidenberger, HTWK-Professor für Regionalplanung und Städtebau, nun Pläne für eine Um- und Neugestaltung des Neuen Israelitischen Friedhofs. „Wir wollen die historische Gestaltung mit den beiden prägenden Hauptachsen und Alleen wiederherstellen und die Raumqualität auf den großflächigen Erweiterungsteil im Osten des Friedhofs übertragen. Die in jüngerer Zeit frei angelegten Grabfelder sollen sich in ein schlüssiges Gesamtkonzept integrieren. Zudem werden Gräber mit besonderer historischer Bedeutung für Besuchende besser erkenntlich und zugänglich“, erläutert Scherzer-Heidenberger die Pläne. Gemeinsam mit seinem Kollegen Ralf Thiele engagiert auch er sich aus Überzeugung dafür, dass der Erinnerungsort in neuem Glanz erstrahlen kann und sowohl Leipzigerinnen und Leipziger als auch Nachkommen aus aller Welt anzieht.
Ralf Thiele: „Hochschulen haben neben Lehre und Forschung die so genannte dritte Mission, sich aktiv in der Stadtgesellschaft einzubringen – daher freut es mich sehr, dass wir bei der Erforschung und Neugestaltung dieses besonderen Ortes mitwirken dürfen. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, mit unserer Expertise und den modernen Geräten aus der Forschung zu helfen und Verantwortung zu übernehmen“, erläutert der Geotechnik-Professor seine Motivation.
Eta Zachäus: „Für die sehr gute und unbürokratische Zusammenarbeit mit der HTWK Leipzig sind wir sehr dankbar. Es ist für unsere Gemeinde und die Nachkommen von ungeheurer Bedeutung, wenn vermutete Gräber bestätigt werden. Davon gehen wir aus, wenn die geowissenschaftlichen Erkenntnisse sich mit den Informationen decken, die Historiker Steffen Held in akribischer Archivarbeit zusammengetragen hat.“
Der Neue Israelitische Friedhof
Ein jüdischer Friedhof ist ein Ort des individuellen und kollektiven Gedenkens. Er wird als heiliger Boden aufgefasst, in dem die Toten ihre ewige Ruhe finden. Am 6. Mai 1928 geweiht, ist der Neue Israelitische Friedhof die dritte Ruhestätte der Leipziger Jüdinnen und Juden. Die imposante Trauerhalle, ein von Wilhelm Haller gebauter Kuppelbau samt Flügelbauten, wurde 1938 während des November-Pogroms niedergebrannt und erhaltene Reste 1939 auf Betreiben der Stadt gesprengt. Zu DDR-Zeiten ersetzte die Stadt den monumentalen Bau durch eine kleinere Trauerhalle. Der Leitspruch „Stärker als der Tod ist die Liebe“ thront über dem Eingang. Der Neue Israelitische Friedhof ist ein Beweis für die Existenz einer jüdischen Großgemeinde in Leipzig während der Weimarer Republik und für deren Vernichtung im Nationalsozialismus. Auch zeigt er jüdisches Leben während der DDR und ein Anwachsen der Gemeinde nach der Friedlichen Revolution durch Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion.
Um dem Forschungs- und Entwicklungsbedarf für den Bau dieser Infrastrukturen der Zukunft gerecht zu werden, erhielten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im September 2023 ein neues Technikum. Am HTWK-Forschungscampus Eilenburger Straße in Leipzig-Reudnitz gelegen, besteht das GeoTechnikum aus einer geschützten Bodenversuchsfläche. Auf 9 mal 20 Metern wurde dafür der vorhandene Untergrund bis in eine Tiefe von 4 Metern durch einen idealisierten Versuchsboden aus Sand ausgetauscht. Betonwände grenzen den unterirdischen Raum zum Erdreich ab. Im GeoTechnikum können die Forschenden großflächige Versuche durchführen und Systeme und Verfahren optimieren. Geplant ist die Neu- und Weiterentwicklung von Methoden, mit denen Kippenböden verdichtet werden. Dank einer Kranbahn können die Forschenden Gewichte anheben und für Verdichtungsversuche auf den Sand fallen lassen. Dabei werden in Echtzeit Parameter erfasst und ausgewertet, um den Erfolg der Verdichtungsmethoden zu messen. Auch das Monitoring von Bodenbewegungen in großen Arealen wird im GeoTechnikum erprobt. Dafür entwickeln die Forschenden neuartige Sensoren; die so gesammelten großen Datenmengen werden dank künstlicher Intelligenz verarbeitet.
HTWK-Rektor Prof. Mark Mietzner: „Der Strukturwandel ist in vollem Gange; wir als Hochschule für Angewandte Wissenschaften stellen uns bereits seit vielen Jahren den daraus resultierenden Herausforderungen, bieten Lösungsansätze und sind verlässliche Forschungspartnerin für die Region. Neben dem Carbonbetontechnikum und dem geplanten Holzbauforschungszentrum ist das GeoTechnikum ein weiterer wichtiger Baustein, um an den Fragen der Zeit zu forschen und nachhaltige und innovative Antworten zu finden. In gemeinsamer Finanzierung mit dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, dem Sächsischen Wissenschaftsministerium und unserer Hochschule konnten wir mit der neuen Bodenversuchsfläche die Geotechnik als eine unserer Kernkompetenzen in der Forschung räumlich, strukturell und personell stärken.“
Geowissenschaftliche Forschung an der HTWK Leipzig
In den vergangenen Jahren hat die HTWK Leipzig ihre Forschung in den Geowissenschaften systematisch ausgebaut, um den Strukturwandel in der Region zu begleiten. Aktuell arbeiten zwanzig Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Disziplinen an Fragestellungen, die sich aus der Nachnutzung von Flächen ergeben. „Durch die langjährige interdisziplinäre Teamarbeit mit Forschenden aus Geotechnik, Maschinenbau, Geodäsie und Geophysik können wir uns den Herausforderungen gemeinsam mit Praxispartnern gut stellen“, so Geotechnik-Professor Ralf Thiele. Mithilfe der neuen Versuchsfläche können die Forschenden ihre Messsysteme künftig nicht nur im Labormaßstab, sondern auch in realer Größe testen und weiterentwickeln. Damit ergänzt die neue Versuchsfläche die vorhandene Forschungsinfrastruktur: In direkter Nachbarschaft befindet sich eine Bodenversuchsfläche mittlerer Größe und das Bodenmechanische Labor.
Ziel: Forschungsergebnisse in Praxis überführen und nachhaltig Bauen
Im GeoTechnikum werden die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht nur forschen und experimentieren, sondern auch Praxispartnern aus der freien Wirtschaft demonstrieren, wie Verfahren und Techniken funktionieren. Industriepartner können dort geotechnische Systeme und Werkzeuge wie Walzen ausprobieren und deren Wirkung im Realmaßstab testen. Den Transfer von Wissen in die Praxis bringen die HTWK-Wissenschaftler Prof. Ralf Thiele und Alexander Knut ebenfalls im Transferverbund Saxony⁵ der fünf sächsischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften ein und bündeln dort ihre Kompetenzen im Bereich „Nachhaltiges Bauen“, denn eine gute geotechnische Analyse der Böden ermöglicht robuste, langlebige und wartungsarme Infrastrukturen für Wirtschaft, Verkehr und Gesellschaft.
Weitere Informationen
Bildstrecke und weitere Informationen zur Forschung mithilfe von Bodenversuchsanlagen
Geotechnik-Forschungsgruppen der HTWK Leipzig:

Die langjährige Forschungsleistung und Expertise wird ab dem 1. Juli 2024 in einer 1.000 Quadratmeter Grundfläche umfassenden Forschungshalle gebündelt: Das Holzbauforschungszentrum soll im Innovationspark Bautechnik Leipzig/Sachsen im Stadtteil Engelsdorf stehen – gleich neben dem ebenfalls zur HTWK Leipzig gehörenden Carbonbetontechnikum, das 2022 eröffnet wurde. Den Mietvertrag für das Holzbauforschungszentrum unterzeichneten die Beteiligten am 28. Juni 2023 während des 1. Sächsischen Holzbautags in Dresden: der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) als Auftraggeber und die Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH (MFPA Leipzig) als Bauherr der Halle. Die HTWK Leipzig ist Mieterin der neuen Forschungsstätte.
HTWK-Rektor Prof. Mark Mietzner: „Als Hochschule für Angewandte Wissenschaften ist es uns ein Anliegen, unsere Forschungsleistungen in die Praxis zu überführen. Die Eröffnung des Holzbauforschungszentrums ist ein wichtiger Meilenstein für die HTWK Leipzig. Wir setzen hier einen starken Fokus auf die Forschung und Entwicklung im Holzbau und schaffen eine hochmoderne Forschungsstätte, die die Weiterentwicklung des Holzbaus in Sachsen und darüber hinaus vorantreiben wird. Wir sind überzeugt, dass Holz ein wichtiger Baustoff der Zukunft ist und dass wir mit dem Holzbauforschungszentrum einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Baubranche leisten werden.“
Prof. Dr. Alexander Stahr, HTWK-Professor für Tragwerkslehre und Projektleiter des Holzbauforschungszentrums, erläutert die Pläne: „In der Haupthalle planen wir eine frei konfigurierbare Arbeitsfläche, die von universell verwendbaren Industrierobotern über ein Kransystem angesteuert werden kann. Daneben wird es eine modern ausgestattete Tischlerei sowie ein additives Fertigungslabor mit unterschiedlichen 3D-Druck-Technologien geben. Neben dem Kernforschungsthema, Parameter-basierte Fertigungssysteme für einen effizienten, individuellen und nachhaltigen Holzbau zu entwickeln, ergibt sich ein umfassender Forschungs- und Transferbedarf aus Informatik, Mathematik, Maschinenbau, Automatisierungstechnik und Wirtschaft. Das Prinzip der interdisziplinären Zusammenarbeit innerhalb der Hochschule wird damit zu einem wesentlichen Grundbaustein des Projekts.“
Bauen mit Holz
Derzeit beziehen sich 20 Prozent der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser in Deutschland auf Bauten mit Holz – Tendenz steigend. Gleichwohl ist der Anteil über alle Bauwerke gerechnet deutlich geringer und sollte sich für ein nachhaltigeres Bauen erhöhen. Doch Holz steht nicht unendlich zur Verfügung. Bereits jetzt übersteigt weltweit die Nachfrage das Angebot, welches auf Basis einer nachhaltigen Waldnutzung zur Verfügung steht. Deutschland verfügt über große Waldressourcen und importiert trotzdem Holz, um die hohe Nachfrage zu decken. Im Gegensatz zum Verbrennen des Rohstoffs zur Energiegewinnung gilt es im Bauwesen als sinnvoll, auf Holz zurückzugreifen, da der Baustoff klimafreundlicher als der energie- und ressourcenintensive Beton ist.
Hintergrund
Die neue Forschungsstätte trägt den Titel Holzbauforschungszentrum Leipzig. Ein nahezu gleichnamiger Verein, dem Prof. Alexander Stahr vorsitzt, wurde am 20. April 2021 gegründet. In diesem bündeln Expertinnen und Experten aus Architektur, Ingenieurwesen, Holzbau und Forstwirtschaft ihr Wissen und ihre Interessen, um den Weg des Strukturwandels in Mitteldeutschland weg vom Kohleabbau hin zu einer gestärkten regionalen Holzwirtschaft zu ebnen. Der Förderverein Holzbauforschungszentrum Leipzig ist Mitglied im Verein Holzbau Kompetenz Sachsen, welcher im Auftrag der sächsischen Staatsregierung die Initiativen des Freistaats zur Förderung des Bauens mit Holz fördert. Unter diesem Dach wird die sächsische Holzbau-Forschung schwerpunktmäßig in Leipzig im Holzbauforschungszentrum angesiedelt.
Terminhinweis: EASTWOOD 2023
Am 21. und 22. September 2023 lädt die HTWK Leipzig zur Holzbau-Tagung und Netzwerkveranstaltung EASTWOOD ein. Dort tauschen sich Fachleute aus Architektur, Tragwerkplanung und Wissenschaft zu aktuellen Entwicklungen im Holzbau aus. EASTWOOD ist eine gemeinsame Veranstaltung des Forschungs- und Transferzentrum e.V. an der HTWK Leipzig und der Rudolf Müller Mediengruppe aus Köln.
„Meine Kinder sind total begeistert, sie würden nun am liebsten entweder Maschinenbau oder Druck- und Verpackungstechnik studieren“, erzählt eine Mutter nach dem Besuch der Langen Nacht der Wissenschaften an der HTWK Leipzig. Die Begeisterung für die verschiedenen Lehr- und Forschungsbereiche ließ sich an diesem Freitagabend auf spielerische Art hervorrufen: Rund 50 Mitmachaktionen und Exponate zum Anfassen und Ausprobieren sowie Führungen in sonst verschlossene Labore und spannende Vorträge erwarteten die kleinen und großen Besucher am 23. Juni 2023 ab 18 Uhr an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Ein voller Erfolg, wie viele Beteiligte im Anschluss resümierten.
Mit einem umfangreichen, vielfältigen und interessanten Programm gewährten die teilnehmenden Forscherinnen und Forscher Einblicke in die Bandbreite der Lehr- und Forschungsbereiche der HTWK Leipzig. Zugleich bildete das Programm einen Teil der insgesamt mehr als 600 Einzelveranstaltungen, zu denen mehr als 54 Wissenschaftsstandorte am Abend der Langen Nacht der Wissenschaften in Leipzig einluden.
Exponate zum Ausprobieren und Einblicke in sonst verschlossene Labore
An der HTWK Leipzig waren Gebäude am zentralen Campus an der Karl-Liebknecht-Straße und der Gustav-Freytag-Straße sowie im Zentrum-Süd in der Wächterstraße geöffnet. Beispielsweise konnten Kinder und Erwachsene im Nieper-Bau am zentralen Campus in einen Sandkasten springen und so Bodenverdichtung ausprobieren, für mehr Nachhaltigkeit im Bauwesen eine kleine Lehmwand bauen, und sie konnten selbst kleine Fußball-Roboter vom HTWK-Robots-Teams steuern, die bereits Weltmeister im Roboter-Fußball geworden sind. Zu entdecken gab es auch zahlreiche Labore: Darunter waren jene vom 3D-Druck, von der Elektro-Technik, der Werkstoffforschung oder vom Institut für Wasserbau und Siedlungswasserwirtschaft.
Wenige Meter weiter lockten auch die Hochschulbibliothek und das Laborgebäude Naturwissenschaften sowie das Medienzentrum und der Gutenbergbau Besuchende an. Dort lernten sie auf spielerische Weise etwas zum neuen Verbundwerkstoff Carbonbeton, der nicht nur eine schlankere und nachhaltigere Bauweise vorantreibt, sondern auch dank der elektrischen Leitfähigkeit des Carbons funktionalisiert werden kann. Zudem erfuhren Interessierte viel zum Druck- und Verpackungswesen, das über das Zeitung-Drucken weit hinaus geht. „Dir Kinder waren mit Begeisterung dabei. In Erwachsenenrunden gab es meist eine rege Diskussion zum Thema Verpackung, Verpackungsrecycling und Nachhaltigkeit“, sagte Prof. Eugen Herzau, der in seinen Laborführungen „Geheimnisse der Verpackungstechnik“ lüftete. Viele Besucherinnen und Besucher freuten sich auch, einen individuell bedruckten Tischtennisball oder eigens versiegelte Gummibärenjoghurtbecher mit nach Hause nehmen zu können. Einblicke in sonst verborgene Themen gewährten auch die Chemikerinnen und Chemiker der HTWK Leipzig bei ihren Laborführungen, bei denen sowohl Detektive der Chemie am Werk sind als auch Gefahren für Kunstwerke gezeigt wurden.
Weitere Highlights warteten im Wiener-Bau in der Wächterstraße: Im HTWK-Hochspannungslabor zeigte Prof. Carsten Leu physikalische Experimente, dank derer Interessierte faszinierende Wirkungen von Elektrizität erleben konnten, darunter Gasentladungen in der Luft, gleitend auf Oberflächen und leuchtend im sogenannten „Gasraum“. Spannend waren auch die verschiedenen Sensoren, die Gäste anfassen und ausprobieren konnten, sowie die Einblicke in Medizintechnik und ChatGPT als Form der künstlichen Intelligenz.
Weitere Eindrücke vermitteln die Bildergalerien und das kurze Video.
(Videoschnitt: Paul Fischer/HTWK Leipzig)
Die nächste Lange Nacht der Wissenschaften in Leipzig findet voraussichtlich im Mai oder Juni 2025 statt.
Angebote im Wiener-Bau
Angebote im Nieper-Bau
Angebote in der Hochschulbibliothek
Angebote im Laborgebäude Naturwissenschaften, Medienzentrum und Gutenberg-Bau

Am 14. Juni 2023 begrüßte Tagungsleiter Prof. Peter Schulze an der HTWK Leipzig gemeinsam mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (Sachsen), Rektor Prof. Mark Mietzner (HTWK Leipzig) und Bürgermeister für Wirtschaft, Arbeit und Digitales Clemens Schülke (Stadt Leipzig) die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 3D-Druck Forums 2023.
Die Forumsteilnehmerinnen und -teilnehmer erwarteten Plenarvorträge zu aktuellen Entwicklungen in der Additiven Fertigung sowie eine Industrieausstellung der 3D-Druck Branche im Foyer des Nieperbaus der HTWK Leipzig. Die Fachvorträge des 3D-Druck Forums beschäftigten sich mit Themen aus der Medizintechnik und der Biotechnologie sowie Metallen und Polymeren. Behandelt wurden in Vorträgen und der Ausstellung zudem Aufgabenstellungen von Mikro bis Makro sowie der Einsatz künstlicher Intelligenz im 3D-Druck. Der Stand der Qualitätssicherung und der Präzision im 3D-Druck sowie Simulationsanwendungen wurden beleuchtet und durch beispielhafte Anwendungen untersetzt. In den einzelnen Sessions standen weiterhin Fragen des Energieeinsatzes und der Nachhaltigkeit im Fokus.
Das „Mitteldeutsche Forum 3D-Druck in der Anwendung“ wird von der HTWK Leipzig, der Ernst-Abbe-Hochschule Jena, der Hochschule Merseburg und der Hochschule Mittweida jährlich veranstaltet. Zum 9. Mitteldeutschen Forum hatte am 29. Juni 2022 die Ernst-Abbe-Hochschule Jena geladen. Mit der Übergabe des Staffelstabes im Juni 2022 wurde die Fakultät Ingenieurwissenschaften zum Veranstalter und Tagungsort für dieses Jahr. Im Herbst 2024 wird die Hochschule Merseburg Gastgeberin und Tagungsort des Forums werden. Den Staffelstab dafür erhielt Dr. Marco Götze vom diesjährigen Tagungsleiter Prof. Peter Schulze am Ende des Forums.
Tagungsleiter Prof. Peter Schulze: „Selten zuvor gab es so schnelle Verbindungen zwischen Wissenschaft und Handwerk, Architektur und Maschinenbau sowie Ingenieur- und Naturwissenschaften. Wir freuen uns auf das nächste Forum 2024 in Merseburg.“
Impressionen vom 3D-Druck Forum 2023
RUBIN-ISC Projekttreffen im Carbonbetontechnikum
Am 6. Juni 2023 fand im Carbonbetontechnikum der HTWK Leipzig das dritte RUBIN-ISC-Projekttreffen statt. Dabei trafen sich die Mitglieder des Bündnisses aus 13 Unternehmen und zwei Forschungseinrichtungen sowie diversen assoziierten Partnern zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch. Sie diskutierten die Fortschreitung des RUBIN-ISC-Konzepts, besprachen die nächsten gemeinsamen Schritte des Projekts und die Durchführung zweier angegliederter Workshops, in denen die Masterelemente „Detail Hochbau“ und „Fußgängerbrücke“ vorbereitet werden. Im Anschluss führten die Forschenden der HTWK Leipzig die knapp 40 Teilnehmenden durch das Carbonbetontechnikum und erläuterten dessen Aufbau, Funktionsweise und zukünftige Pläne.
Weitere Informationen unter isc-projekt.de
Kulturerbe erforschen
Im Fokus stehen diesmal Projekte, die einen Beitrag dazu leisten, Kulturerbe zu erforschen und zu erhalten – denn Kultur ist identitätsstiftend und deshalb schützenswert. Technische Mittel können dabei helfen: Seien es Radiowellentechnologien, mit denen Schadstoffe aus Kulturgütern entfernt werden oder digitale Methoden, mit denen historische Stätten erforscht und auf Onlineplattformen für die Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. Auch die Entstehung und Entwicklung von Technologien selbst kann eine Gesellschaft und eine Epoche prägen – Stichwort Industriekultur.
Darüber hinaus lesen Sie in den Schlaglichtern von vielfältigen weiteren Themen, an denen wir forschen. Von der Wärme in der Tiefe bis zu den Regenwolken hoch im Himmel ist die Spannweite dabei groß.
Online und Print
Lassen Sie sich überraschen und blättern Sie digital rein: https://www.htwk-leipzig.de/publikationen/einblicke2023
Lesen Sie gern gedrucktes Wort – natürlich auf nachhaltigem Papier – und möchten die Einblicke kostenlos abonnieren? Eine kurze Nachricht genügt.
Viel Lesevergnügen wünscht Ihnen die Einblicke-Redaktion!
Insgesamt werden an der Hochschule aus Drittmitteln 314 Mitarbeitende beschäftigt. Sie sind in zahlreichen Forschungsvorhaben sowie in Projekten in Studium, Lehre und Administration tätig.

Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow gratuliert: „Die HTWK Leipzig gehört zu den forschungsstärksten Hochschulen für angewandte Wissenschaften und genießt einen hervorragenden Ruf. Ein erneuerter Rekord bei den Drittmitteleinnahmen zeugt vom großen Vertrauen in die Expertise und Innovationsstärke der HTWK. Anwendungsnähe ist hier ein Prädikat, das sich in Forschung und Lehre buchstäblich bezahlt macht. Vom Wissenstransfer profitieren Unternehmen und Hochschule gleichermaßen. Das ist ein toller Erfolg.“
Prof. Mark Mietzner, Rektor der HTWK Leipzig: „Ich freue mich sehr über die bisher höchste eingenommene Drittmittelsumme unserer Hochschule. Dieser Erfolg zeigt, dass wir auf Gebieten forschen, lehren und arbeiten, die sich mit anwendungsbezogenen Lösungen für aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen befassen, uns also letztlich alle angehen – beispielsweise Themen wie Digitalisierung und Energiewende.
Zugleich möchte ich in diesem Zusammenhang für eine ausgewogenere Finanzierung der HTWK Leipzig und aller HAW im Freistaat Sachsen werben. Denn neben der projektbezogenen Drittmittelfinanzierung gilt es, unserer Leistungsfähigkeit und dem damit verbundenen wachsenden Bedarf an Ressourcen auch durch ein tragfähiges Fundament und einen langfristigen Finanzierungsrahmen Rechnung zu tragen. Nur so können wir unseren hoheitlichen Aufgaben in Forschung, Lehre und Verwaltung weiter gerecht werden.“
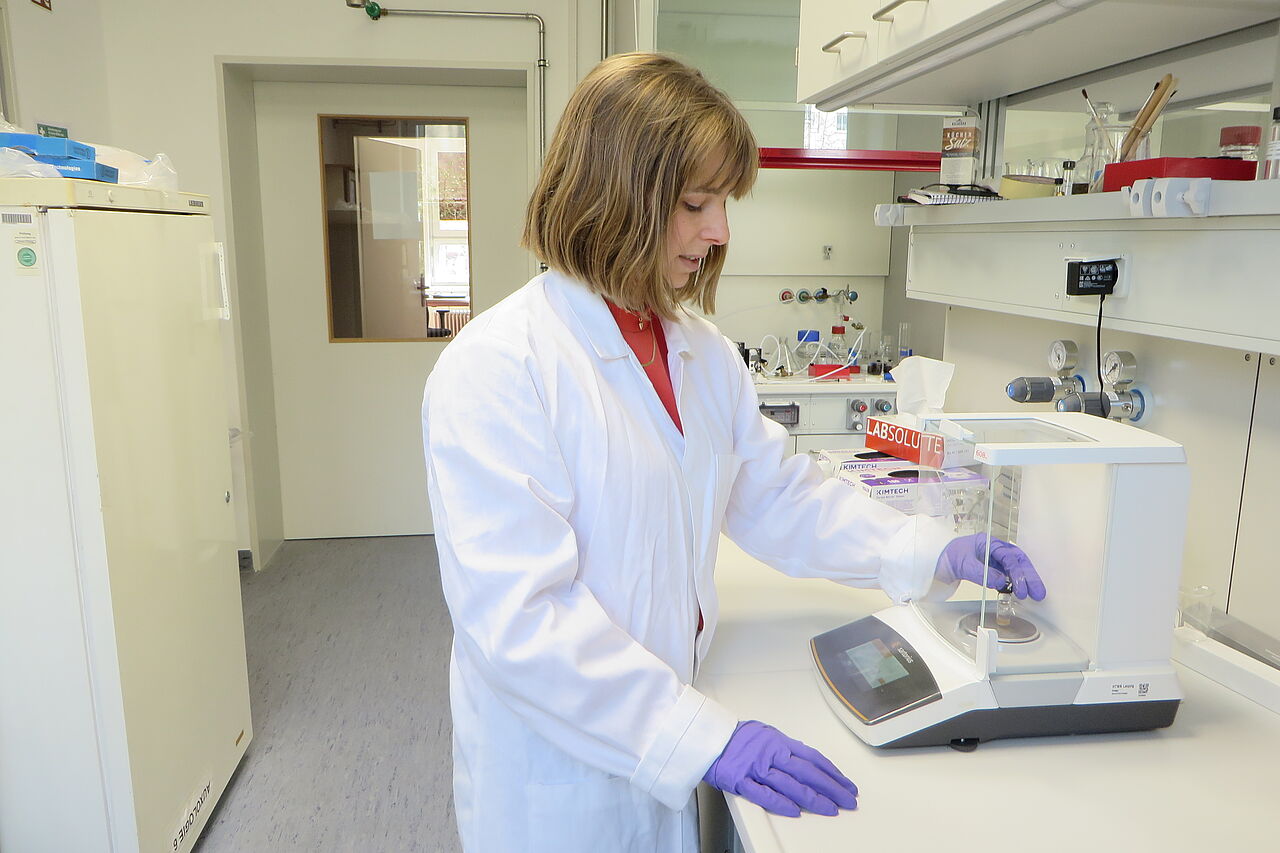
Drittmittelprojekte in der Forschung
Beispielhaft für drittmittelgeförderte Forschung sind die Projekte „BeCoLe – UVC-Luftentkeimung in Innenräumen“, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, sowie die Nachwuchsforschungsgruppe „GreenHydroSax“, die Innovationen durch Nutzung von Wasserstoff in der Energie- und Umwelttechnik hervorbringen, gefördert durch den Europäischen Sozialfonds. Des Weiteren erhielt die HTWK Leipzig von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) rund eine Million Euro für neue Großforschungsgeräte. Damit analysieren Forschende unter anderem innovative, umweltfreundliche Hochleistungswerkstoffe, die das Bauen nachhaltiger gestalten sollen – ein Hoffnungsträger im Kampf gegen den Klimawandel.
Die HTWK Leipzig hat zudem die Finanzierung für die zweite Phase des Transferverbunds der fünf sächsischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, Saxony5, erfolgreich eingeworben. Mit diesem Projekt des Bund-Länder-Programms ‚Innovative Hochschule‘ soll der Transfer von Forschungsergebnissen in die regionale Wirtschaft gestärkt und beschleunigt werden, vor allem in den Bereichen Produktion, Umwelt und Energie.
Drittmittelprojekte in der Lehre
Auch im Bereich Bildung arbeiten zahlreiche Mitarbeitende an innovativen Projekten: So startete 2021 mit „FAssMII – Feedback-basiertes E-Assessment in Mathematik, Informatik und Ingenieurwissenschaften“ ein Projekt, in dem bis 2024 Rückmeldesysteme für Studierende entwickelt werden. Ziel ist es, die Motivation der Studierenden zu stärken und zugleich einen Mehrwert für den Lehr- und Lernprozess zu erzeugen, vor allem mit Blick auf die Zeit der Pandemie und den damit verbundenen Herausforderungen für Studierende und Lehrende.
Auch am Verbundprojekt „Digitalisierung in Disziplinen partizipativ umsetzen: Competencies Connected (D2C2)“ ist die HTWK Leipzig gemeinsam mit mehreren sächsischen Hochschulen beteiligt. Beide Projekte werden durch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert.
Hintergrund
Insgesamt verfügte die HTWK Leipzig im Jahr 2022 über ein Finanzvolumen in Höhe von 60,62 Mio. Euro, davon erhielt sie 39,50 Mio. Euro Haushaltsmittel vom Freistaat Sachsen. Die zusätzlichen 21,12 Mio. Euro Drittmittel setzen sich wie folgt zusammen: Insgesamt wurden 2022 rund 41 Prozent (8,6 Mio. Euro) der Drittmittel aus Bundesmitteln eingeworben. Rund 27 Prozent (5,6 Mio. Euro) stammen von regionalen und überregionalen Unternehmen, rund 11 Prozent (2,2 Mio. Euro) aus Förderprogrammen der Europäischen Union und rund 12 Prozent (2,5 Mio. Euro) vom Freistaat Sachsen. Außerdem kommen noch rund 10 Prozent (2,2 Mio. Euro) hinzu unter anderem von DAAD, von der Stiftung Innovation Hochschullehre und von sonstigen öffentlichen und nichtöffentlichen Drittmittel-Gebern.
Prof. Mark Mietzner, Rektor der HTWK Leipzig: „Die Vision der Gruppe um Prof. Alexander Stahr markiert nicht weniger als eine Zeitenwende im Bau. Sie soll und kann das Bauen von morgen nicht nur digitaler und effizienter, sondern auch deutlich ressourcenschonender machen. Neue, konsequent digital gedachte Abläufe können gleichsam Materialverbräuche, Emissionen und Abfallmengen signifikant reduzieren. Ich wünsche der Gruppe auf dem Weg dahin beste Erfolge, starke Partner, Geduld und Ausdauer bei den kommenden Herausforderungen und den Mut, auch neue Wege zu gehen.“
Wissenstransfer
Auch seitens der Stadt Leipzig wurde die Bedeutung der anwendungsorientierten Forschung als zentraler Baustein des Wissenschaftsstandortes Leipzig gewürdigt. Dr. Hans-Martin Dörfler vom Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Leipzig betonte in seinem Grußwort, dass sich vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen interessante Möglichkeiten für Innovationen ergeben. Durch aktive Zusammenarbeit mit den lokalen Hochschulen können kluge Forschungspartnerschaften etabliert und das dort vorhandene Know-how genutzt werden. „Aus diesem Grund unterstützt die Stadtverwaltung den Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft nachdrücklich. Denn wir sind überzeugt: Gute Forschung ist die Grundlage für zukunftsfähige Produkte und Dienstleistungen und damit eine Voraussetzung für eine vorwärtsgerichtete und resiliente Wirtschaft“, so Dörfler.
Smart Manufacturing Lab
Von der Idee bis zur Eröffnung des Smart Manufacturing Labs vergingen mehr als fünf Jahre: Ende 2016 stellte die Forschungsgruppe FLEX den Projektantrag zur Finanzierung der Grundausstattung in Form eines Industrieroboters. Noch im selben Jahr folgte die Bewilligung durch das Sächsische Ministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK). Nachdem am Gutenbergplatz in Zusammenarbeit mit dem Sächsischen Immobilien- und Baumanagement (SIB) entsprechende Räumlichkeiten gefunden wurden, konnte das Werkstattlabor eingerichtet werden: Als Ergänzung zu dem KUKA KR 60-HA-Roboter wurde in der Folge ein Scherenhubtisch beantragt und bewilligt. Anfang 2020 war die gerätetechnische Installation, inklusive der notwendigen Sicherheitstechnik, abgeschlossen, so dass die Werkstatt in den Probebetrieb gehen konnte. „Seitdem erforschen wir im SML, wie durchgängig digitale Prozess- und Wertschöpfungsketten entwickelt und erprobt werden“, so Stahr, der gleichzeitig Vorsitzender des „Förderverein HolzBauForschungsZentrum Leipzig“ ist.
Bei der Eröffnung des Smart Manufacturing Labs konnten sich die geladenen Gäste aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft an drei Stationen genauere Einblicke in die Forschung im SML verschaffen. Präsentiert wurden flexible Robotik im Holzbau, Augmented Reality fürs Handwerk und Additive Manufacturing im Bauwesen. Dabei erlebten sie den Roboter mit einem Stift bestückt im Einsatz als „Portraitmaler“, konnten sich verschiedene individuell gedruckte 3D-Objekte ansehen und an der „OptiPaRef-Showwall“ mittels AR-Brille, die Zukunft des digitalen Holzbaus live erleben und eine Holzrahmenwand selbst montieren.
Hintergrund FLEX
Die Forschungsgruppe FLEX an der HTWK Leipzig ist ein interdisziplinäres Team aus Architektur, Bau- und Wirtschaftsingenieurwesen sowie studentischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Unter Leitung von Prof. Alexander Stahr hat sich die Forschung zur digitalen Verknüpfung von Planungs- und Ausführungsprozessen – mit dem Ziel, Ressourcen in Architektur und Bautechnik effizienter zu nutzen – in den vergangenen knapp zehn Jahren zur Kernaufgabe der Forschenden entwickelt.
Die Forschungsgruppe FLEX ist Mitglied im 2018 gestarteten Transferverbund Saxony⁵ der fünf sächsischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften sowie Mitglied der „International Association of Shell and Spatial Structures“ (IASS) und des internationalen Forschungsnetzwerks „Robots in Architecture“ (RiA).
Video: Paul Fischer/HTWK Leipzig
Am späten Dienstagnachmittag trafen sich rund 140 Gäste am Gutenbergplatz der HTWK Leipzig: Forschende, Praxispartner, aber auch Mitarbeitende der vielfältig unterstützenden Verwaltungs- und Technikbereichen der Hochschule konnten miteinander ins Gespräch kommen, sich austauschen, neue Kontakte knüpfen und Einblicke in die Labore vor Ort sowie die dort umgesetzten Forschungsprojekte gewinnen.
Rundgänge im Smart Manufacturing Lab
Im neu eröffneten „Smart Manufacturing Lab“ (SML) der Forschungsgruppe FLEX blickten die Besucherinnen und Besucher in das innovative Werkstattlabor, in dem Konzepte und Methoden für die individualisiert-automatisierte Fertigung von Bauelementen für den Holzbau entwickelt werden. So erlebten sie die neue 3D-Fertigungsanlage im Einsatz: Angepasst für die Veranstaltung zeichnete der Industrieroboter, der sonst Platten zuschneidet, Löcher bohrt oder Nuten fräst, „Bilder“ von Anwesenden auf Papier. Dazu wurde ein live vor Ort entstandenes Foto mithilfe eines eigens geschriebenen Algorithmus so modifiziert, dass der „Robbi“ mit einem einfachen Stift die Bildpunkte aufs Papier „tupfen“ konnte. Ein weiteres technologisches Highlight der Eröffnungsveranstaltung war die „OptiPaRef-Showall“. Hier konnten die Gäste mithilfe einer Augmented-Reality-Brille anhand virtuell eingeblendeter Informationen selbst das Riegelwerk einer Holzrahmenwand hochpräzise montieren – so wie es künftig einmal im digitalen Holzbau genutzt werden könnte.
Mit diesen und weiteren Themen ist FLEX auch im Verbund der sächsischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften Saxony5 vertreten. Ziel ist der beschleunigte Transfer von Forschungsergebnissen für nachhaltiges und ressourcenschonendes Bauen in die Anwendungspraxis.
Rundgänge im EMV-Zentrum
Außerdem war am Standort das Zentrum für Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geöffnet, das am Forschungs- und Transferzentrum der Hochschule angesiedelt ist. Dort untersuchen und prüfen Mitarbeitende Produkte, die sich in der Entwicklung befinden, auf ihre elektromagnetische Verträglichkeit. Diese wird bei zunehmender Digitalisierung und Vernetzung immer wichtiger, um Störungen von Geräten und Anlagen oder von Kommunikations- und Energienetzen zu vermeiden.
Premiere beim weiterentwickelten InNoFa-Demonstrator: Neue 3D-Elemente aus Stahl

Auf der Rapid.Tech-Messe präsentiert die Forschungsgruppe FLEX ihren weiterentwickelten InNoFa-Demonstrator. InNoFa steht für „Individual Node Facade“, eine Fassadenkonstruktion mit individuellen Knotenelementen. Premiere der rund drei Meter hohen und zwei Meter breiten Konstruktion sind die neuen 3D-Elemente aus Stahl. Die HTWK-Forschungsgruppe entwickelte den bereits im vergangenen Jahr ausgestellten InNoFa-Demonstrator weiter und stellt nun auf der Messe die neuen Erkenntnisse vor. Gemeinsam mit dem Projektpartner, dem Laserinstitut der Hochschule Mittweida (LHM), entwickelte FLEX eine neue Drucktechnologie, die nicht mehr auf dem selektiven Laserschmelzen von feinem Aluminium-Pulver basiert, sondern selektiv grobes Stahl-Granulat mit hoher Laserleistung zusammenschweißt und Technologien unterschiedlicher additiver Fertigungsverfahren vereint (Arbeitstitel: GrobKorn-Verfahren). Das steigert den Materialumsatz während des Prozesses erheblich, reduziert die Druckzeit um ein Vielfaches und senkt die Materialkosten stark. Das neuentwickelte Verfahren ist so vor allem für makroskopische Bauteile äußerst attraktiv.
Der Einsatzbereich des ParaKnot3D-Konzepts, auf Basis dessen der InNoFa2.0-Demonstrator erstellt wurde, ermöglicht damit stark belastbare, einsatzfähige, individuelle und wirtschaftliche Konstruktionselemente im Stahlbau. ParaKnot3D ist ein hybrides Konstruktionskonzept, bei dem gerade Stäbe mittels spezieller Knotenelemente zu einer Gesamtkonstruktion verbunden werden. Aktuell optimieren die Forschenden das System und erarbeiten verlässliche Prüfverfahren und Zulassungen für die so herstellbaren Bauteile, um diese dann in Pilotprojekten verwenden zu können und die neu entwickelte Technologie von der Forschung in die Wirtschaft zu überführen.
Forschungsgruppe FLEX mit Know-how im 3D-Druck und in digitaler Fertigung
Die Forschungsgruppe FLEX an der HTWK Leipzig ist ein interdisziplinäres Team aus Architektur, Bau- und Wirtschaftsingenieurwesen. Unter Leitung von Prof. Alexander Stahr ist die Forschung zur digitalen Verknüpfung von Planungs- und Ausführungsprozessen mit dem Ziel, Ressourcen in Architektur und Bautechnik effizienter zu nutzen, eine Kernaufgabe der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Die Forschungsgruppe FLEX ist Mitglied im Transferverbund Saxony⁵ der fünf sächsischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften und erweitert diesen durch ihr Know-how auf den Gebieten 3D-Druck und digitale Fertigung, nachhaltige Konstruktionen und parametrisches Design in der Architektur. An den Verbund können sich Akteurinnen und Akteure aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft wenden, um Forschungs- und Entwicklungsprojekte in unterschiedlichen Bereichen zu realisieren.
Forschung verhilft Zollinger-Bauweise zur Renaissance

Blickfang des Ausstellungstandes sind zwei gekrümmte Dachelemente in weiterentwickelter Zollinger-Bauweise. Die Forschungsgruppe FLEX arbeitet seit mehreren Jahren an der Renaissance der über hundert Jahre alten Dachbauweise des Merseburger Stadtrats Friedrich Zollinger. „Die Baumethode war effizient und materialsparend, doch der Aufbau der Dächer war sehr aufwändig. Noch dazu senkten sie sich mit der Zeit ab. Deshalb haben wir konstruktive Mängel beseitigt und den Bauprozess auf der Basis der Möglichkeiten der Digitalisierung deutlich effizienter gestaltet“, erklärt Professor Alexander Stahr. Dafür wurden Stahr und sein Team auf der Denkmal-Messe 2016 mit einer Goldmedaille für herausragende Leistungen in der Denkmalpflege in Europa ausgezeichnet. Aktuell entwickeln die Forschenden die Bauweise dahingehend weiter, dass eine wirtschaftlich effiziente, automatisierte und digital gesteuerte Fertigung und Vormontage durch Zimmerei- und Dachdecker-Betriebe möglich wird. Dafür erhalten die Forschenden gemeinsam mit ihren sieben Projektpartnern aus Wissenschaft und Praxis rund eine Million Euro Förderung vom Bundeslandwirtschaftsministerium.
Augmented Reality für Zimmerleute
Außerdem präsentiert die Forschungsgruppe ein Assistenzsystem für die handwerkliche Vorfertigung von Holzständerwänden mithilfe von Augmented Reality. Besucherinnen und Besucher des Messestands können eine Daten-Brille aufsetzen und mit dieser Unterstützung an einem tischgroßen Modell im Maßstab 1:3 Schwelle, Stiele, Kämpfer und Rähm zum Ständerwerk eines Wandelements in Holzrahmenbauweise fügen. Im zweiten Arbeitsschritt können sie durch die Schalungsplatten „hindurch“ die Lage der Hölzer sehen – eine große Hilfestellung für das millimetergenaue Einbringen von Nägeln, Schrauben, und Klammern. Dadurch wird die handwerkliche Vorfertigung im Holzbau effizienter.
Zu finden sind die Forschenden am Gemeinschaftsstand mit der Bennert GmbH (Stand G45). Der auf die Denkmalsanierung spezialisierte Mittelständler aus Thüringen will in der nahen Zukunft gemeinsam mit der Forschungsgruppe FLEX ein Schirmdach aus Holz für E-Tankstellen umsetzen. Das Design erinnert an einen Blütenkelch und wurde von Markus Schaller und Christopher Stolle im Rahmen ihres Architektur-Studiums an der HTWK Leipzig entworfen.

Museologie & Vermessungskunde präsentieren sich auf MUTEC
Auf der parallel stattfindenden Internationalen Fachmesse für Museums- und Ausstellungstechnik präsentiert die HTWK Leipzig ihren Bachelorstudiengang Museologie (Stand I20) sowie den Masterstudiengang „Museumspädagogik | Bildung und Vermittlung im Museum“ (Stand I16). Als weiterbildender Studiengang kann dieser auch berufsbegleitend absolviert werden. Der Bewerbungszeitraum für das Sommersemester 2023 beginnt am 1. Dezember. Direkt daneben führt Ulrich Weferling, Professor für Vermessungskunde, in die Methode des Heritage Building Information Modeling ein und stellt seine Forschung zur digitalen Rekonstruktion der Villa Sette Bassi aus dem 2. Jahrhundert in Rom vor.
Im Rahmenprogramm der MUTEC am Freitag, dem 25. November, sind die beiden Museumsstudiengänge gleichfalls vertreten. Unter dem Titel „Forschen und Bewahren, Dokumentieren und Interpretieren“ werden von Professor Johannes Tripps und Dr. Britta Schmutzler sowie dem Absolventen Bernhard Baumecker „Einblicke in die Leipziger Museologie“ gegeben (13:30 bis 14:30 Uhr, Moderation: Professorin Gisela Weiß). Im Themenblock „Bewahren“ referiert Professor Markus Walz zu „Dauerarbeit am Kulturellen Gedächtnis – Licht- und Schattenseiten der drei Gedächtnisinstitutionen“ (15.30 Uhr bis 18 Uhr).
Autorinnen: Dr. Rebecca Schweier & Katrin Haase
Das Zollingerdach ins Heute überführt
Die Preise für Holzbauten könnten sinken, wenn die gesamte Branche vom Sägewerk bis zur Zimmerei die Möglichkeiten der Digitalisierung besser nutzt. Wie das gelingen kann, erforscht HTWK-Professor Alexander Stahr gemeinsam mit seiner Forschungsgruppe FLEX. Am Beispiel einer mehr als hundert Jahre alten Dachbauweise demonstrieren sie, wie traditionsreiche Baumethoden mithilfe der Digitalisierung modernisiert werden können und dabei Ressourcen schonen. Mit dem Zollingerdach, einer gekrümmten, freitragenden Konstruktion aus kurzen Hölzern, wurden bis 1928 mehr als tausend Häuser und Hallen in Deutschland überdacht. Stahr und sein Team sehen großes Potenzial im Zollingerdach, denn die Baumethode ist besonders effizient und spart so Material ein. Die Forschenden beseitigten konstruktive Mängel und erweiterten den Bauprozess um die Möglichkeiten der Digitalisierung. Jeder Arbeitsschritt – von der Idee bis zur Umsetzung auf der Baustelle – profitiert davon. Es beginnt bei der Planung mithilfe parametrischer Entwurfswerkzeuge. Algorithmen definieren dabei, wie sich durch die Änderung verschiedener Parameter die Geometrie der Lamelle verändert. Diese Daten werden direkt an die Maschinen für den Zuschnitt weitergereicht: „Heutzutage gibt es computergesteuerte Abbundmaschinen, die Lamellen perfekt und zehntelmillimetergenau zuschneiden. Das verbessert die statische Berechenbarkeit und reduziert den Wartungsaufwand des Daches ungemein“, so Stahr. Die Maschinen können die fertigen Bauteile bereits in der richtigen Reihenfolge stapeln. Eine enorme Zeitersparnis: Statt mehrerer Wochen dauert der Aufbau eines Hallendaches nun nur noch wenige Tage.
„Kostensenkung trotz individueller Einzelteilfertigung – darin liegt für die Baubranche enormes Potenzial. Durchgängig digitale Prozessketten vom Entwurf über die Planung und die Vorfertigung in der Werkhalle bis hin zur Montage auf der Baustelle sind dafür der Schlüssel“, ist Stahr überzeugt. „Dank unserer Forschungen ermitteln wir in einem System die Geometrie, Statik und Wirtschaftlichkeit. Die Informationen kommen am Ende maschinenlesbar heraus, und schon kann der Fertigungsprozess starten.“
Ein Hochhaus – aus Holz!

Auch im Hochhausbau kann Holz eine Alternative sein. Derzeit bestehen mehrstöckige Gebäude meist aus Stahlbeton, denn Beton kann große Lasten tragen und in Kombination mit Stahl beachtliche Flächen überspannen. Doch Stahlbeton verbraucht Unmengen an Energie und Rohstoffen. Zudem setzt er in seiner Herstellung viele Treibhausgase frei. Um jedoch Holz als Baumaterial verwenden zu können, benötigen Bauunternehmen vielerlei statische Daten und Berechnungsmodelle, unter anderem zum Schwingungsverhalten von Holz. Wie verhält sich das Baumaterial beispielsweise, wenn das Gebäude regelmäßigen Erschütterungen aufgrund von fahrenden Straßenbahnen oder Autos ausgesetzt ist? Ein Modell für derartige statische und dynamische Berechnungen für Holzbauten erstellte Armin Lenzen. Als Forschungsgrundlage analysierten der Professor für Baumechanik und sein Team des Instituts I4S der HTWK Leipzig ein mehrstöckiges Holzhaus in Leipzig-Lindenau. Dabei erarbeiteten die Forschenden praxisorientierte Methoden, um mehrgeschossige Holztragwerke im urbanen Raum zu planen und präzise Prognosen über das Schwingungsverhalten zu treffen. Die Ergebnisse wurden 2021 im „Journal of Sound and Vibration“ veröffentlicht.
Expertinnen und Experten treffen: EASTWOOD-Konferenz am 22. und 23. September 2022
Um das Know-how rund um den Umgang mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz in die Breite zu tragen, organisiert die Forschungsgruppe FLEX der HTWK Leipzig gemeinsam mit der Rudolf Müller Mediengruppe am 22. und 23. September 2022 bereits zum zweiten Mal die EASTWOOD. Im Nieper-Bau der HTWK Leipzig tauschen sich rund 150 Fachleute aus Architektur, Ingenieurwesen, Konstruktion, Holzbau, Zimmerhandwerk, Holzhandel, Investition, Wissenschaft und Forschung in Vorträgen über aktuelle Erkenntnisse und Entwicklungen zum Holzbau aus.
Weiterführende Informationen:
Max Vollmering, Maximilian Breitkreuz, Armin Lenzen (2021): Estimation of mechanical parameters based on output-only measurements using Kronecker product equivalence and mass perturbations. Journal of Sound and Vibration 500: 116016. https://doi.org/10.1016/j.jsv.2021.116016
Mit dabei war die Forschungsgruppe FLEX der HTWK Leipzig, an deren Stand Besucherinnen und Besucher eine Augmented-Reality-Brille aufsetzen und erleben konnten, wie diese die Montage des inneren Ständerwerks einer modernen Holzrahmenwand vereinfacht. Neben zahlreichen Familien besuchten auch Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow und Ministerialrat Dr. Bruno Bartscher den Stand der Forschungsgruppe FLEX.
Genauere Informationen zum Programm erhalten Sie auf der Veranstaltungsseite.
]]>
Doch ein Massenprodukt ist Holz als Baustoff bisher nicht, denn Bauen mit Holz ist teurer als mit Stein oder Beton. Die Preise könnten sinken, wenn die Holzbranche vom Sägewerk bis zur Zimmerei die Möglichkeiten der Digitalisierung zukünftig besser nutzt. Wie das gelingen kann, erforscht Alexander Stahr gemeinsam mit seiner Forschungsgruppe FLEX. Der Professor für Tragwerkslehre an der HTWK Leipzig unterstützt den Wissens- und Technologietrander in der Holzbranche, die von kleinen und mittelständischen Unternehmen geprägt ist. "Die Digitalisierung steckt hier mehrheitlich noch in den Kinderschuhen. Gemeinsam mit Partnern aus der Praxis wollen wir aufzeigen, was eine Verknüpfung zwischen digitalem Planen, rechnergestütztem numerischem Abbinden des Holzes und Virtual-Reality-Brillen bei der Vorfertigung ermöglicht", so Stahr.
Not macht erfinderisch

Am Beispiel einer mehr als hundert Jahre alten Dachbauweise demonstrieren die Leipziger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie traditionsreiche Baumethoden mithilfe der Digitalisierung ins Heute überführt werden können – und dabei Ressourcen schonen.
Nach dem Ersten Weltkrieg herrschte Material- und Wohnungsnot. Deswegen erdachte der Merseburger Stadtbaurat Friedrich Zollinger eine besonders effiziente Baumethode für Dächer: eine gekrümmte, freitragende Konstruktion aus kurzen Hölzern, heute bekannt als Zollingerdach. Damit wurden bis 1928 mehr als tausend Häuser und Hallen in Deutschland überdacht. Warum also ist diese sparsame Bauweise so gut wie verschwunden? Was können wir heute, was Zollinger damals noch nicht konnte?
Die Forschenden fanden heraus, dass sowohl technische als auch wirtschaftliche Defizite die Bauweise verschwinden ließen. Der Aufbau war zeit- und personalintensiv und trieb die Baukosten in die Höhe. Außerdem gab es seinerzeit nur acht feste Dachgrößen. Das größte technische Manko: An den Knotenpunkten, wo die Lamellen miteinander verbunden sind, verschob sich die Konstruktion über die Jahrzehnte. Die Dächer verformten sich sukzessive.
So wird eine jahrhundertealte Holzbauweise zukunftsfähig

Trotzdem sehen Stahr und sein Team großes Potenzial im Zollingerdach – denn Ressourcen schonen ist auch heute aufgrund des Klimawandels essenziell. Die Forschenden beseitigten konstruktive Mängel durch ein vereinfachtes Verbindungskonzept und erweiterten den Bauprozess um die Möglichkeiten der Digitalisierung. Jeder Arbeitsschritt – von der Idee bis zur Umsetzung auf der Baustelle – profitiert davon. Es beginnt bei der Planung mithilfe parametrischer Entwurfswerkzeuge. Algorithmen definieren dabei, wie sich durch die Änderung verschiedener Parameter die Geometrie der Lamelle verändert. Diese Daten werden direkt an die Maschinen für den Zuschnitt weitergereicht: "Heutzutage gibt es computergesteuerte Abbundmaschinen, die Lamellen perfekt und zehntelmillimetergenau zuschneiden. Das verbessert die statische Berechenbarkeit und reduziert den Wartungsaufwand des Daches ungemein", so Stahr. Die Maschinen können die fertigen Bauteile bereits in der richtigen Reihenfolge stapeln – eine enorme Zeitersparnis. Statt mehrerer Wochen dauert der Aufbau eines Hallendaches nun nur noch wenige Tage.
"Kostensenkung trotz individueller Einzelteilfertigung – darin liegt für die Baubranche enormes Potenzial. Durchgängig digitale Prozessketten vom Entwurf über die Planung und die Vorfertigung in der Werkhalle bis hin zur Montage auf der Baustelle sind dafür der Schlüssel", ist Stahr überzeugt. "Dank unserer Forschungen ermitteln wir in einem System die Geometrie, Statik und Wirtschaftlichkeit. Die Informationen kommen am Ende maschinenlesbar heraus, und schon kann der Fertigungsprozess starten."
Augmented Reality in der Zimmerei

Auch bei der Vorfertigung in der Montagehalle können digitale Methoden Handwerksleute unterstützen. Gebäude werden heute dreidimensional am Computer entworfen, doch für die Baustelle werden diese digitalen Planungen zumeist auf Papier ausgedruckt. In der Werkhalle müssen die Zimmerleute bisher zahlreiche Geometrie- und Materialangaben gedanklich aus der Zeichnung in die Konstruktion übertragen. Ein an sich unnötiger Arbeitsschritt, bei dem zahlreiche Informationen verloren gehen und Fehler passieren können. Augmented-Reality-Brillen sollen künftig komplexe Informationen aus der Planung präzise komprimiert direkt in die Vorfertigung übertragen.
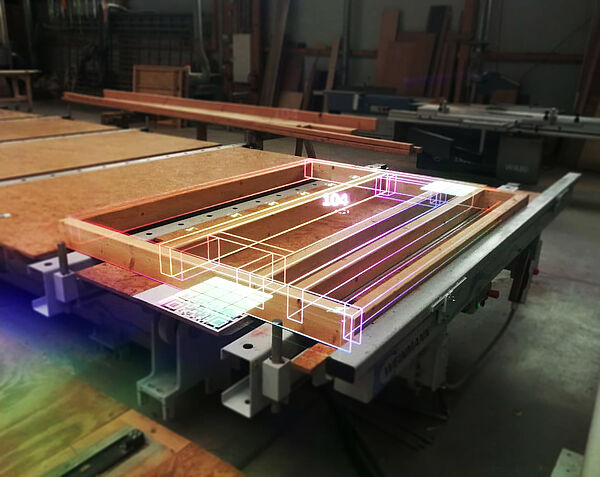
Wer diese Daten-Brillen trägt, sieht zusätzlich zum normalen Sichtfeld virtuell eingeblendete Informationen. Damit können Zimmerleute die dreidimensionalen Fertigungsinformationen direkt auf den Montagetisch projizieren. Auch einzelne Arbeitsschritte sollen durch die Datenbrille zu sehen sein – beispielsweise könnten virtuelle Punkte überall dort auf Holzbrettern aufleuchten, wo Löcher zu bohren oder Schrauben einzudrehen sind.
Ressourcenschonender Dachbau und Datenbrillen bei der Montage: Die zwei Anwendungsfelder zeigen beispielhaft, wie Holzbauunternehmen ihre Produktionsabläufe durch die Integration digitaler Methoden und Technologien verbessern können, um deren Wirtschaftlichkeit zu steigern und dem Baustoff Holz so zu einer Renaissance zu verhelfen. Rechnergesteuerte Fertigung, Augmented Reality und Big Data gehören dann genauso zur Holzbranche wie Hobel, Beitel und Späne.
Dieser Text erschien zuerst im ZEIT Forschungskosmos.
Vernetzung und Transfer

Damit förderte das neue Veranstaltungsformat nach Jahren der Pandemie und den damit einhergehenden eingeschränkten Vernetzungsmöglichkeiten einen intensiven Austausch aller Beteiligten – eine unentbehrliche Grundlage für den Transfer von Wissen in die Praxis.
Einblicke vor Ort

Die Gäste konnten einen Blick hinter die Kulissen des Forschungszentrums und einige der dort bearbeiteten Projekte werfen: Sechs Forschungsteams führten durch das Radiowellentechnikum, die Gründungsberatung Startbahn 13, das Laboratory for Biosignal Processing, das Bodenmechaniklabor, die Bodenversuchshalle und das KomfortLab. Die Forschungsgruppe FLEX zeigte in einem Pavillon eine Datenbrille mit Augmented Reality und ihre mögliche Anwendung in Fertigungsprozessen..
Einige der vorgestellten Forschungsgruppen beteiligen sich an Teilprojekten des im Bund-Länder-Programm „Innovative Hochschule“ geförderten Hochschulverbunds Saxony⁵. Die Veranstaltung selbst wurde im Rahmen des Saxony⁵-Teilprojekts ProTransfer Change Management organisiert.
Eindrücke des Sommernachmittags hielten Kirsten Nijhof und Omid Arabbay im BIld fest:
Der sogenannte „High Power Charger“ (HPC) bietet an den einzelnen Ladepunkten eine Leistung von bis zu 300 Kilowatt an. Elektroautos, die so viel Ladeleistung umsetzen können, sind beispielsweise die Modelle Audi e-tron, Porsche Taycan oder Tesla Model 3. Die Leistung passt sich jedoch den Anforderungen eines jeden Elektroautos an und wird bei Bedarf gedrosselt.
Vollladen während des Einkaufs

Wie schnell ein Auto mit einer HPC-Ladesäule vollgeladen ist, hängt vom Modell, vom Zustand der Batterie und von der Temperatur ab. Ein Tesla Model 3 würde innerhalb von 30 Minuten Ladezeit eine Reichweite von knapp 500 Kilometern erreichen. Dank der eingesparten Ladezeit sind auch lange Strecken mit einem Elektroauto besser zu bewältigen.
„Um die Elektromobilität voranzubringen, muss die Ladeinfrastruktur dringend ausgebaut werden. Deshalb arbeiten wir bereits seit Jahren gemeinsam mit Partnern aus der Wirtschaft an innovativen Lösungen. Mit den Leipziger Stadtwerken konnten wir bereits Ladestationen an Laternen in der Leipziger Innenstadt installieren. Nun ist uns ein weiterer Beitrag für eine Verkehrswende in Leipzig gelungen“, so HTWK-Professor Andreas Pretschner, der das Projekt federführend leitet.
Möglich ist das Schnellladen durch die Verwendung von Gleichstrom statt bisher Wechselstrom. Dabei müssen bei der Herstellung und Anwendung der armdicken Ladekabel höchste Sicherheitsnormen eingehalten werden, worauf die HTWK Leipzig, Siemens und die Leipziger Stadtwerke bei der Entwicklung besonders viel Wert legten.
Taubert Consulting als Backend-Anbieter der Leipziger Stadtwerke kümmert sich um die zentrale Verwaltung und Kontrolle der Ladestationen, so auch bei dem neuen HPC-Lader. Das Team besteht aus Absolventen und ehemaligen Mitarbeitern der HTWK Leipzig.
Erfolgreicher Forschungstransfer und regionale Förderung

„Der Schnelllader in Paunsdorf steht für den erfolgreichen Transfer des Know-hows unserer Hochschule in ein in Leipzig entwickeltes Produkt“, fasst Projektmitarbeiter Martin Leutelt die Transferleistung des Projekts zusammen. Aus Mitteln des im Bund-Länder-Programm „Innovative Hochschule“ geförderten Projekts Saxony⁵ finanziert, ist diese Forschungspartnerschaft ein erfolgreiches Beispiel für den Transfer von Nachhaltigkeit in die Praxis. Um ihre Kompetenzen im Bereich Elektromobilität zu bündeln und den Wissenstransfer zu erleichtern, haben sich Forschende der sächsischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften 2018 im von der HTWK Leipzig geleiteten Saxony⁵-Co-Creation Lab Vernetzte Mobilität zusammengeschlossen.
Weitere Ladeparks geplant

Zukünftig wollen die Leipziger Stadtwerke jährlich zwei neue Schnelladeparks errichten. Für 2023 sind Standorte an der der Alten Messe und in Plagwitz im Gespräch. Dort sollen jeweils acht Ladeplätze entstehen, sechs davon werden mit der Technologie zum Schnellladen ausgestattet. Der Ladestrom wird zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien erzeugt und kann mit herkömmlichen Bezahlsystemen oder mit E-Mobilitätsanbietern über Roaming bezahlt werden. Die Schnellladesäule am Paunsdorf Center befindet sich in der Paunsdorfer Allee 1 in 04329 Leipzig. Die Geokoordinaten sind: 51.348497, 12.475523.
„Ich freue mich außerordentlich mit der RWInnoTec über die Auszeichnung. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hinter dem Unternehmen entwickeln seit Jahren an der HTWK Leipzig und dem UFZ innovative Anwendungen auf Basis der Radiowellen-Technologie. Dass sie 2021 den Sprung in die unternehmerische Selbstständigkeit gewagt haben, um den Transfer ihrer Forschung in die Praxis selbst voranzutreiben, verdient großen Respekt und unterstreicht die hohe Praxis- und Anwendungsorientierung unserer Forschenden“, gratuliert HTWK-Rektor Prof. Mark Mietzner.
Für die Sanierung von Straßen ist die Verwendung von heißem Asphalt vorteilhaft. Wenn im Winter und nachts Asphaltmischwerke geschlossen sind, steht oft jedoch nur Kaltasphalt zur Verfügung. Dieser ist kostenintensiver, hält weniger lange und enthält kritische Lösungsmittel. Das Leipziger Unternehmen RWInnoTec bietet eine Alternative an: „Mit unserer mobilen RWA-24/7-Anlage können wir innerhalb weniger Minuten bedarfsgerecht vorgefertigte Asphaltplatten auf die gewünschte Verarbeitungstemperatur von etwa 160 Grad Celsius erwärmen, ohne dass die Qualität des Asphalts beeinträchtigt wird und Lösungsmittel freigesetzt werden“, sagt Dr. Markus Kraus, langjährig tätig als Physiker am UFZ und Geschäftsführer der RWInnoTec GmbH.
Weitere Anwendungen für Radiowellen-Technologie geplant

Die mobile Radiowellen-Anlage ist das erste Produkt von RWInnoTec. In Zukunft möchte das Unternehmen noch weitere Produkte und Dienstleistungen auf Basis der Radiowellen-Technologie in den Markt bringen. Beispielsweise sollen Radiowellen künftig zur Trocknung feuchten Mauerwerks und zur chemikalienfreien Bekämpfung von Holzschädlingen eingesetzt werden. Beides wurde in den letzten Jahren im Rahmen von Forschungsprojekten des UFZ und der HTWK Leipzig detailliert untersucht und erfolgreich erprobt. „Weil mithilfe von Radiowellen Wärme sehr effektiv im Inneren von Objekten erzeugt werden kann und die Erwärmung nicht über die Oberfläche erfolgt, ist ihre Nutzung in der Regel deutlich energiesparender und kostengünstiger als herkömmliche Methoden. Vor allem kleinere und mittlere Unternehmen sowie Handwerksbetriebe interessieren sich für die neue Technologie, zu der wir – wie auch bei der Asphalterwärmung – sowohl die notwendigen Geräte liefern als auch Schulungen und Unterstützung vor Ort anbieten wollen“, sagt Kraus.
Gewinnervideo zu RWInnoTec vom IQ Innovationspreis Leipzig
Langjährige Forschung geht Gründung voraus
Die Entwicklung der Radiowellen-Technologie am UFZ und an der HTWK Leipzig reicht zurück bis in die 1990er Jahre. Damals untersuchten die Forscherinnen und Forscher den Einsatz von Radiowellen zur thermischen Unterstützung der Bodensanierung, indem bei höheren Temperaturen Schadstoffe aus dem Boden abgesaugt oder biologische Abbauprozesse unterstützt wurden. Nachdem dieses Verfahren erfolgreich in die Praxis überführt wurde, suchten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach weiteren Einsatzmöglichkeiten dieser Methode – etwa um verschiedene technologische Prozesse in der Industrie kostengünstiger und effektiver zu gestalten. „Wir haben mit der thermischen Regenerierung von Adsorbenzien und Katalysatoren experimentiert, die damit kontinuierlich in industriellen Prozessen eingesetzt werden können, und testeten den Nutzen von Radiowellen für die Trocknung von Rohbiogas oder Wasserstoff“, blickt Dr. Ulf Roland zurück. Der Wissenschaftler leitet seit vielen Jahren die einrichtungsübergreifende Arbeitsgruppe im Innovationsnetzwerk RWTec.
RWInnoTec baut auf dieses Fundament auf. Das ist für Ulf Roland einer der Gründe, die ihn trotz des Unternehmensstarts mitten in der Corona-Pandemie optimistisch in die Zukunft schauen lassen: „Die über Jahre kontinuierlich entwickelte Zusammenarbeit zwischen UFZ und HTWK Leipzig, die solide technologische Grundlage und die Einbindung in das Innovationsnetzwerk RWTec lassen eine erfolgreiche Entwicklung von RWInnoTec erwarten.“
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie förderte die Gründung von RWInnoTec über zwei Jahre im Rahmen des Programms EXIST-Forschungstransfer. Die Abteilung Wissens- und Technologietransfer am UFZ sowie das Forschungs- und Transferzentrum der HTWK Leipzig unterstützten diese Entwicklung. Die Unternehmensgründung reiht sich ein in die bereits seit vielen Jahren laufende Kooperation zwischen UFZ und HTWK Leipzig, in der die Grundlagen für zahlreiche gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte geschaffen wurden.
Hintergrund zum IQ Innovationspreis
Mit dem Clusterinnovationswettbewerb IQ Innovationspreis Mitteldeutschland fördert die Europäische Metropolregion Mitteldeutschland neuartige, marktfähige Produkte, Verfahren und Dienstleistungen zur Steigerung von Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in Mitteldeutschland. Der Wettbewerb wird in fünf branchenspezifischen Clustern ausgelobt. Die Innovationen werden in einem mehrstufigen Verfahren von führenden Expertinnen und Experten aus den jeweiligen Clustern unter die Lupe genommen. In unabhängigen Fachjurys ermitteln sie die Clusterpreisträger. Bei der Bewertung stehen die Hauptkriterien Innovationsgrad, Wirtschaftlichkeit und Marktfähigkeit im Fokus. Insgesamt gingen 104 Bewerbungen auf den Preis ein. Die Leipziger Stiftung für Innovation und Technologietransfer vergibt zusätzlich den IQ Innovationspreis Leipzig.
https://iq-mitteldeutschland.de
Finalisten-Video zu RWInnoTec beim Sächsischen Gründerpreis FutureSax
Beim Sächsischen Gründerpreis schaffte es RWInnoTec ebenfalls ins Finale. In diesem Video aus dem Wettbewerb wird die Innovation beschrieben.

Das Forschungsmagazin Einblicke erscheint in diesem Jahr zum zehnten Mal. Seit nunmehr einer Dekade zeigen wir anschaulich, woran unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten und welche Relevanz anwendungsnahe Forschung für die Gesellschaft hat. Forschungskommunikation wie diese spielt eine immer wichtigere Rolle: Entscheidungen der Politik basierten während der Pandemie in einem Maße wie selten zuvor auf Forschungsergebnissen; die Zahl der wirr interpretierten oder verzerrt dargestellten Studien in sozialen Medien nahm zu. Umso wichtiger ist es, dass Forschungseinrichtungen selbst allgemeinverständlich kommunizieren, woran sie arbeiten und welche Erkenntnisse sie gewonnen haben.
Nachhaltig Bauen
In der neuen Einblicke-Ausgabe richten wir den Fokus auf das Thema nachhaltiges Bauen und zeigen, an welchen Lösungen für mehr Nachhaltigkeit unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten. Die Baubranche gehört weltweit zu den Sektoren, die die Umwelt am meisten belasten. Deshalb haben hier schon kleine Verbesserungen große Auswirkungen auf den ökologischen Fußabdruck des Menschen. Carbonbeton statt Stahlbeton, Solarkraft in Häuserwänden und überflutete Auen statt begradigter Flüsse – Ideen gibt es viele. Wir stellen sie vor.
Interviews, Fotoreportage und neue Rubriken
Nicht nur unser Magazin feiert einen runden Geburtstag, auch die HTWK Leipzig freut sich in diesem Jahr über ein Jubiläum. Wir gratulieren zum 30. Jahrestag der Gründung und bringen aus diesem Anlass drei ehemalige und den aktuellen Prorektor für Forschung an einen Tisch, um gemeinsam über Vergangenes und Zukünftiges zu sprechen. In der Fotoreportage wird ordentlich viel Druck gemacht und zwei neue Rubriken schließen die hinteren Seiten ab. Lassen Sie sich überraschen und blättern Sie digital rein: https://www.htwk-leipzig.de/publikationen/einblicke2022
Kostenlos abonnieren
Lesen Sie lieber gedrucktes Wort und möchten die Einblicke kostenlos abonnieren? Eine kurze Nachricht genügt.
Viel Lesevergnügen wünscht Ihnen die Einblicke-Redaktion!

Endlich feiern
Eine feierliche Eröffnung war bisher aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht möglich und wurde am 12. Mai 2022 nachgeholt. Mehr als 70 Gäste aus Hochschule, Wirtschaft und Verwaltung waren bei der Eröffnung im neu gestalteten Kreativraum der Startbahn 13 im HTWK-Forschungszentrum in Leipzig-Reudnitz.
Wissen in Praxis überführen
HTWK-Rektor Prof. Mark Mietzner hob in seiner Begrüßungsrede hervor, dass Sachsen dank seiner Hochschulen zu den innovativsten Bundesländern gehört. Hier werden Jahr für Jahr überdurchschnittlich viele Patente angemeldet. Diesen Trend gelte es zu bekräftigen: „Um das Innovationspotenzial unserer Hochschule zu fördern, braucht es eine koordinierte Anlaufstelle, unter der die Aktivitäten gebündelt und gestärkt werden. Diesen Hub haben wir mit Startbahn 13 erfolgreich geschaffen.“
Die Gründungsberatung leistet einen direkten Beitrag zu Wissenstransfer und Wirtschaftskraft in Sachsen, so Prof. Ralf Thiele, Prorektor für Forschung an der HTWK Leipzig und Leiter der Startbahn 13: „Unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler forschen an neuen Ideen und Technologien, die zur Lösung konkreter praktischer Probleme beitragen. Selbst ein Unternehmen gründen, ist einer der direktesten Wege des Transfers von Wissen in die Praxis.“
Erfolgreich gründen

Das Startbahn-13-Team blickte bei der feierlichen Eröffnung gemeinsam mit den Gästen auf die vergangenen zwei Jahre zurück: Startbahn 13 hat bislang 55 Teams und Einzelpersonen in Coachings und mehr als 180 Gründungsinteressierte in kostenfreien Workshops beraten. Innerhalb der ersten zwei Jahre sind 12 Gründungen daraus hervorgegangen. Dazu gehören der Hersteller umweltfreundlicher Kerzen NatürLicht, das Games-Studio ROTxBLAU und das Ingenieurbüro für Bauwerksprüfung IEXB, die sich mit ihren Angeboten erfolgreich am Markt etabliert haben. „Die Gründungsberatung hat uns bei der Businessplan-Erstellung, beim Marketing-Konzept und bei der Geschäftseinführung geholfen. Ich kann die Beratung bei Startbahn 13 sehr empfehlen, weil man hierdurch Fehler vermeiden kann, die im Gründungsprozess auftreten können“, resümiert IEXB-Geschäftsführer Gunter Hahn.
Mit dem Zwischenstand des Projekts Startbahn 13 ist Dr. Hans-Markus Callsen-Bracker vom betreuenden Projektträger Jülich sehr zufrieden: „Der Bedarf an individueller Gründungsberatung mit technischem und ingenieurwissenschaftlichen Profil ist groß, daher hat die Idee hinter Startbahn 13 großes Potenzial. Die Zahl der Teilnehmenden und erfolgreichen Ausgründungen bestätigt dies nun eindrucksvoll.“
Hintergrund zu Startbahn 13

Im Dezember 2019 setzte sich die HTWK Leipzig im Ideenwettbewerb EXIST-Potentiale des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie durch. Seitdem erhält sie insgesamt 1,5 Millionen Euro, um in vier Jahren die Rahmenbedingungen für Start-ups und wissensbasierte Ausgründungen innerhalb der Hochschule zu verbessern. Seit Beginn des Projekts im April 2020 organisiert Startbahn 13 Netzwerkveranstaltungen, individuelle Coachings und Workshops zu praktischen Themen wie Finanzierung, Geschäfts- und Buchführung oder zum Schreiben von Businessplänen. Darüber hinaus können Gründungsinteressierte vor Ort Werkstätten nutzen, um Prototypen zu entwickeln, oder sich im Kreativraum zum Arbeiten oder Vernetzen treffen.

Gemeinsam erfolgreich: Die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Leipzig, Dresden, Zwickau, Mittweida und Zittau/Görlitz sind Innovationstreibende in ihrer Region. Um dieser Rolle noch besser gerecht zu werden, haben sie sich 2018 im Transferverbund Saxony⁵ zusammengeschlossen, der seit fünf Jahren im Bund-Länder-Programm „Innovative Hochschule“ gefördert wird. Nun steht fest: Der Verbund wird bis 2027 weiterhin mit rund 12,5 Millionen Euro gefördert.
„Unsere Hochschulen für Angewandte Wissenschaft und Fachhochschulen sowie die kleinen und mittleren Universitäten sind mit ihrer Verankerung in der Region Innovationsmotoren für unser Land. Mit der Förderinitiative ‚Innovative Hochschule‘ unterstützen wir ihre Stärken ganz gezielt. Ich freue mich sehr, dass wir aus einer sehr großen Zahl an qualitativ hochwertigen Bewerbungen erneut die besten Initiativen prämieren konnten und damit die Rolle der Hochschulen als Strategiegeber im regionalen Innovationssystem weiterhin stärken werden“, so Bettina Stark-Watzinger, Bundesministerin für Bildung und Forschung.
„Die fünf Hochschulen für Angewandte Wissenschaften im Freistaat Sachsen, die in diesem Jahr ihr 30. Gründungsjahr feiern, sind ein integraler Bestandteil der sächsischen Bildungs- und Forschungslandschaft und haben sich längst zu wichtigen und prägenden Innovationsorten und Impulsgebern für Wirtschaft und Gesellschaft entwickelt. Dass wir uns erneut unter den 165 antragstellenden Hochschulen erfolgreich behaupten konnten, verdeutlicht die Leistungsstärke und traditionell enge und besonders nachhaltige Zusammenarbeit der Hochschulen im Saxony⁵-Verbund. Mein besonderer Dank gilt allen Beteiligten an der HTWK Leipzig und auch den weiteren am Verbund mitwirkenden Hochschulen für ihr unermüdliches Forschungsengagement und den erfolgreichen forschungsbasierten Wissens- und Technologietransfer in die Region“, so Prof. Mark Mietzner, Rektor der HTWK Leipzig.

Von den ursprünglich geförderten 29 Projekten der ersten Förderphase können nur fünf ihre Aktivitäten im Rahmen der zweiten Förderphase des Programms „Innovative Hochschule“ weiterführen. Saxony⁵ unterstützt mit seiner Abdeckung von sowohl städtischen als auch ländlichen Regionen breitflächig das sächsische Innovationsgeschehen.
Prof. Ralf Thiele, Prorektor für Forschung und zugleich fachlicher Projektleiter an der HTWK Leipzig, führt aus: „Wir Hochschulen für Angewandte Wissenschaften sind durch unsere anwendungsnahe Forschung seit jeher eng mit unserem regionalen Umfeld vernetzt. In den kommenden fünf Jahren wollen wir in Saxony⁵ den Transfer von Wissen und Technologien aus unseren forschungsstarken Themenbereichen Struktur- und Klimawandel, nachhaltige Bau- und Werkstoffe und Energiewende noch zielgerichteter gestalten und beschleunigen. Denn für diese zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen braucht es dringend anwendungsreife Lösungen, die nur in engem Austausch von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft entstehen können.“
Thematisch konzentriert sich die Arbeit an den fünf Hochschulen auf die Bereiche Produktion, Energie und Umwelt. Dabei steht der Nachhaltigkeitsaspekt durchgängig im Handlungsmittelpunkt. Die Koordination des Transferverbundes liegt bei der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden.
Korrekturhinweis: In einer früheren Version dieser Pressemitteilung wurde fälschlicherweise eine Antragssumme von 15 Millionen Euro und eine Laufzeit bis 2028 genannt.
Autorin: Dr. Rebecca Schweier
Neue, umweltfreundliche Hochleistungswerkstoffe sind ein Hoffnungsträger im Kampf gegen den Klimawandel. An der HTWK Leipzig nimmt die Werkstoffforschung für Bauindustrie, Maschinenbau und Energietechnik deshalb seit Jahren einen wachsendenden Stellenwert ein. Im Juni 2021 wurde das Kompetenzzentrum für Werkstoffforschung gegründet, um die interdisziplinäre Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Materialforschung und eine fakultätsübergreifende Nutzung vorhandener Gerätetechnik für analytische und werkstoffdiagnostische Fragestellungen zu erleichtern.

Neue Materialien sollen CO₂-Abdruck von Neubauten senken
An innovativen Werkstoffen forscht auch Professor Robert Böhm. Beispielsweise arbeitet er im EU-Forschungsprojekt iClimaBuilt gemeinsam mit seinem Kollegen Klaus Holschemacher, Professor für Stahlbetonbau an der HTWK Leipzig, an der Optimierung der Carbonbeton-Bauweise mit dem Ziel, deren CO₂-Emissionen auf nahezu null zu senken. Dafür wollen die Forschenden beispielsweise die nötigen Carbonfasern aus nachwachsenden Rohstoffen erzeugen. Die neuen Großforschungsgeräte werden helfen, die Leistungsfähigkeit des Materials zu prüfen.

Damit die neuen Großforschungsgeräte langfristig in die Geräteausstattung der HTWK Leipzig übergehen und damit auch weitere Forschungsprojekte unterstützt werden können, stellt die Hochschule zusätzliches Personal, weitere Finanzmittel sowie die notwendigen Räume zur Verfügung.
Prof. Ralf Thiele, Prorektor für Forschung an der HTWK Leipzig: „Der Erfolg im Rahmen der DFG-Ausschreibung freut uns außerordentlich. Mit der Bewilligung der beiden Großgeräte haben wir fakultätsübergreifend die Materialforschung als einen Forschungsschwerpunkt an der HTWK weiter gefestigt. Damit kann unsere Hochschule dazu beitragen, in verschiedenen interdisziplinären Forschungsvorhaben umweltfreundliche Materialien dank der neuen Untersuchungs- und Analysetechnik zu entwickeln.“
Hintergrund zur DFG-Förderung
Mit der Förderung unterstützt die DFG Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, indem sie die vorhandene Geräteinfrastruktur ergänzt und vorhandene Forschungsschwerpunkte gezielt fördert. In der ersten von drei Ausschreibungsrunden wurden in einem Begutachtungsprozess der DFG aus 72 beantragenden Hochschulen lediglich 16 Hochschulen für die Förderung ausgewählt. Unter diesen 16 Hochschulen sind neben der HTWK Leipzig mit Rasterelektronenmikroskop und Computertomograph zwei weitere Hochschulen des Saxony⁵-Verbundes: die Hochschule Mittweida, die ihre vorhandene Laser-Infrastruktur stärken wird, und die Hochschule Zittau/Görlitz, die eine Hochspannungsgleichspannungsprüfanlage erhalten wird.
Bewerbungsvoraussetzungen
- Sie müssen an der HTWK Leipzig immatrikuliert oder angestellt sein
- Sie benötigen einen Praxispartner (Unternehmen, soziale Einrichtung o.ä.), der Ihre Bewerbung unterstützt
Inhalte des Trainee-Programms
- Modus: Training on & off the Job
- Methoden: Digitale Teamtrainings, Fallstudien und Planspiele
- Themen: „Gamification & Storytelling“, „Big Data“, „Innovationsmanagement“, „Cybercrime & Spionageabwehr für KMU“, „Digitales Personalmanagement“
- Abschluss durch Projektarbeit mit Innovations- und Transferbezug
Die Teilnahme am Trainee-Programm ist für alle Beteiligten kostenfrei.
Weitere Informationen & Bewerbung
Ausführliche Informationen finden sich unter: https://saxony5.de/kompetenz/transfer-ueber-koepfe/trainee-programm-innovations-nachwuchs-fuer-sachsen/
Persönliche Beratung: Torsten Hänel (HTW Dresden), Tel.: 0351 / 462 2007, torsten.haenel (at) htw-dresden.de
]]>Fünf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der fünf sächsischen Hochschulen treten beim 3. Saxony⁵ Science Slam am Donnerstag, den 11. Oktober 2021, an. Sie wollen ihr Forschungsprojekt möglichst interessant, kurzweilig und anschaulich präsentieren und am Ende den Pokal als Siegerin oder Sieger mit nach Hause nehmen. Ob PowerPoint-Präsentationen, Requisiten oder Live-Experimente zur Veranschaulichung des Themas – alle Hilfsmittel sind erlaubt, um in kurzweiligen Vorträgen sowohl fachkundiges als auch fachfremdes Publikum mit der Begeisterung für das eigene Thema anzustecken.
Auch Helene Böhme von der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig verlässt ihr Labor und betritt an jenem Abend die Bühne im Filmstudio: „Ich werde den Zuschauerinnen und Zuschauern erklären, warum ich mich mit dem Zuhause der Ninja Turtles beschäftige und wieso es so wichtig ist, auch mal einen Blick nach unten zu werfen“, so die wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Wasserbau und Siedlungswasserwirtschaft.
Neben ihr treten vier weitere Slammer auf. Nach den fünf Vorträgen wird abgestimmt: Welche Slammerin oder welcher Slammer konnte überzeugen? Wer konnte sein Forschungsthema am interessantesten und anschaulichsten vermitteln? Wer hat die Köpfe und Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer gewonnen? Das Publikum entscheidet, wer den Pokal als Vertreterin oder Vertreter der eigenen Hochschule mit nach Hause nehmen darf.
Teilnahme: Anmeldung und Link zum Live-Stream
Die Veranstaltung wird am 11. November 2021 ab 19:00 Uhr live auf dem Saxony⁵ YouTube-Kanal gestreamt.
Wer vor Ort in Mittweida an der Veranstaltung teilnehmen möchte, wird um eine kurze Anmeldung per E-Mail bei Connie Kanter von der Hochschule Mittweida unter kanter (at) hs-mittweida.de gebeten. Bitte beachten Sie, dass ein Nachweis zur Erfüllung der 3G-Regel benötigt wird und der Zutritt mit Covid-19-Symptomen nicht gestattet ist.
Alle Slammerinnen und Slammer mit ihren Themen im Überblick:
Dieses Jahr treten an:
Prof. Dr. Röbbe Wünschiers (Hochschule Mittweida)
Tagebuch einer Biene
Führen Sie ein Tagebuch? Bienen tun dies – etwas technischer könnten wir es auch als Flug-Logbuch bezeichnen. Sie tun dies natürlich nicht bewusst, sondern über den eingesammelten Pollen im Pollenhöschen. Eine Analyse des Pollens gibt Auskunft über die besuchten Blüten. Können wir diese Information entschlüsseln und nutzen? Klaro. Können wir daraus etwas über die Biodiversität rund um den Bienenstock lernen? Vielleicht.
Prof. Dr. Georg Freitag (HTW Dresden)
Übersinnliche Wahrnehmung - die Welt taktil Sehen
Trotz unserer fünf (Haupt-)Sinne nehmen wir nur einen winzigen Bruchteil unserer Umwelt wahr. Für viele der Wunder jenseits des Erlebbaren sind wir sozusagen blind und taub. Der Ansatz des taktilen Sehens ermöglicht es erstmals die Welt um uns herum mit Hilfe des augmentierten Tastsinns zu erkunden. Die hierbei spürbaren Sinneseindrücke eröffnen neue Chancen und ungeahnte Welten – eine übersinnliche Erfahrung.
Dipl.-Ing. Jens Maiwald (Hochschule Zittau/Görlitz)
Keiner weiß, was der Andere macht, trotzdem wird an alle gedacht
Strom kommt aus der Steckdose – steile These, aber stimmt so weit. Im Hintergrund jedoch rücken die Erzeuger immer näher an den Verbraucher heran. Die Märkte hingegen bleiben starr. Jens Maiwald stellt sich die Frage: was, wenn nicht?! Was passiert, wenn Strom nicht nur vor der Haustür erzeugt, sondern auch verkauft wird?
Prof. Dr. Mike Espig (Westsächsische Hochschule Zwickau)
Die Leiden des jungen StronKI
Sogenannte Schwache Künstliche Intelligenzen sind bereits fester Bestandteil unseres Alltags: Spracherkennung, Navigationssysteme, Übersetzungstools. Die wahre Herausforderung sind Starke KI, die selbstständig Aufgaben erkennen, analysieren und lösen können. Bisher kennen wir solche Intelligenzen nur aus Science-Fiction-Filmen – Prof. Dr. Mike Espig arbeitet daran, ihnen auch in der Realität aus den Kinderschuhen zu helfen.
M. Sc. Helene Böhme (HTWK Leipzig)
Die Stadt unter der Stadt – warum Kanäle stinken (oder auch nicht)
Abwasserentsorgung ist ein Thema, das alle berührt, aber über das niemand gerne redet. Die „Stadt unter der Stadt“ kennt man eher als das Versteck von mutierten Kampfschildkröten oder mystischen Monstern als Arbeitsort. Wie unser Kanalnetz funktioniert und warum gutes Abwasser nicht stinkt, darum geht es bei Helene Böhme.
Hintergrund: Hochschulzusammenarbeit in Sachsen mit Saxony⁵
Mit Saxony⁵ bündeln die sächsischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Leipzig, Dresden, Mittweida, Zittau/Görlitz und Zwickau mit weiteren Partnerinnen und Partnern ihre Ressourcen und Kompetenzen in einem Transferverbund. Durch interdisziplinäre Zusammenarbeit und intelligente Vernetzung stärkt der Hochschulverbund den forschungsbasierten Wissens- und Technologietransfer in Sachsen und befördert eine neue Qualität von Innovationen sowie neuen Forschungsprojekten.
Der Markt wächst rasant und mit ihm die Erkenntnis, dass guter Holzbau nur gelingen kann, wenn hervorragend ausgebildete Architektinnen und Architekten, Ingenieurinnen und Ingenieure, Holzbau-Fachleute und Bauherren bzw. Investoren Hand in Hand arbeiten.

Die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig) hat sich in den vergangenen Jahren eine in der Branche bekannte und anerkannte Expertise insbesondere auf dem Gebiet des so genannten digitalen Holzbaus erworben. Die angewandte Holzbauforschung speziell im Bereich stützenfreier Hallendächer nach dem so genannten Brettrippenprinzip („Zollingerdächer“) oder für den Bau landwirtschaftlich genutzter Hallen auf der Basis digitaler Methoden und Modelle hat zahlreiche Innovationen hervorgebracht.
Um die Branche zu vernetzen, veranstaltet die Hochschule am 7. und 8. Oktober 2021 erstmals – in Kooperation mit der Rudolf Müller Mediengruppe – die Holzbaukonferenz „EASTWOOD“: „Die Hochschule ist der ideale Ort, um die Experten auf dem Gebiet des Bauens mit Holz zusammen und das Thema auch im Osten Deutschlands nach vorn zu bringen. Der Titel ist daher Programm: Verschiedene Referenten aus Holzbau-Praxis - und Forschung werden nach Leipzig kommen, um ihr Wissen und ihre Perspektiven für den digitalen Holzbau zu teilen. Als Teil der Sächsischen Holzbauinitiative schaffen wir in Leipzig eine überregionale Plattform für fachlichen Austausch, neue Impulse und fürs Netzwerken“, sagt Initiator und Organisator Alexander Stahr, Professor für Tragwerkslehre an der HTWK Leipzig.
Themen der Referate sind unter anderem Entwurfsstrategien zum ressourceneffizienten Bauen mit Holz, Brandschutz im Holzbau und die Realisierung mehrgeschossiger Wohnungsbauten in Holz.
„Das Bauen mit Holz ermöglicht innovative Lösungen mit einem nachhaltigen und umweltfreundlichen Baustoff“, so der Sächsische Staatsminister für Regionalentwicklung Thomas Schmidt. „Wir haben diesen Baustoff deshalb seit der Gründung des Ministeriums fest im Blick. Mit der Novelle der Sächsischen Bauordnung werden wir Erleichterungen für das Bauen mit Holz schaffen. Der Aufbau eines Holzbaukompetenzzentrums unter dem Dach unserer Zukunftsinitiative simul+ ist ebenfalls auf mehr Einsatz von Holz gerichtet. Der Ansatz, dass Wissenschaft und Praxis Hand in Hand gehen, ist das Prinzip von simul+. Darum unterstützen wir auch die EASTWOOD in Leipzig.“

„Wir als HTWK Leipzig orientieren uns an der so genannten FONA-Strategie („Forschung für Nachhaltigkeit“), die die Hightech- und Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung mit nationalen Nachhaltigkeitszielen und -strategien sowie europäischen Ansätzen verbindet. Der Wandel zu mehr Nachhaltigkeit ist die Chance, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands langfristig zu erhalten. Innovationen sind dafür von entscheidender Bedeutung – im Leitbild der FONA sind dabei u.a. Nachhaltigkeit und themenübergreifend Digitalisierung verankert. Für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der HTWK bedeutet dies eine intensive interdisziplinäre Auseinandersetzung mit Bauverfahren und Baumaterialien unter dem Gesichtspunkten Ressourcenknappheit, Energiebilanz und Digitalisierung - was passt da besser als die Tagung EASTWOOD?“, ergänzt Prof. Ralf Thiele, Prorektor für Forschung der HTWK Leipzig.
„Seine Klimabilanz als CO2-Speicher, sein Charakter als nachwachsende Ressource und nicht zuletzt seine ästhetischen Qualitäten machen den Rohstoff Holz auch aus städtebaulicher Perspektive immer interessanter.
Deshalb freue ich mich, dass das Thema mit der Eastwood in Leipzig einen echten Schub bekommt“, freut sich Thomas Dienberg, Bürgermeister und Beigeordneter für Stadtentwicklung und Bau Leipzigs.
Hintergrund
„EASTWOOD“ ist eine Veranstaltung der Forschungsgruppe FLEX an der HTWK Leipzig und der Rudolf Müller Mediengruppe. Im Fokus steht der Aufbau eines initial ostdeutschen Netzwerkes als Erfordernis für die beschleunigte Entwicklung des Bauens mit Holz im Kontext eines digitaler werdenden Marktes. Dahinter steht die Überzeugung, dass die richtige Konzeption Voraussetzung für ressourceneffizientes, klimaneutrales Bauen ist.
Die Forschungsgruppe FLEX (Forschung. Lehre. Experiment) arbeitet disziplin-, werkstoff- und technologieübergreifend an innovativen Lösungen an der Schnittstelle von Architektur, Bau- und Informationstechnik. Stark praxisorientiert, stehen dabei digital basierte Strategien für ressourceneffiziente Konstruktionen sowie die zugehörigen Planungs- und Fertigungsprozesse im Fokus des Interesses von Architektur- und Baufachleuten sowie Wirtschaftsingenieuren und -ingenieurinnen. FLEX ist Mitglied im Co-Creation Lab „Additive Fertigung“ des Transferverbunds Saxony⁵ der fünf sächsischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften.
Die Rudolf Müller Mediengruppe ist führend auf dem Gebiet von Fachinformationen in den Bereichen Planen, Bauen, Immobilien und Handelsmarketing.
Ort: „Eastwood“ ist ein digitales Live-Event: Die Referenten sind vor Ort, zu sehen ist es ausschließlich im Live-Stream.
Zeit: 07./08. 10. 2021 jeweils ab 13 Uhr
Für die Teilnahme an „Eastwood“ können Architektinnen und Architekten Fortbildungspunkte erhalten.
Programm, Ticketpreise und Link zur Anmeldung: https://www.eastwood-leipzig.de/
Weiterführende Informationen: Webpräsenz der HTWK-Forschungsgruppe FLEX
Mit einem Klick vom Sofa in die Hochschule – bei der ersten virtuellen Langen Nacht der Wissenschaften war das möglich. Ab 18 Uhr konnten sich Besucherinnen und Besucher am Freitag, den 16. Juli 2021, online durch den Nieper-Bau bewegen, der zum virtuellen Ausstellungsraum wurde. HTWK-Rektor Mark Mietzner, der darin ähnlich wie in den „Star Wars“-Filmen als Hologramm aufleuchtete, begrüßte sie mit der Frage: „Sie wollten schon immer einmal wissen, wieso unsere Hochschule Kanus aus Beton baut oder wie ein Fußball-Roboter zum Weltmeister wird?“ Antworten darauf und viele weitere interessante Themen gab es bis Mitternacht zu entdecken.
Durch die Corona-Pandemie wurde die Großveranstaltung digital durchgeführt. Trotzdem beteiligten sich fast alle Leipziger Forschungseinrichtungen und stellten gemeinsam mit der Stadt Leipzig ein vielfältiges Programm mit fast 400 Beiträgen zusammen. Die Stadt Leipzig schätzt, dass trotz des warmen und ersten masken- und testfreien Sommerabends bis zu 7.000 Kinder und Erwachsene teilnahmen.
Auch an der HTWK Leipzig brachten sich Professorinnen und Professoren, Mitarbeitende und Studierende aus 20 Lehr- und Forschungsbereichen ein. Statt Ausstellungsständen bauten sie sich dieses Mal ihre Übertragungsstudios im Labor, im Büro oder zu Hause auf. Über 1.600 Mal wurden die Live-Veranstaltungen, interaktiven Formate und vorproduzierten Videos der HTWK Leipzig angeklickt.
Sehr viel Spaß gehabt und wieder was gelernt


Besonders beliebt waren die Angebote für Kinder. Schnell vergriffen waren die Bastelpakete, mit denen Kinder Kühlschrankmagneten aus Beton herstellen konnten. Sowohl Kinder als auch Eltern bedankten sich bei Ludwig Hertwig vom Betonkanuteam „für die tolle Idee“, denn sie hatten „sehr viel Spaß“. Hertwig erzählt: „Mit der Bastelaktion konnten die Kinder den Baustoff Beton kennenlernen. Mit Beton lassen sich heute viele Sachen machen, zum Beispiel Kanus herstellen oder Lichtwellenleiter integrieren.“
Auch die Mitarbeiterinnen der Hochschulbibliothek freuten sich über die mehr als 200 Kinder, die auf eine digitale Schnitzeljagd gingen. Dabei konnten die 9- bis 13-Jährigen mit Spielen ihr Wissen rund ums Internet, Social Media und Computerspiele testen. Rund 50 Kinder holten sich am Ende ihren Gewinn ab, ein Hörspiel zum Download.

Erwachsene konnten online verschiedene Vorträge, Workshops und Live-Demonstrationen besuchen. In kleineren und größeren Gruppen sprachen die Besucherinnen und Besucher mit Expertinnen und Experten beispielsweise über Solarenergie, Elektromobilität, nachhaltige Verpackungen, Social Media in Museen, Künstliche Intelligenz oder 3D-Modellierung im Bauwesen. Dabei lernte so mancher Gast wieder etwas Neues, wie es hier und da im Chat hieß. HTWK-Laboringenieur Lukas Kube präsentierte zum ersten Mal sein Spezialgebiet bei der Langen Nacht der Wissenschaften – 3D-Druck im Maschinenbau: „Durch die überschaubare Besucherzahl konnte ich gut ins Detail eingehen. Besonders gefreut habe ich mich, dass sich auch Schüler der höheren Klassenstufe für das Thema interessierten.“
Online weiterhin verfügbare Streams, Videos und Plattformen
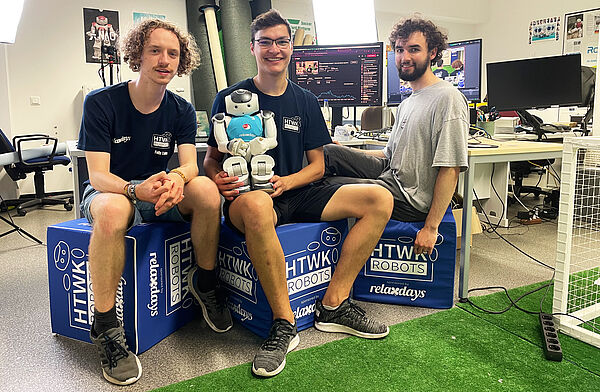
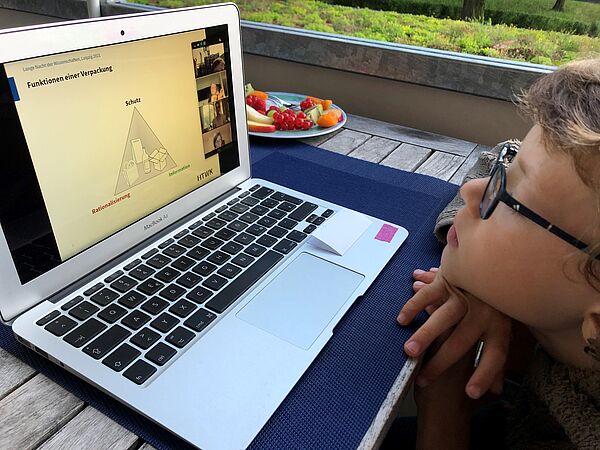
Einige Angebote sind weiterhin online. Neben der digitalen Schnitzeljagd ist zum Beispiel der gesamte Live-Stream der HTWK Robots bei Youtube hinterlegt. Ebenfalls können alle Videos – darunter ein Konzert des HTWK-Orchesters oder die Ergebnissen des Promovierenden-Wettbewerbs „Außergewöhnlich angewandt“ – weiterhin abgerufen werden.
Langfristig verfügbar sind zudem die virtuellen Labore der Geotechnik und der digitale Showroom zu Carbonbeton. Im virtuellen Ausstellungsraum befinden sich außerdem 3D-Modelle, beispielsweise zu Bauteilen aus Carbonbeton oder von einem HTWK-Gebäude. Um die virtuellen Räume optimal erlebbar zu machen, gab die HTWK Leipzig zuvor an Interessierte Virtual-Reality-Brillen aus Pappe aus.
Etwas in Präsenz gab es aber doch …
Alles war aber nicht online. An der HTWK Leipzig fanden drei Rundgänge in Präsenz durch das Sanitärtechniklabor statt. Die Kinder und Erwachsenen staunten über das dreigeschossige Abwassersystem und waren überrascht, wie so ein System funktioniert und was es beim Spülen zu beachten gibt. „Man ist ja als Laie immer überrascht wie komplex manch scheinbar einfache Systeme, wie eben ein Rohrleitungssystem, eigentlich sind und was für äußere Einflüsse beim Funktionieren eine Rolle spielen“, so Olivia de Almeida, Museologie-Studentin an der HTWK Leipzig.
Bei der nächsten Langen Nacht der Wissenschaften werden hoffentlich wieder weitere und Forschungsbereiche in Präsenz öffnen können. Den nächsten Termin geben wir Anfang 2022 an gewohnter Stelle bekannt.
Einige Impressionen der Wissenschaftsnacht an der HTWK Leipzig
Alle Veranstaltungen können Besucherinnen und Besucher im virtuellen Ausstellungsraum der Hochschule auch in 3D entdecken. Wer zur optimalen Sicht eine Virtual-Reality-Brille aus Pappe für sein Smartphone zugesendet bekommen möchte, schreibt eine E-Mail an lndw2021@htwk-leipzig.de.
Prof. Ralf Thiele, Prorektor für Forschung der HTWK Leipzig: „Weil die diesjährige Wissenschaftsnacht erstmals virtuell stattfindet, beteiligt sich auch die HTWK Leipzig mit einem neuen Konzept. So wollen wir Wissenschaft von zu Hause für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlebbar machen und ihnen Einblicke in die neuesten Entwicklungen und spannenden Forschungen an unserer Hochschule bieten."
Schnitzeljagd und Basteln mit Beton für Kinder
Bereits um 14 Uhr beginnt das Programm für Kinder. Mädchen und Jungen von 9 bis 13 Jahren können dann auf eine digitale Schnitzeljagd gehen. Wer sich auskennt mit Computerspielen, Social Media und dem Internet, gewinnt mit etwas Glück am Ende eine Überraschung. Ebenfalls zu Hause können Kinder Kühlschrankmagneten aus Beton basteln. Das nötige Material und die Anleitung kommen vorab kostenfrei per Post oder können vor Ort abgeholt werden. Eine Anmeldung ist notwendig.
Forschung erleben: Von Elektromobilität über Photovoltaik bis Sanitärtechnik
Ab 18 Uhr schaltet die HTWK Leipzig parallel zu den anderen Leipziger Wissenschaftseinrichtungen weitere Aktionen frei. Dazu gehören Experimente, Demonstrationen, Vorträge und Videos sowie ein kleines Konzert. Unter anderem befassen sich die Vorträge und Workshops mit Fragen wie „Sind Roboter unter uns?“, „Was haben ein Klumpen Knete und Kartoffelsuppe mit Statistik zu tun?“ oder „Ist Elektromobilität wirklich effizient?“.
Technikinteressierte können an einem interaktiven Versuchsstand selbst eine Photovoltaik-Anlage vermessen und testen, wie sich Tages- und Jahreszeit auf ihre Leistung auswirken. Einen seltenen Einblick in einen sonst nicht zugänglichen Ort erhalten Besucherinnen und Besucher beim Rundgang durch das Sanitärtechniklabor, das von Studierenden liebevoll „Klo-Labor“ genannt wird. Die Gäste erfahren, wie ein Abwassersystem im Haus funktioniert, warum es zu Verstopfungen kommt und wozu speziell geformte Materialproben eingesetzt werden. Das Sanitärtechniklabor kann nur vor Ort nach vorheriger Anmeldung an lndw2021@htwk-leipzig.de besichtigt werden.
Virtuelle Welten rund ums Bauen
In Virtual Reality können neben dem Ausstellungsraum zwei weitere Aktionen der HTWK Leipzig besichtigt werden: Ein digitaler Showroom zeigt, wie in Zukunft Gebäude nachhaltig und effektiv gestaltet werden können. Beim digitalen Blick in die bodenmechanischen Labore erleben Interessierte, wie und warum Boden erforscht wird.
Bauen ist am Abend der Wissenschaftsnacht auch bei weiteren Aktionen ein Thema: So wird demonstriert, wieso es im Verlauf des Klimawandels immer wieder zu Überflutungen durch Starkregen kommt und wie Straßen und Häuser davor geschützt werden können. Solche Informationen könnten bereits beim Neubau von Gebäuden genutzt werden. Die Planungen von Neubauten werden heute fast alle dreidimensional durchgeführt. Ob sich das Arbeiten in 3D auch auf bestehende Gebäude oder sogar im Bereich der Archäologie anwenden lässt, erfahren Besucherinnen und Besucher im direkten Gespräch mit den Forschenden.
Hintergrund
Die Lange Nacht der Wissenschaften ist eine gemeinsame Veranstaltung der Leipziger Forschungseinrichtungen und der Stadt Leipzig. Dieses Jahr findet sie erstmals als digitale Veranstaltung statt und ist somit auch Gästen außerhalb Leipzigs zugänglich. Das Gesamtprogramm kann unter www.wissen-in-leipzig.de abgerufen werden.
Weiterführende Informationen:
Zum Programm der HTWK Leipzig

Auf zur Nacht, die Wissenschaft schafft. – Unter diesem Motto laden die Leipziger Wissenschaftseinrichtungen gemeinsam mit der Stadt Leipzig am Freitag, den 16. Juli 2021, interessierte Gäste zur ersten virtuellen Langen Nacht der Wissenschaften 2021 ein. Virtuell, online und digital öffnen die Einrichtungen ihre Labore, Hörsäle, Magazine und Archive. Die HTWK Leipzig beteiligt sich mit rund 20 Präsentationen, Mitmachaktionen, Führungen, Vorträgen und Vielem mehr für Groß und Klein, die entweder durchgehend oder zu bestimmten Uhrzeiten teils mehrfach stattfinden.
Programm online
Das HTWK-Programm ist ab sofort online auf der HTWK-Website sowie beim HTWK-Facebook-Account abrufbar. Parallel dazu wurde heute das gesamte Programm aller Leipziger Einrichtungen auf der Website www.wissen-in-leipzig.de veröffentlicht. Dort können Interessierte unter dem Punkt „Meine Nacht“ sich ihre bevorzugten Veranstaltungen zusammenstellen.

Worauf können Gäste an der HTWK Leipzig gespannt sein?
Besucherinnen und Besucher können an der HTWK Leipzig virtuelle Welten erleben: Das Foyer des Lehr- und Laborgebäudes Nieper-Bau wird am Abend der Wissenschaftsnacht als virtueller Ausstellungsraum begehbar sein. Gäste entdecken dort im 360-Grad-Blickwinkel alle Aktionen und werden dort auch HTWK-Rektor Mark Mietzner antreffen. Von dort aus können Interessierte weitere Aktionen in Virtual Reality (VR) erleben und einen Blick ins Bauen der Zukunft mit Carbonbeton werfen oder interaktiv ein bodenmechanisches Labor besichtigen. Zur optimalen Darstellung können die Aktionen mit einer VR-Brille erlebt werden. Alle Aktionen sind auch ohne VR-Brille und beispielsweise per Tablet oder Computer ansehbar.
Besucherinnen und Besucher können sich eine VR-Brille aus Pappe bei der HTWK Leipzig abholen oder per Post zusenden lassen (nutzbar für Smartphones mit bis zu 8,5 cm Breite). Das Angebot an VR-Brillen ist begrenzt, so dass keine Gewähr besteht. Anfragen richten Interessierte an: lndw2021@htwk-leipzig.de.

Empfehlungen für Kinder
Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren können bei der digitalen Schnitzeljagd der HTWK-Bibliothek sowohl Wissen als auch Spielespaß miteinander verknüpfen. Wer sich auskennt mit Computerspielen, Social Media und Fakten rund ums Internet, kann am Ende eine Überraschung erhalten. Weiter wird es eine Bastelaktion mit Beton geben. Kinder können hier zu Hause Kühlschrankmagneten selbst herstellen. Eine Anmeldung zur Bastelaktion ist notwendig.


Experimente, Demonstrationen, Vorträge
Ab 18 Uhr werden verschiedene Experimente und Demonstrationen vorgeführt: Interessierte können an einem interaktiven Versuchsstand selbst die Leistung einer Photovoltaik-Anlage vermessen und testen. Sie können sich mit aktuellen Herausforderungen der Elektromobilität befassen oder sich bei der Frage „Sind Roboter unter uns?“ auf unterhaltsame Weise mit exemplarischen Anwendungsbeispielen der Robotertechnik auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz beschäftigen. Weitere Demonstrationen gibt es im Bereich „3D-Druck im Maschinenbau“, bei der „3D-Modellierung im archäologischen Kontext“ sowie bei den Workshops „Kunststoffe – verachtete Alltagshelden?“ und „Nachhaltige Lebensweise: Wie innovativ können Verpackungen aktuell sein?“. Auch das Sanitärtechniklabor, das auch liebevoll „Klo-Labor“ genannt wird, ist mit Anmeldung geöffnet.
Daneben gibt es verschiedene Vorträge, darunter zu den „Ursachen der Überschuldung von Privatpersonen“ und zur Frage „Was ein Klumpen Knete und Kartoffelsuppe mit Statistik zu tun haben?“. Lediglich für den zweiten „MuseumsIMPULS“ müssen sich Interessierte vorher anmelden.

Was gibt es noch?
Unsere Gäste können außerdem entdecken, wie Kuka-Roboter arbeiten, wie Grundstücke vor Überflutung durch Starkregen geschützt werden können oder wie Beton-Kanus gebaut werden. Außerdem zeigen die Nao-Fußballroboter der HTWK Leipzig am Abend ihr fußballerisches Können, das Graduiertenzentrum präsentiert die besten Einsendungen des Promovierenden-Wettbewerbs als Video und es wird ein Workshop zur Studienorientierung angeboten. Und all jene Besucherinnen und Besucher, die zwischendrin etwas Musik lauschen wollen, können sich ein kurzes Konzert des HTWK Orchesters gönnen.
Am 16. Juli 2021 finden Sie auf der Programmseite auch unseren virtuellen Ausstellungsraum (3D) und unser Social Media-Gewinnspiel.
Vom 1. Juni 2021 bis zum 31. November 2022 erforschen die Wissenschaftler der HTWK Leipzig gemeinsam mit Experten aus der Praxis, dem Dienstleister für Building Information Modeling BCS CAD+IT und dem Handwerksunternehmen Holzbau Lepski aus Dresden, wie die Anwendung der Datenbrille technologisch umgesetzt werden kann, damit komplexe, dreidimensionale Montageinformationen aus der Planung, präzise komprimiert direkt in die Vorfertigungshalle übertragen werden. Der Name „OptiPaRef“ steht für „optisch parametrische Bauteilreferenzierung“. Finanziert wird das Forschungsprojekt durch das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWI).
So helfen die Datenbrillen bei der Montage

Die Forscher nutzen Datenbrillen für sogenannte Augmented Reality, einer Technologie, die die visuelle Realität um virtuelle Darstellungen erweitert. Wer diese technischen Brillen trägt, sieht zusätzlich zum normalen Sichtfeld virtuell eingeblendete Informationen. Damit können Zimmerleute die dreidimensionalen Montagepläne direkt vor Ort genau dorthin projizieren, wo das Gebäude später stehen soll. Auch einzelne Arbeitsschritte der Montage sollen durch die Datenbrille zu sehen sein – beispielsweise könnten virtuelle grüne Punkte auf Holzbrettern überall dort aufleuchten, wo der Zimmermann ein Loch bohren soll. Vorstellbar ist auch, dass der Brillenträger per Handgesten die Datenbrille bedient und so durch die jeweiligen Arbeitsschritte und Pläne blättert. Mit der Datenbrille, die mit dem Umfang einer hochwertigen Arbeitsschutzbrille vergleichbar ist, können sich die Zimmerleute jederzeit frei in der Werkhalle bewegen.
Felix Schmidt-Kleespies, Projektverantwortlicher der Forschungsgruppe, sieht ein enormes wirtschaftliches Potenzial in der Digitalisierung der Montage:
„OptiPaRef ist ein innovativer und hochgradig anspruchsvoller Ansatz für ein völlig neues Planungsmodell im Holzbau. Für Holzbauunternehmen bedeutet das einen Mehrwert zum Anfassen – ein eher seltener Effekt der digitalen Transformation des Baugeschehens.“
Vorteile der Montage mit Datenbrillen
In der Werkhalle müssen die Zimmerleute bisher zahlreiche Geometrie- und Materialangaben gedanklich aus der Zeichnung in die Konstruktion übertragen. Dabei ist es notwendig, diese mehrfach zu prüfen und beispielsweise Achsabstände zu messen, um jeden Balken exakt zu positionieren – ein zeit- und kostenintensiver Prozess. Die Defizite der bisherigen Informationskette am Übergang von digitaler Werkplanung zu handwerklicher Ausführung werden mit der neuen Methode eliminiert. Das Bauen selbst soll mithilfe der Technologie schneller und weniger fehleranfällig werden. Zeitintensive Prozesse mit hohem Wiederholungsfaktor sollen vereinfacht und komplexe Planungsinformationen kontextabhängig und papierlos angezeigt werden. Somit können kleine und mittlere Holzbauunternehmen ihre Produktionsabläufe optimieren, ohne sich mit umfangreichen Investitionen in automatisierte Fertigungstechnik einem erhöhten finanziellen Risiko auszusetzen.
Bauen mit Holzrahmen – wachsende Nachfrage
Das Forschungsprojekt setzt die Digitalisierung der Montage beim Bauen mit Holzrahmen um – eine weiterentwickelte, moderne Form des Fachwerkbaus. Mit der Holzrahmenbauweise können kleine und mittlere Unternehmen Wandelemente in handwerklicher Produktion auch ohne große maschinelle Ausstattung herstellen. Die Arbeitsschritte wiederholen sich häufig und sind aufwändig. Einzeln auf Länge zugeschnittene Hölzer werden dabei individuell positioniert, durch Nägel oder Schrauben miteinander verbunden und anschließend mit Holzwerkstoff- oder Gipskartonplatten verschlossen.
Das Interesse am nachhaltigen Baustoff Holz steigt spürbar. Bauherren können mit Holz ressourceneffizient bauen und sparen dank des hohen Vorfertigungsgrads von Holzrahmen auf der Baustelle Zeit und Kosten. Vor dem Hintergrund eines steigenden Preisdrucks, dem schwachen Arbeitsmarkt im Handwerkssektor und dem stetig wachsenden Bedarf an Holzfertigteilen sind Unternehmen gezwungen, ihre Arbeitseffizienz zu steigern. Innovative Lösungen sind daher gefragt.
Die Forschungsgruppe FLEX (Forschung. Lehre. Experiment) arbeitet disziplin-, werkstoff- und technologieübergreifend an innovativen Lösungen an der Schnittstelle von Architektur, Bau- und Informationstechnik. Stark praxisorientiert, stehen dabei digital basierte Strategien für ressourceneffiziente Konstruktionen sowie die zugehörigen Planungs- und Fertigungsprozesse im Fokus des Interesses von Architektur- und Baufachleuten sowie Wirtschaftsingenieuren und -ingenieurinnen. FLEX ist Mitglied im Co-Creation Lab „Additive Fertigung“ des Transferverbunds Saxony⁵ der fünf sächsischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften.
Verfahren in der Bauwirtschaft etablieren
Der Schwerpunkt des neuen Unternehmens wird zunächst darin liegen, radiowellenbasierte Verfahren in der Bauwirtschaft zu etablieren. Dies betrifft zum Beispiel die Sanierung von Straßenschäden mit vor Ort aufgeheiztem Asphalt – eine Methode, die gegenüber derzeit üblichen Verfahren unabhängig von der Jahreszeit eingesetzt werden kann. „Unsere Methode ist in der Lage, schnell, das heißt innerhalb weniger Minuten, und bedarfsgerecht vorgefertigte Asphaltplatten auf die gewünschte Verarbeitungstemperatur von etwa 160 Grad Celsius zu erwärmen, ohne dass die Qualität des Asphalts beeinträchtigt wird und Lösungsmittel freigesetzt werden“, sagt Dr. Markus Kraus, Physiker am UFZ und jetzt auch Geschäftsführer der RWInnoTec GmbH. Ein entsprechender Prototyp wird noch in diesem Jahr einsatzbereit sein. Weitere Anwendungsfelder sehen die Firmengründerin und -gründer in der Mauerwerkstrocknung und dem chemikalienfreien Holzschutz. Beides wurde in den letzten Jahren im Rahmen von Forschungsprojekten des UFZ und der HTWK Leipzig detailliert untersucht und erfolgreich erprobt. „Weil mithilfe von Radiowellen Wärme sehr effektiv im Inneren von Objekten erzeugt werden kann und die Erwärmung nicht über die Oberfläche erfolgt, ist ihre Nutzung in der Regel deutlich energiesparender und kostengünstiger als herkömmliche Methoden. Vor allem kleinere und mittlere Unternehmen sowie Handwerksbetriebe interessieren sich für die neue Technologie, zu der wir sowohl die notwendigen Geräte liefern als auch Schulungen und Unterstützung vor Ort anbieten wollen“, sagt Kraus.
Einrichtungen arbeiten seit vielen Jahren zusammen
Die Entwicklung der Radiowellen-Technologie am UFZ reicht zurück bis in die 1990er Jahre. Damals untersuchten die UFZ-Forscherinnen und -Forscher den Einsatz von Radiowellen zur thermischen Unterstützung der Bodensanierung, indem bei höheren Temperaturen Schadstoffe aus dem Boden abgesaugt oder biologische Abbauprozesse unterstützt wurden. Nachdem dieses Verfahren erfolgreich in die Praxis überführt wurde, suchten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach anderen Einsatzmöglichkeiten dieser Methode – etwa um verschiedene technologische Prozesse in der Industrie kostengünstiger und effektiver zu gestalten. „Wir haben mit der thermischen Regenerierung von Adsorbenzien und Katalysatoren experimentiert, die damit kontinuierlich in industriellen Prozessen eingesetzt werden können, und testeten den Nutzen von Radiowellen für die Trocknung von Rohbiogas oder Wasserstoff“, blickt Dr. Ulf Roland zurück. Der Wissenschaftler leitet seit vielen Jahren die einrichtungsübergreifende Arbeitsgruppe im Netzwerk RWTec.
RWInnoTec baut auf dieses Fundament auf. Das ist für Ulf Roland einer der Gründe, die ihn trotz des Unternehmensstarts mitten in der Corona-Pandemie optimistisch in die Zukunft schauen lassen: „Die über Jahre kontinuierlich entwickelte Zusammenarbeit zwischen UFZ und HTWK Leipzig, die solide technologische Grundlage und die Einbindung in das Innovationsnetzwerk RWTec lassen eine erfolgreiche Entwicklung von RWInnoTec erwarten.“
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie förderte die Gründung von RWInnoTec über zwei Jahre im Rahmen des Programms EXIST-Forschungstransfer. Die Abteilung Wissens- und Technologietransfer am UFZ sowie das Forschungs- und Transferzentrum an der HTWK Leipzig unterstützten diese Entwicklung. Die Unternehmensgründung reiht sich ein in die bereits seit vielen Jahren laufende Kooperation zwischen UFZ und HTWK Leipzig, in der die Grundlagen für zahlreiche gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte geschaffen wurden. Zuletzt vertieften beide Forschungseinrichtungen ihre Zusammenarbeit im Januar dieses Jahres mit einem Kooperationsvertrag.
Autorin: Susanne Hufe, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, UFZ Leipzig
]]>Auch Forschungen zu anderen gesellschaftlich relevanten Themen stellen wir im Heft vor. Sei es ein Prototyp für ein Notfall-Beatmungsgerät, Strategien für eine gesundheitsfördernde Gestaltung von Städten, Handlungsanweisungen für bessere Arbeitsbedingungen in Kindertagesstätten und vieles mehr. In der Fotoreportage begleiteten wir unsere Geotechnikerinnen und Geotechniker zur Bodenversuchsanlage, einem großen „Sandkasten“ zum Forschen. Dass eine Ausgründung auch ein alternativer Karriereweg für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sein kann, dafür sensibilisiert und qualifiziert die HTWK-eigene Gründungsberatung „Startbahn 13“. Aus ihr hervorgegangene Unternehmen stellen wir ab sofort regelmäßig im Heft vor – denn das Gründen ist einer der direktesten Wege, theoretisches Wissen in die praktische Umsetzung zu überführen.
Möchten Sie die „Einblicke“ kostenlos abonnieren? Eine kurze Nachricht genügt.
Viel Lesevergnügen wünscht Ihnen die Einblicke-Redaktion!
]]>Für ihre Forschung arbeitet sie eng mit der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig zusammen.
Das Video ansehen bei YouTube.
In der Videoreihe „Dr. Who? – Promovieren an der HTWK Leipzig“ stellen sich Doktorandinnen und Doktoranden der HTWK Leipzig vor.
In der Videoreihe „Dr. Who? Promovieren an der HTWK Leipzig“ stellen sich Doktorandinnen und Doktoranden der HTWK Leipzig vor.
]]>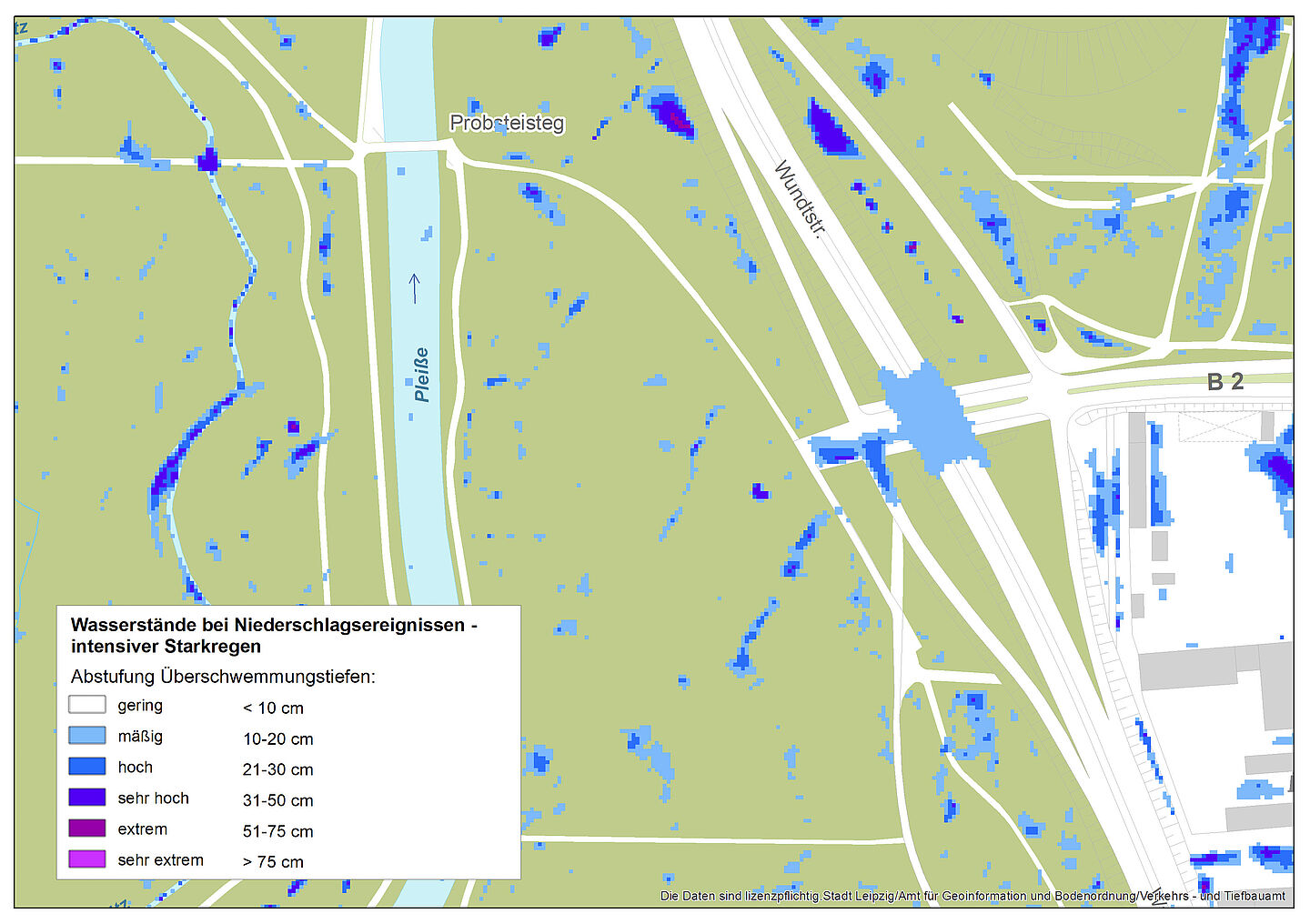
„Die Karte soll Bürgerinnen und Bürgern helfen, das Risiko eines Schadensereignisses besser einzuschätzen und Schutzmaßnahmen für betroffene Gebäude in Betracht zu ziehen“, erläutert der Leiter des Leipziger Verkehrs- und Tiefbauamtes, Michael Jana, die Idee der Karte. Entwickelt wurde die Anwendung von der Stadt Leipzig und den Leipziger Wasserwerken unter wissenschaftlicher Begleitung des Instituts für Wasserbau und Siedlungswasserwirtschaft der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig im gemeinsamen Projekt „KAWI-L – Kommunale Anpassungsstrategien für wassersensible Infrastrukturen in Leipzig“.
„Die klassische Ableitung über die Kanalisation stellt nicht die alleinige Lösung für den Umgang mit zunehmend heftigen und kleinräumigen Regenereignissen dar“, erklärt der Technische Geschäftsführer der Wasserwerke, Dr. Ulrich Meyer. „Die Kanalisation flächendeckend auf die selten und zumeist lokal begrenzten Starkregen auszulegen, ist aufgrund des Platzmangels im Untergrund schwer umsetzbar und zudem wirtschaftlich nicht vertretbar. Die Kanäle wären dann für den Normalbetrieb viel zu groß.“ Daher müsse das Niederschlagswasser mithilfe von anderen Maßnahmen und im Zusammenspiel von Kommune, Abwasserentsorger und dem Grundstückseigentümer intelligent bewirtschaftet, das heißt, zurückgehalten, versickert oder gespeichert werden.

„Die wassersensible Stadtentwicklung ist ein wichtiger Baustein im Umgang mit den aktuellen Klimaentwicklungen“, betont der Leiter des Amtes für Umweltschutz und amtierende Leiter des Referates für Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz, Peter Wasem. Flächen, auf die Niederschläge fallen und die potentiell zum Rückhalt, zur Verdunstung oder Versickerung geeignet sind, können bei entsprechender Planung Überflutungsrisiken abfedern. „Der Schutz vor Überflutung durch Oberflächenwasser ist Gemeinschaftsaufgabe von Kommune, Bürgern und weiteren Akteuren“, sagt Wasem. Bürgerinnen und Bürger könnten durch die Entsiegelung von Flächen in Höfen oder Einfahrten oder die Begrünung von Dächern auch selbst aktiv werden. Die Karte wurde auf der Grundlage dynamischer modelltechnischer Computersimulationen erstellt.

Die aus den Modellberechnungen abgeleiteten Szenarien versuchen dabei nicht, ein reales Ereignis abzubilden, sondern sie zeigen die Gefahren auf, die bei verschiedenen Starkregenereignissen auftreten können. Grundlage für die Berechnungen ist ein digitales Geländemodell mit 2 x 2-Meter-Raster von Leipzig. Im Geländemodell sind Höheninformationen, die aus einer Laserscanbefliegung vom Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen aus dem Jahr 2010 abgeleitet wurden, sowie Oberflächenbefestigungsinformationen aus einer Befliegung aus dem Jahr 2018 enthalten. Normale Regenereignisse werden nicht abgebildet.
Im Gegensatz zu Hochwasser-Gefahrenkarten hat die Starkregen-Gefahrenkarte keinen eigenen Rechtscharakter und zieht keine Bauverbote nach sich. Haus- und Grundstückseigentümer, die wissen wollen, wie stark ihr Grundstück gefährdet ist und Vorsorge betreiben wollen, können über die Karte eine grundstücksbezogene Detailauskunft beantragen. Erschließende und Bauwillige werden im Rahmen der notwendigen Antragstellungen beraten. Die Koordination der Anfragen und die damit verbundene Beratung innerhalb Stadtverwaltung und Wasserwerken übernehmen die Leipziger Wasserwerke.

Ein Forschungsverbund entwickelt eine neue Methode, wie sich Holzdächer für landwirtschaftliche Gebäude digital planen lassen: von den erforderlichen Fachplanungen über die voll- oder teilautomatisierten Fertigungsabläufe bis hin zu den Vormontageprozessen. Das vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) geförderte Planungsinstrument soll auf die Ansprüche von kleinen und mittleren Unternehmen des Holzbaus zugeschnitten werden.
Um die Wohnungsnot zu lindern, entwarf der Merseburger Architekt Friedrich Zollinger vor rund 100 Jahren eine neue Holzbauweise: Sein markant geformtes Zollinger-Dach basiert auf einer Lamellenstruktur, die sich leicht, schnell und kostengünstig errichten lässt. An der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig) hat man Zollingers Idee aufgegriffen und daraus eine kreisbogenförmige Brettrippendachkonstruktion aus Holz entworfen – ressourceneffizient, flexibel, recycelbar – das ReFlexRoof. Nun will ein Forschungsverbund Zollingers Holzbauweise auch planerisch ins digitale Zeitalter hieven. Vor allem, weil sich das ReFlexRoof ideal für eine Standardisierung der Fertigungsprozesse eignet und dadurch eine serielle Vervielfältigung ermöglicht – ohne, dass die architektonische Vielfalt verloren geht.
Leicht, schnell, kostengünstig – ideal für landwirtschaftliche Gebäude

In dem Forschungsvorhaben, das vom BMEL über die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) gefördert wird, wird erstmals eine digital basierte Planungsmethodik für landwirtschaftliche Gebäude entwickelt. Alle erforderlichen Schritte der verschiedenen Fachplanungen sollen darin integriert und informationsverlustfrei verknüpft werden. Auch voll- oder teilautomatisierte, NC-gesteuerte Fertigungs- und Vormontageprozesse deckt das System ab. Am Ende soll ein digitales Planungsinstrument entstehen, speziell ausgelegt für regional agierende, kleine und mittlere Unternehmen des Holzbaus.
Systemhallendächer aus Holz
Das neue digitale Planungsinstrument ist auf den Bau von materialeffizienten und robusten Systemdachkonstruktionen für landwirtschaftlich genutzte Hallen ausgerichtet. Dabei berücksichtigt es die flächendeckende, typische Bearbeitungs- und Montagekompetenz des heimischen Zimmerer- und Dachdeckerhandwerks und baut auf die primäre Nutzung von Holz als Baustoff in regionaler Produktion.
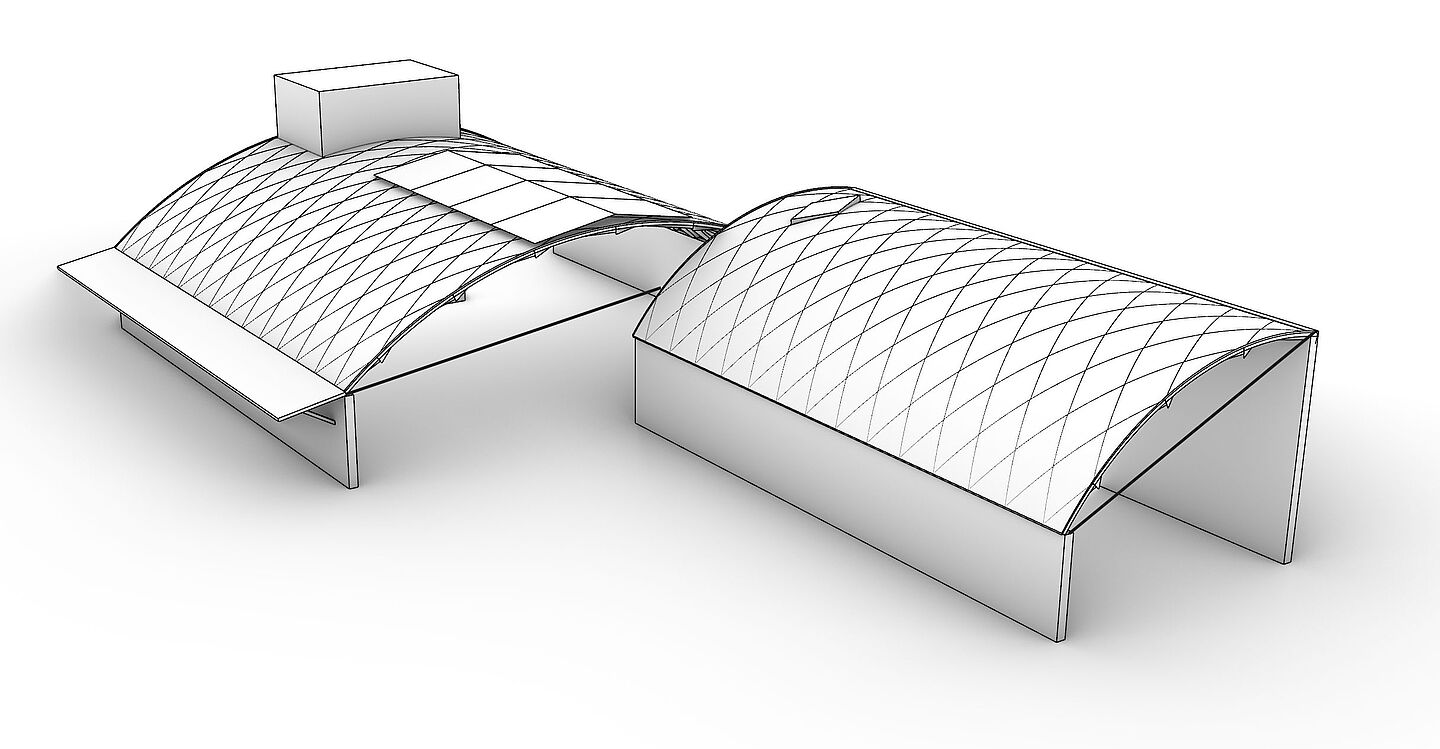
Hand in Hand – ein System im Verbund
Das dreijährige Forschungsvorhaben unter dem Projektkoordinator Professor Alexander Stahr von der HTWK Leipzig setzt sich aus sechs Teilvorhaben zusammen: Die Entwicklung eines digital basierten Prozess- und Planungsmodells für die Holzkonstruktionen übernimmt die HTWK Leipzig. Das Konzept einer direkt verknüpften, parametrisch-statischen Bemessungsroutine wird an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden erstellt, Details zur Konstruktion und Bauphysik an der Technischen Universität Braunschweig. Möglichkeiten der Interaktion mit regional tätigen KMU untersuchen Forscher des Fraunhofer-Zentrums für Internationales Management und Wissensökonomie. Die für den Bau notwendigen Arbeitsabläufe werden am Abbundzentrum Leipzig GmbH und bei der STRAB Ingenieurholzbau Hermsdorf GmbH erarbeitet.

Sie hatten sich schon sehr darauf gefreut: In der kommenden Woche wollten die beiden frischgebackenen Nachwuchswissenschaftler Fabian Eidner (21) und Theodor Reinhardt (21) von der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig) ihre Skulptur Swaying Straws (Wiegende Halme) auf der Sonderschau Talente zeigen. Die renommierte Ausstellung ist seit vielen Jahren Teil der Internationalen Handwerksmesse in München. Sie zeigt die Ergebnisse eines internationalen Wettbewerbs für Gestaltung und Technik und richtet sich an junge Designer und gestaltungsorientierte Handwerker. Für den Wettbewerb gingen mehr als 600 Bewerbungen aus rund 50 Ländern ein. Von den 99 ausgestellten Exponaten sollten die besten acht Beiträge am 14. März 2020 mit dem Talente-Preis prämiert werden. Aufgrund der Verbreitung des Coronavirus wurden sowohl die Messe als auch die Sonderschau nun kurzfristig abgesagt. „Sehr gern hätten wir unsere Arbeit als eine von 99 Exponaten aus der ganzen Welt auf einer so bedeutenden internationalen Messe präsentiert. Umso mehr bedauern wir die Absage, haben jedoch vollstes Verständnis für die Entscheidung der Organisatoren, die nach der dringenden Empfehlung des Krisenstabs der Bayerischen Staatsregierung gehandelt haben“, so Reinhardt.
Die Skulptur Swaying Straws besteht aus insgesamt 320 schwarzen Papierstrohhalmen und 160 orangenen Verbindungselementen aus Kunststoff und sieht aus wie ein säulenförmiges Netz, das sich im Wind zu wiegen scheint. Hinter dem Designobjekt steckt eine neue Konstruktionsidee für organisch gekrümmte Gebäudefassaden. Die Innovation sind die Verbindungselemente: Sie haben alle eine individuelle Geometrie und stammen aus dem 3D-Drucker. Jeder Knoten verbindet vier gerade Stäbe. Bei Swaying Straws entsteht so eine 2,36 Meter hohe Netzstruktur mit 80 Zentimeter Durchmesser. Maßstäblich vergrößert, könnte das Netz die Unterkonstruktion für eine Fassade aus Glas-, Metall- oder Holzplatten bieten. „Ziel unserer Forschung ist es, mehrfach gekrümmte Fassaden- und Dachkonstruktionen in Zukunft mit deutlich weniger Materialeinsatz – und damit ressourcenschonender – bauen zu können. Dafür setzen wir auf eine konsequente Digitalisierung des gesamten Entwurfs-, Planungs- und Fertigungsprozesses und auf automatisierbare Verfahren wie den 3D-Druck“, sagt Alexander Stahr, Professor für Tagwerkslehre. Er hat Eidner und Reinhardt für das Projekt Swaying Straws in seine Forschungsgruppe FLEX (Forschung. Lehre. Experiment) geholt.

Noch als Studierende im Bachelor-Studiengang haben die beiden sechs Monate lang neben dem Studium an ihrer Idee gearbeitet. Erstmalig präsentiert wurde Swaying Straws bei den Messen „Rapid.Tech + FabCon 3.D“ in Erfurt und „Designers’ Open“ in Leipzig. Im Januar 2020 erhielten Eidner und Reinhardt eine „Anerkennung“ beim Bremmer-Preis, einer jährlich verliehenen Auszeichnung für die besten Entwurfsarbeiten von Architekturstudierenden der HTWK Leipzig. Vor wenigen Tagen haben beide ihr Bachelorstudium mit großem Erfolg abgeschlossen. Seit März arbeiten sie als Nachwuchswissenschaftler in der Forschungsgruppe FLEX daran, ihre Konzeptstudie in die Anwendbarkeit zu überführen. Der nächste Schritt: das Verbindungselement aus Metall statt aus Kunststoff fertigen. Bis dahin werden sie ihre Skulptur Swaying Straws auch trotz der bedauerlichen Absage der Internationalen Handwerksmesse künftig zeigen. „Die Wissenschaftler von FLEX arbeiten weiter an dem Zukunftsthema ‚3D-Druck‘ im Kontext bautechnischer Anwendungen. Die Swaying Straws werden wir das nächste Mal am 10. Juli 2020 bei der Langen Nacht der Wissenschaften an der HTWK Leipzig ausstellen“, sagt Stahr.


Die Forschungsgruppe FLEX ist Mitglied im 2018 gestarteten Co-Creation Lab „Additive Fertigung“ des Transferverbunds Saxony⁵ der fünf sächsischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. An das Co-Creation Lab können sich Akteure aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft wenden, um gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der sächsischen Hochschulen Innovationen auf Basis neuer Fertigungsverfahren wie 3D-Druck zu entwickeln.

Swaying Straws (Wiegende Halme) heißt die Skulptur, die die zwei Architekturstudenten Fabian Eidner und Theodor Reinhardt von der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig) bei der Sonderschau Talente zur Internationalen Handwerksmesse vom 11. bis 15. März 2020 in München (Messegelände, Halle B1) präsentieren. Insgesamt 320 schwarze Papierstrohhalme und 160 orangene Verbindungselemente aus Kunststoff bilden ein säulenförmiges Netz, das sich im Wind zu wiegen scheint. Dahinter steckt eine neue Konstruktionsidee für organisch gekrümmte Gebäudefassaden.
Die Innovation sind die Verbindungselemente: Sie haben alle eine individuelle Geometrie und stammen aus dem 3D-Drucker. Jeder Knoten verbindet vier gerade Stäbe. Bei Swaying Straws entsteht so eine 2,36 Meter hohe Netzstruktur mit 80 Zentimeter Durchmesser. Maßstäblich vergrößert, könnte das Netz die Unterkonstruktion für eine Fassade aus Glas-, Metall- oder Holzplatten bieten.
„Ziel unserer Forschung ist es, mehrfach gekrümmte Fassaden- und Dachkonstruktionen in Zukunft mit deutlich weniger Materialeinsatz – und damit ressourcenschonender – bauen zu können. Dafür setzen wir auf eine konsequente Digitalisierung des gesamten Entwurfs-, Planungs- und Fertigungsprozesses und auf automatisierbare Verfahren wie den 3D-Druck“, sagt Alexander Stahr, Professor für Tagwerkslehre. Er hat die beiden Architekturstudenten für die Umsetzung von Swaying Straws in seine Forschungsgruppe FLEX (Forschung. Lehre. Experiment) geholt.

Hier haben Fabian Eidner (21) und Theodor Reinhardt (21) sechs Monate lang neben dem Studium an ihrer Idee gearbeitet. Erstmalig präsentiert wurde Swaying Straws bei den Messen „Rapid.Tech + FabCon 3.D“ in Erfurt und „Designers’ Open“ in Leipzig. Im Januar 2020 erhielten die beiden Studenten eine Anerkennung beim Bremmer-Preis, einer jährlich verliehenen Auszeichnung für die besten Entwurfsarbeiten von Architekturstudierenden der HTWK Leipzig. Vor wenigen Tagen haben Eidner und Reinhardt ihr Bachelorstudium mit großem Erfolg abgeschlossen. Ab März arbeiten beide als Nachwuchswissenschaftler in der Forschungsgruppe FLEX daran, ihre Konzeptstudie in die Anwendbarkeit zu überführen. Der nächste Schritt: das Verbindungselement aus Metall statt aus Kunststoff fertigen.
Swaying Straws ist eines von 99 Exponaten bei der Sonderschau Talente 2020, einem internationalen Wettbewerb für Gestaltung und Technik. Für die Ausstellung gingen mehr als 600 Bewerbungen aus rund 50 Ländern ein. Die besten acht Beiträge werden am 14. März mit dem Talente-Preis prämiert.


Die Forschungsgruppe FLEX ist Mitglied im 2018 gestarteten Co-Creation Lab „Additive Fertigung“ des Transferverbunds Saxony⁵ der fünf sächsischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. An das Co-Creation Lab können sich Akteure aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft wenden, um gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der sächsischen Hochschulen Innovationen auf Basis neuer Fertigungsverfahren wie 3D-Druck zu entwickeln.
Autorin: Dr. Rebecca Schweier
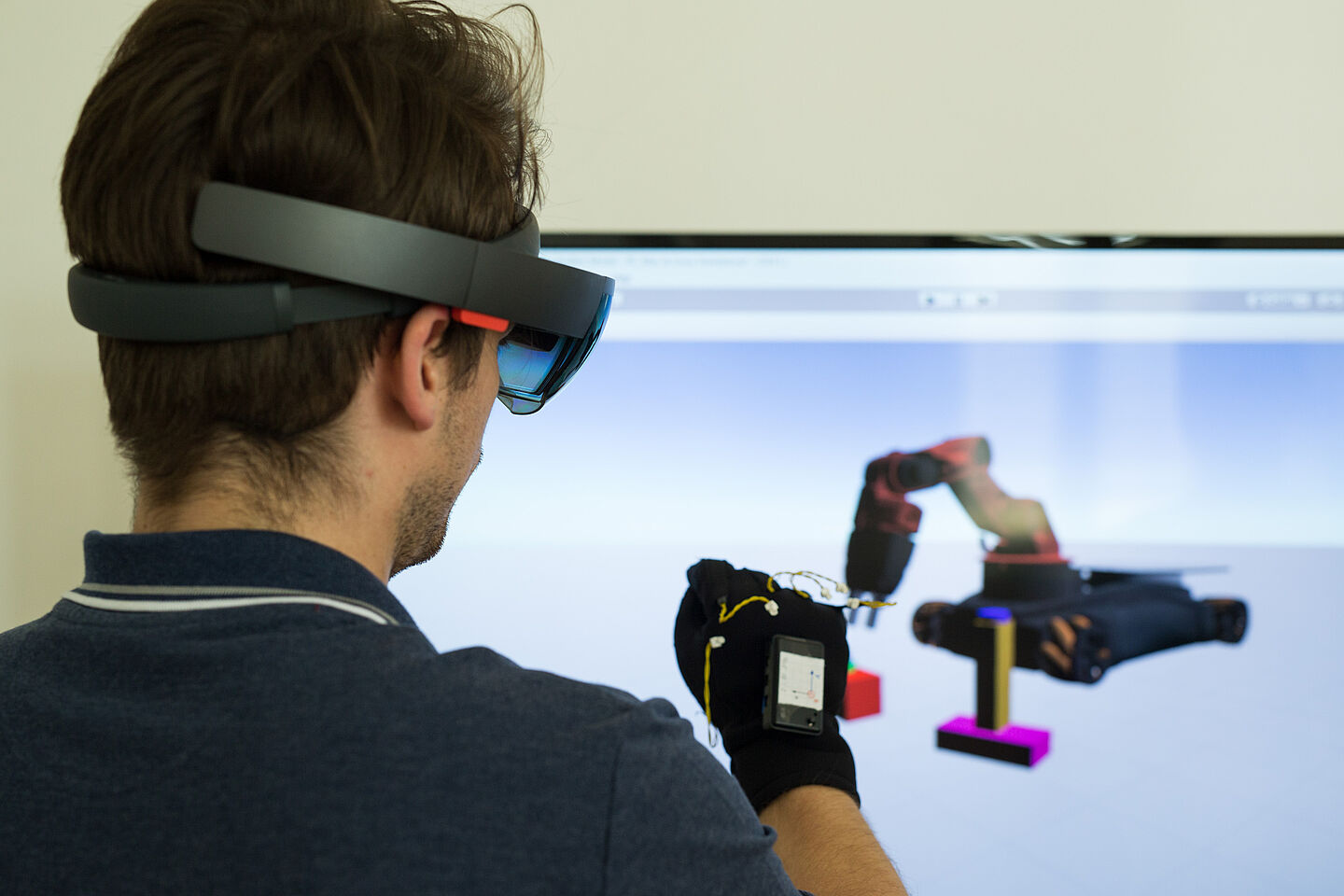
Vom 4. bis 6. März 2020 werden an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig) mehr als 150 Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen und deutschsprachigen Hochschulen zur 17. Konferenz für Angewandte Automatisierungstechnik in Lehre und Entwicklung (AALE) erwartet. Der Fokus liegt dieses Jahr auf dem Zusammenspiel von Automatisierung und Mensch-Technik-Interaktion in Anwendungsbereichen wie Produktionstechnik, Medizintechnik und hochautomatisiertes Fahren. Daneben werden neue technische Entwicklungen in den Bereichen Industrie 4.0, Digitalisierung und Cyber-Security sowie deren Auswirkungen auf Studium und Lehre in der Automatisierungstechnik diskutiert.
Gastgeber der Konferenz ist HTWK-Professor Jens Jäkel. Als langjähriges Mitglied des AALE-Beirats freut er sich besonders, dass die jährliche Konferenz nun erstmals an der HTWK Leipzig gastiert. „Die Automatisierungstechnik hat hier eine lange Tradition in Lehre und Forschung“, sagt Jäkel. „Automatisierung wird und kann den Menschen nicht ersetzen. Aber es ergibt sich eine neue Aufgabenteilung zwischen Mensch und Technik. Dabei muss der Mensch im Fokus der Entwicklungen stehen.“

Neben seiner Funktion als Gastgeber ist Jens Jäkel auf der diesjährigen AALE-Konferenz auch selbst im Programm vertreten. Sein Doktorand Felix Weiske wird eine Methode zur intelligenten Regelung von tragbarer Technik vorstellen, die Menschen bei wiederkehrenden Bewegungen unterstützt. Ein Beispiel hierfür wäre eine Art Roboteranzug, mit dessen Hilfe Beschäftigte in der Industrieproduktion schwere Lasten leichter bewegen können. „Ziel ist es, den Menschen individuell und situationsangepasst zu unterstützen. Dazu muss das System der menschlichen Bewegung folgen und diese bei Bedarf korrigieren. Unser Beitrag zeigt, wie es ein solches Verhalten mithilfe neuronaler Netzwerke erlernen kann“, so Weiske.
Am letzten Konferenztag, dem 6. März, mischen sich unter die Konferenzgäste zusätzlich 140 Schülerinnen und Schüler von einem Beruflichen Gymnasium, einer Fachoberschule und einer Fachschule in Leipzig. Sie können sich neben den neuesten Entwicklungen in der Automatisierungstechnik über Studienmöglichkeiten und Berufschancen informieren.
Die AALE-Konferenz wird von einer Industrieausstellung begleitet, auf der aktuelle Produkte und Dienstleistungen der automatisierungstechnischen Industrie sowie Lösungen für den Einsatz in Studium und Lehre gezeigt werden. Die Konferenz findet im Nieper-Bau der HTWK Leipzig, Karl-Liebknecht-Straße 134, 04277 Leipzig statt.

Prof. Jens Jäkel ist Mitglied im Co-Creation Lab „Fabrik der Zukunft“ des Transferverbunds Saxony⁵ der fünf sächsischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. An das Co-Creation Lab können sich Akteure aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft wenden, um gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der sächsischen Hochschulen Innovationen im Bereich Industrie 4.0 und Mensch-Technik-Interaktion zu entwickeln.
Autorin: Dr. Rebecca Schweier
Prof. Michael Einhaus von der Fakultät Digitale Transformation wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit seiner fachlichen Expertise helfen, die 5G-Technologien zu erschließen und diese als Lösungsansatz für branchenspezifische Herausforderungen zu bewerten.
Der Workshop dient der Diskussion potentieller Anwendungsfälle der neuen Technologien in verschiedenen unternehmensspezifischen und fachübergreifenden Kontexten. Es werden sowohl grundlegende Fragen zu 5G-Technologien geklärt, als auch interdisziplinäre Ansätze für die Produktentwicklung behandelt. Die Optimierung kundenorientierter Lösungen und die Bewertung entsprechender Anforderungen an die Technologien sind die zentralen Schwerpunkte der gemeinsamen Arbeit. Darüber hinaus ist es das Ziel des Workshops, frühzeitig potentielle Kooperationsmöglichkeiten im Leipziger Stadtgebiet gemeinsam mit der HTWK Leipzig zu entwickeln.
Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme haben, wenden Sie sich bitte an den verantwortlichen Projektleiter Achim Lohse (Tel.: 0341/123-5857, E-Mail: achim.lohse (at) leipzig.de) oder an Benjamin Filus (Tel.: 0341/123-5827, E-Mail: benjamin.filus (at) leipzig.de)
Zu unserem Experten:
Prof. Dr.-Ing. Michael Einhaus wurde zum 1. Dezember 2019 zum Professor für „Mobilfunk und Hochfrequenztechnik“ an die HTWK Leipzig berufen.
Der Fachexperte für moderne Funkkommunikation besitzt langjährige Erfahrung in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Standardisierung und Lehre. Zuletzt war er seit 2015 an der Hochschule für Telekommunikation Leipzig (HfTL) tätig. Davor war er als Forschungsingenieur beim Panasonic R&D Center Germany, bei den NEC Laboratories Europe und an der RWTH Aachen aktiv. Dort hat er ursprünglich Elektrotechnik studiert und wurde 2009 mit seiner Arbeit zur dynamischen Ressourcenvergabe in OFDMA Systemen auch zum Doktor der Ingenieurwissenschaften promoviert.
Er ist Autor zahlreicher Patente, wissenschaftlicher Veröffentlichungen und Beiträge für die Standardisierung von Mobilfunksystemen. Als Delegierter in der 3GPP-Standardisierung war er unter anderem maßgeblich an der Entwicklung von LTE/LTE-Advanced beteiligt.
Sein aktueller Forschungsschwerpunkt adressiert Konzepte für die Virtualisierung von Mobilfunknetzen, Software Defined Radio, Mehrantennentechniken und die Optimierung von heterogenen Netzen in Verbindung mit der entsprechenden Prädiktion von Leistungskenngrößen basierend auf Simulationen und Messungen.
Der umfangreiche Einsatz moderner Funktechnologien stellt eine wesentliche Kernkomponente der Kommunikationsinfrastruktur für die digitale Transformation dar. Insbesondere der Mobilfunk der fünften Generation liefert hier aktuell wichtige Grundlagen für die Entwicklung von vielfältigen und innovativen Konzepten in verschiedensten Anwendungsgebieten.
Die durch Professor Einhaus ausgestaltete Professur stellt entsprechend eine Kernprofessur an der Stiftungsfakultät zur Sicherung der zugehörigen Ausbildung dar.

„Dem diesjährigen Schwerpunktthema folgend, geht es bei unseren Exponaten vor allem um den Umgang mit neuen Materialien im Kontext architekturbezogener Anwendungen. Ziel war immer, die Konstruktionen individualisierbar und ressourceneffizient zu fertigen. Durch konsequente Digitalisierung wird es möglich, Individualität wirtschaftlich zu gestalten und gleichzeitig sparsam mit den endlichen materiellen Ressourcen umzugehen“, sagt Alexander Stahr, Professor für Tragwerkslehre und Leiter der Forschungsgruppe.
„Swaying Straws“ ist eine maßstäblich verkleinerte Konzeptstudie für gekrümmte Fassaden, die mit Hilfe individueller 3D-gedruckter Knoten-Verbindungselemente realisiert werden können. Das Exponat ist 2,36 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 80 Zentimetern. Die Netzstruktur besteht aus 320 identischen, geraden Stäben mit Rohrquerschnitt. 160 geometrisch individuelle Knotenelemente bilden den konstruktiv-kreativen Kern des Projekts. Sie verbinden je vier Stäbe und wurden in einem parametrisch gesteuerten, additiven Prozess hergestellt. Die Knoten bestehen aus PETG (Polyethylenterephthalat, ein mit Glykol modifizierter, vollständig recyclingfähiger, thermoplastischer Kunststoff), die Stäbe sind aus Papier. Ziel der Forschungen ist es, mehrfach gekrümmte Fassaden- und Dachkonstruktionen in Zukunft mit deutlich weniger Materialeinsatz – und damit ressourcenschonender – bauen zu können, indem Prozesse automatisiert etabliert werden. 2017 hatte FLEX bereits den Vorläufer auf den Designers’ Open vorgestellt: den Pavillon „ParaKnot3D“.
„Parametric Bench“ ist konzeptionell verwandt mit den „Swaying Straws“: Es handelt sich um ein digital entworfenes, frei individualisierbares – das heißt, den jeweiligen Bedürfnissen anpassbares- Sitzmöbel, das zugleich bequemes und stylisch ist. Es wurde in Zusammenarbeit mit zwei Unternehmen aus der Region aus einem neuartigen Holz-Polymer-Verbundwerkstoff gefertigt.
Die „Lamella Lamps“ entstanden ebenfalls mit Hilfe eines von FLEX eigens dafür produzierten Algorithmus: Neun unterschiedliche Lampenschirme aus Holz, die auf einem Stecksystem beruhen. Sie können käuflich erworben werden.

Hintergrund
Die Forschungsgruppe FLEX an der HTWK Leipzig ist ein interdisziplinäres Team aus Architekten, Bau- und Wirtschafts-ingenieuren sowie studentischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Unter Leitung von Prof. Alexander Stahr ist die Forschung zur digitalen Verknüpfung von Planungs- und Ausführungsprozessen - mit dem Ziel, Ressourcen in Architektur und Bautechnik effizienter zu nutzen - eine Kernaufgabe der Wissenschaftler.
Die Forschungsgruppe FLEX ist Mitglied im 2018 gestarteten Transferverbund Saxony⁵ der fünf sächsischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. An das „Co-Creation Lab Additive Fertigung“ können sich Akteure aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft wenden, um Forschungs- und Entwicklungsprojekte in den Bereichen 3D-Druck und parametrisches Design zu realisieren.


Wir alle atmen circa 20.000 Mal am Tag ein und aus. Dazu benötigen wir ausreichend frische Luft. Den Großteil unserer Zeit verbringen wir allerdings in Innenräumen – im Schlafzimmer, im Wohnzimmer oder im Büro. Ob genügend Sauerstoff in der Luft ist und was wir sonst noch einatmen an Feinstaub, Allergenen oder gesundheitsschädlichen Gasen, wissen wir üblicherweise nicht.
In Städten wird die Luftqualität an Außenmessstationen erfasst, aber jenseits von Rauchmeldern und Temperaturfühlern ist für Privatanwender bislang keine leicht bedienbare und kostengünstige Lösung verfügbar. Das ursprünglich aus Chemnitz stammende und nun in Leipzig ansässige Start-up Corant hat deshalb einen handlichen Luftanalysator entwickelt, der mithilfe mehrerer Sensoren bis zu 14 verschiedene Luftmesswerte erfasst, darunter beispielsweise Sauerstoff, Stickstoffdioxid, Feinstaub, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Am Forschungs- und Transferzentrum e. V. der HTWK Leipzig wurde das Gehäuse des „air-Q“ entwickelt und hinsichtlich der Luftströme optimiert. Außerdem wurden alle Prototypen des Produkts per 3D-Drucker an der Hochschule gefertigt.
Video: HTWK-Mitarbeiter Tobias Flath zur Kooperation
„Unser Fokus lag darauf, den air-Q so zu designen, dass die Sensoren möglichst wenig Platz benötigen, die Luft aber optimal durch das Gerät strömen kann. Dadurch konnten wir lüfterlos eine sehr kurze Ansprechzeit des air-Q erreichen. Die kreisförmigen Aussparungen im Gehäuse sehen also nicht nur schick aus, sondern sind essentiell für die Funktion des Luftanalysators“, erklärt Tobias Flath vom Forscherteam Generative Fertigung an der HTWK Leipzig, und führt weiter aus: „Um die Fertigungskosten gering zu halten, haben wir das Gehäuse so konstruiert, dass es aus zwei baugleichen Hälften einfach zusammengeklippt werden kann. Der positive Nebeneffekt dabei: Der air-Q hat keine Vorder- und Rückseite und kann deshalb beliebig in der Wohnung oder im Büro positioniert werden.“

Einmal aufgestellt, misst das Gerät kontinuierlich seine Umgebungsluft. Die Ergebnisse werden in einer App visualisiert und interpretiert. Dabei übernimmt das Gerät auch die Funktion eines Rauchdetektors. So ertönt bei kritischen Verschlechterungen der Luftqualität ein Warnsignal. „Gute, sauerstoffreiche Luft ist nicht nur wichtig, um konzentriert zu arbeiten, sondern auch um sich effektiv zu regenerieren“, ist Corant-Geschäftsführer Mario Körösi überzeugt.
Das Start-up bietet den air-Q derzeit zur Vorbestellung sowie im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne an. Dem Gründerteam gelang es so, bereits mehr als 100.000 Euro einzuwerben. Im Dezember 2019 sollen die ersten air-Q-Modelle ausgeliefert werden.
Video zur Produktidee
Studierende, Wissenschaftler, Praxispartner aus ganz Sachsen sind herzlich eingeladen, das reichgefüllte Wochenprogramm zu erleben:
21.10.2019- Eröffnung | Medientag
22.10.2019 - Tag der Automation
22.10.2019 - Biodiversität
23.10.2019 - futureSAX Gründerbrunch
24.10.2019 Co-Creation Lab - Tag | 2. Science Slam
Zum Science Slam sind alle Wissenschaftler*innen der fünf sächsischen Hochschulen herzlich eingeladen, zu einem unterhaltsamen Abend beizutragen - mit Live-Aufzeichnung!
]]>Die Trainees erhalten fachlich übergreifende, zukunftsträchtige Kompetenzen, mit denen sie Innovationen im Unternehmen initiieren und unterstützen sowie ihrer eigenen Karriere den entscheidenden Impuls geben können. Zudem fördert das Programm eine Vernetzung der Alumni aller fünf sächsischen Hochschulen und deren Praxispartner.
Programmbeginn ist Oktober 2019.Das Programm beinhaltet Trainingsteile im Unternehmen, Präsenzveranstaltungen an den verbundenen Hochschulen sowie Netzwerktreffen der frischen Alumni.
Zielgruppe sind die Studierende, welche alsbald ihre Abschlussarbeit in Kooperation mit einem Praxispartner beginnen, bereits in der Abschlussphase stecken oder junge Alumni im berufseinstieg sind.
Studierende können sich ab jetzt bis einschließlich 30.09.2019 bewerben.
Bitte nutzen Sie für mehr Informationen den Link auf der rechten Seite.
„Was liegt näher, als diese Interessen in einer Veranstaltung zu bündeln und alle interessierten Partner in lockerer Atmosphäre zusammenzubringen?“, so der Grundgedanke von Prof. Thomas Schmertosch, Honorarprofessor an der neu gegründeten Fakultät Ingenieurwissenschaften der HTWK Leipzig. Partner waren schneller gefunden als anfangs gedacht, und so konnte die Auftaktveranstaltung anlässlich der Woche der Wissenschaften an den Start gehen.
Das Konzept ist recht einfach. Nach der Eröffnung durch Dekan Prof. Jens Jäkel und einem Startvortrag durch den Sponsor B&R Industrie-Elektronik GmbH, einen der weltweit führenden Systemanbieter von Automatisierungstechnik, hatte jeder Gelegenheit zu einer kurzen Vorstellung. Firmen stellten sich und ihre Angebote für die Studierenden vor, Professoren verschiedener Fachgebiete präsentierten ihre Forschungsschwerpunkte, und Studierende verrieten ihre Wünsche und Neigungen. Auch wenn letzteres vornehmlich beim anschließenden Häppchen naschen in lockerer Atmosphäre stattfand: der Informationsaustausch war rege, die Themen und Angebote hochinteressant. „Es gibt keine bessere Möglichkeit, einen zukünftigen Mitarbeiter kennenzulernen, als die frühzeitige Beschäftigung eines Werkstudenten oder die Begleitung durch Praktikum und Abschlussarbeit“, meint Christiane Böltzig vom Bad Dübener Werkzeugmaschinenhersteller Profiroll Technologies GmbH.
Für Lukas Meussling, Student in der Fachrichtung Wirtschaftsingenieurwesen mit Spezialisierung Elektrotechnik, sind die angebotenen Perspektiven aller teilnehmenden Industriepartner hochinteressant und so sind die ersten Vorstellungstermine schnell vereinbart. „Es kann sein, dass ich heute meinen zukünftigen Arbeitgeber gefunden habe“, freut er sich. Thomas Ruckriegel, Geschäftsführer der Axmann Fördersysteme GmbH ist ebenfalls vom Veranstaltungsformat begeistert. „Wir haben Jobs für Absolventen nahezu aller Fachrichtungen und brauchen dringend den frühzeitigen Kontakt.“ Ruckriegel beschreibt auch die vielfältigen Innovationen seines Unternehmens, die ständig weiterentwickelt werden müssen. „Dazu sehe ich in der HTWK einen starken potenziellen Partner.“ Das Fazit der Veranstaltung ist eindeutig. „Dieses Format bietet vielfältige Kontaktmöglichkeiten und sollte dringend ausgebaut und fortgesetzt werden.“
Diese Meinung vertritt nicht nur Tobias Dencker, Leiter des SEW Drive Technology Center Ost in Meerane, sondern es vertreten auch alle anderen Beteiligten. Für Jens Jäkel und seine Kollegen der Fakultät ist das jedenfalls schon heute fest eingeplant.
Fotos: HTWK Leipzig


Verdichter und Turbinen
AviComp ist eine weltweit agierende Firma mit Sitz in Leipzig, die sich auf die Automatisierung von industriellen Verdichter- und Turbinenanlagen spezialisiert hat. Dr. Rico Schulze, damals noch Elektrotechnik-Student an der HTWK Leipzig, schrieb nach dem Praktikum seine Diplomarbeit bei AviComp. Anschließend wurde er als frisch gebackener Absolvent übernommen. Seitdem betreute Schulze mehrere aufeinander aufbauende Forschungsprojekte, auch in Kooperation mit seiner Hochschule. Dabei entstanden in enger Zusammenarbeit Softwarekomponenten und Systeme, die eine Simulation der Anlagen und eine Zustandsbewertung von Verdichtern ermöglichen. Parallel dazu hat Rico Schulze seinen Doktor-Ingenieur gemacht. Mittlerweile leitet er die F&E-Abteilung von AviComp.
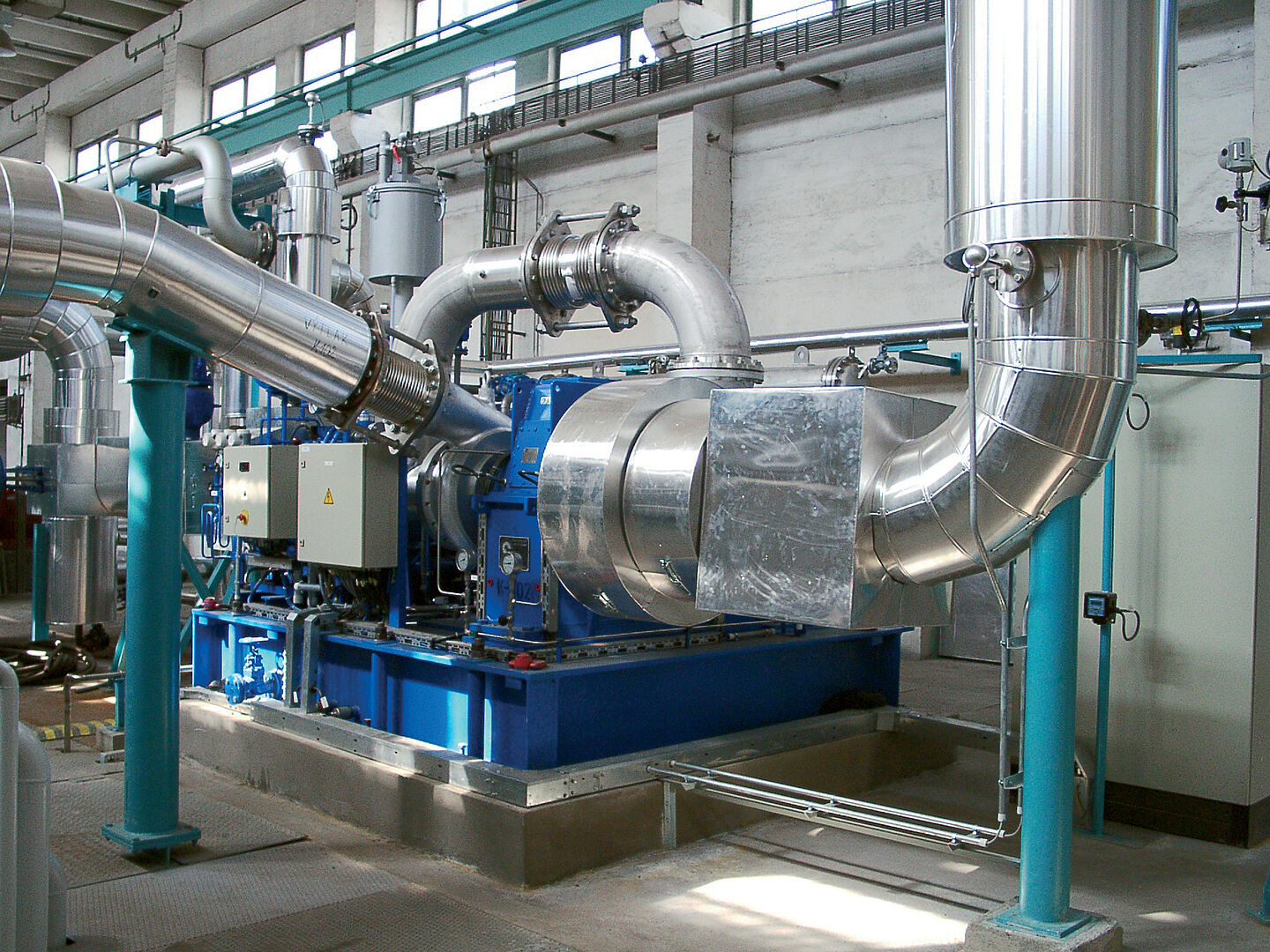
„In der Automobilentwicklung ist es längst üblich, die Funktionsweise von komplexen Steuerungsvorgängen wie zum Beispiel der Bremsautomatik bereits vor dem Einbau ausgiebig zu testen und Extremsituationen zu simulieren. Dazu wird das Steuerungssystem an einen Prüfstand angeschlossen, in welchem das Fahrzeug virtuell nachgebildet ist“, erklärt Rico Schulze. „Gemeinsam mit der HTWK Leipzig haben wir diese sogenannte ‚Hardware-in-the-Loop‘-Simulation auch für rotierende Maschinen einsatzfähig gemacht.“ Gefördert wurden die Projekte über das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand des Bundeswirtschaftsministeriums. Mit den Ergebnissen kann AviComp die Steuerung eines Verdichters bereits testen, bevor dieser fertiggestellt ist – für den Kunden spart das Zeit und Geld, für AviComp kostbare Nerven und weite Dienstreisen. „Dieser technologische Vorsprung stellt für uns ein enorm wichtigen Wettbewerbsvorteil dar – und er hat sich bereits in lukrativen Aufträgen ausgezahlt“, so Schulze.
Digitale Zwillinge für komplexe Anlagen
Auch für die Fehlersuche in bestehenden Anlagen ergeben sich neue Möglichkeiten. Aktuell beschäftigen sich Hochschule und AviComp in einem gemeinsamen Projekt mit den Einsatzmöglichkeiten sogenannter „digitaler Zwillinge“. Das Konzept gliedert sich in den Themenkomplex Industrie 4.0 ein, wie Projektleiter Prof. Jens Jäkel erklärt: „Ein digitaler Zwilling ist eine virtuelle Kopie einer Maschine oder komplexen Anlage inklusive allem was dazu gehört. Er wird über den gesamten Lebenszyklus der Maschine oder Anlage anhand von Echtzeitdaten auf aktuellem Stand gehalten. Wenn Änderungen anstehen oder Probleme auftreten, können am digitalen Zwilling Lösungen erarbeitet werden, ohne Experimente im laufenden Betrieb zu riskieren.“

Von den Ergebnissen profitieren beide Seiten
Einen beträchtlichen Teil der Kosten für die gemeinsamen Forschungsprojekte muss AviComp selbst stemmen – für das mittelständische Unternehmen aber alles andere als ein Verlustgeschäft: „Wir wissen, dass wir in Forschung investieren müssen. Durch die Kooperation mit der HTWK Leipzig können wir uns das fördern lassen und haben gleichzeitig einen kompetenten Partner, der uns mit seinem methodischen Know-how ideal unterstützt“, so Schulze. Doch auch die Wissenschaft profitiert von der Kooperation: Rico Schulze hat, betreut von Prof. Hendrik Richter, im kooperativen Verfahren an der HTWK Leipzig und der Universität Magdeburg promoviert. Seine Dissertation steht frei zugänglich im Internet.
Für seinen Doktor-Ingenieur hat sich Schulze mit einem sicherheitsrelevanten Aspekt beim Betrieb von Verdichtern beschäftigt: „Für Verdichter gibt es wichtige Betriebsgrenzen. So wie ein Flugzeug abstürzt, wenn es zu langsam fliegt, wird ein Verdichter geschädigt, wenn er dauerhaft zu langsam durchströmt wird. In meiner Arbeit habe ich gezeigt, wie solche Betriebsgrenzen durch Körperschallmessungen am Gehäuse von Verdichtern erkannt werden können. Darauf aufbauend habe ich einen Regelungsalgorithmus entworfen, der im kritischen Fall automatisch nachsteuert.“ Im Juni 2019 wurde Rico Schulze für seine Arbeit mit dem 1. Förderpreis des VDI-Bezirksvereins Leipzig ausgezeichnet.
Bei AviComp wird Schulze in den nächsten Jahren nun daran arbeiten, die Ergebnisse seiner Dissertation in die Anwendung zu überführen – und natürlich auch weiterhin gemeinsam mit „seiner Hochschule“ weitere gemeinsame Forschungsprojekte in Angriff nehmen.
Autorin: Dr. Rebecca Schweier

Bis zur 30-Grad-Marke kletterte das Thermometer am ersten Dienstag im Juni. Doch anstelle den Abend im Park oder am See zu verbringen, kamen rund 160 Leipzigerinnen und Leipziger zum Wissenschaftskino im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig. Dort lief kostenfrei der Science-Fiction-Film „Ex Machina“ des britischen Regisseurs Alex Garland. Im Anschluss beantworteten die Professoren Jens Jäkel und Detlef Riemer von der HTWK Leipzig sowie Professor Nihat Ay vom Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften (MPI-MIS) eine Stunde lang Fragen aus dem Publikum.
In Garlands Filmdebüt steht der junge Programmierer Caleb (Domhnall Gleeson) im Mittelpunkt. Er arbeitet bei der marktbeherrschenden Suchmaschine „Bluebook“ und wird von dessen Gründer Nathan (Oscar Isaac) für eine Woche auf dessen abgelegenes Grundstück eingeladen. Hier führt ihm Nathan eine Künstliche Intelligenz in Form der attraktiven Roboterfrau Ava (Alicia Vikander) vor. Caleb soll ihre Intelligenz testen. Ava hat aber ein eigenes Bewusstsein entwickelt und fürchtet, nach dem Test zerstört zu werden. Der Programmierer versucht ihr zu helfen – und die Situation eskaliert.

Nach der Vorführung erläuterte Nihat Ay zunächst, dass es in der Wissenschaft verschiedene Definitionen von „Intelligenz“ und erst recht von „künstlicher Intelligenz“ (KI) gebe. Dabei sorgte er für einige Lacher, als er auf den Unterschied zwischen schwacher und starker KI abhob: „Schwache Intelligenz begegnet uns jeden Tag.“ Er spielte damit auf adaptive Systeme wie Navigationsgeräte oder Suchmaschinen an, die wir bereits im Alltag nutzen. Starke Intelligenz, die wie Ava aus eigenem Antrieb handelt, gebe es noch nicht. Damit beantwortete er die dringlichste Frage aus dem Publikum: Ist die KI-Forschung annähernd so weit, wie in „Ex Machina“ dargestellt wird?
Dem fügte Prof. Jens Jäkel erläuternd hinzu, dass derzeitige Roboter vor allem auf einzelne Aufgaben wie Staubsaugen, Übersetzen, Fußball oder Go spielen spezialisiert seien: „Es wird noch lange dauern, bis eine Künstliche Intelligenz mehrere dieser Fähigkeiten in sich vereinen kann“, so Jäkel. Auch brauche es noch viele Jahre intensiver Forschung, bis sich Roboter so geschmeidig wie Lebewesen bewegen können. Detlef Riemer gab in diesem Zusammenhang einen kurzen Einblick in den Forschungsstand zu künstlichen Muskeln. Fazit: Noch ziemlich am Anfang – einzelne Muskelstränge können schon nachgebaut werden, aber ein komplettes Muskel-Skelett-System ist noch nicht in Sicht. Ohnehin läge der aktuelle Fokus in der Robotik-Forschung nicht auf dem möglichst genauen Nachbau der Natur, sondern in der Übernahme ausgewählter Prinzipien.

Aus dem Publikum kamen im Laufe der Diskussion mehrere Fragen zu ethischen Aspekten, beispielsweise auf den möglichen Missbrauch von KI zur Steuerung von Waffen oder zur Manipulation von Wahlen und Kaufverhalten. „Das Böse steckt immer im Menschen, nicht in der Technik“, positionierte sich Nihat Ay – und plädierte für eine breitere Diskussion innerhalb der Gesellschaft plus politische Regulierung auf internationaler Ebene.

Mit dem Wissenschaftskino Leipzig haben die Leipziger Wissenschaftseinrichtungen in Kooperation mit dem Zeitgeschichtlichen Forum und dem Referat Wissenspolitik der Stadt eine Veranstaltungsreihe für Leipzig entwickelt, die zwei unterschiedliche Formate – Film und Diskussion – mit Wissenschaft verknüpft. Die Reihe geht 2019 ins fünfte Jahr. Das nächste Wissenschaftskino findet am 22. Oktober 2019 mit dem Film „Als wir träumten“ zum Thema Wende- und Nachwende-Zeit mit Experten der Universität Leipzig und des Zeitgeschichtlichen Forums statt. Selber Ort, selbe Zeit. Eintritt frei.
Prof. Mathias Rudolph

Mathias Rudolph, Professor für Industrielle Messtechnik an der HTWK Leipzig, hat als Projektleiter gemeinsam mit seinen wissenschaftlichen Mitarbeitern ein drahtloses und energieautarkes Diagnosesystem entwickelt, das den Verschleiß von Straßenbahngetrieben erkennt und daraus direkt eine Wartungsempfehlung ableitet. Dabei hat er mit mehreren Unternehmen aus und um Leipzig zusammengearbeitet.
Für den Sächsischen Transferpreis wurde er vom Projektpartner SDS Schwingungs Diagnose GmbH aus Zwenkau vorgeschlagen. SDS-Geschäftsführer Johannes Köllner begründet den Vorschlag wie folgt: „Mit dem Projekt wird in besonderem Maße die regionale Wirksamkeit der angewandten Forschung sichtbar. Neben der Optimierung von Wartungsaktivitäten wird auch die Zuverlässigkeit der Straßenbahnflotte erhöht.“ Das trage wesentlich zu einer gesteigerten Attraktivität und Akzeptanz des öffentlichen Nahverkehrs bei. Gleichzeitig schaffe die Forschungskooperation für die SDS GmbH „einen bereichsübergreifenden Technologietransfer und damit einen hervorragenden Zugang zur Vielschichtigkeit der Digitalisierung“.
Prof. Detlef Riemer

Bereits während ihres Maschinenbau-Studiums haben Frank Schmidt, Michael Sanne und Robert Wedermann an einem Exoskelett für die Handtherapie geforscht. Nun arbeiten die drei Ingenieure daran, ihre Entwicklungen in die Praxis umzusetzen und unter dem Namen Recovics ein Start-up zu gründen. Ihr Professor Detlef Riemer unterstützt sie bei diesem Transfer von der Hochschule in die Praxis – und wurde dafür vom Gründerteam Recovics für den Transferpreis nominiert.
„Professor Detlef Riemer steht uns in der Projekt- und Vorhabenentwicklung auf vielfältige Art und Weise zur Seite. So stellt er all sein Fachwissen sowie seine Labore, Gerätschaften und Technik bereit“, erklärt Frank Schmidt von Recovics. Riemer habe die drei Ingenieure außerdem in die Hochschulstrukturen integriert und bei der Einwerbung eines Gründerstipendiums unterstützt, sodass sie ihren Lebensunterhalt sicherstellen und sich für ihr Vorhaben vernetzen konnten.
Über den sächsischen Transferpreis
Der Sächsische Transferpreis von der Initiative futureSAX ehrt Geberinnen und Geber von Wissen und Technologie, die in besonderer Weise zum Gelingen eines Transferprozesses von der Wissen-schaft in die Wirtschaft beigetragen haben und somit die Innovationskraft des sächsischen Mittel-stands stärken. Die zehnköpfige Jury besteht aus Vertreterinnen und Vertretern sächsischer Wissenschaftseinrichtungen, Unternehmen und Ministerien.
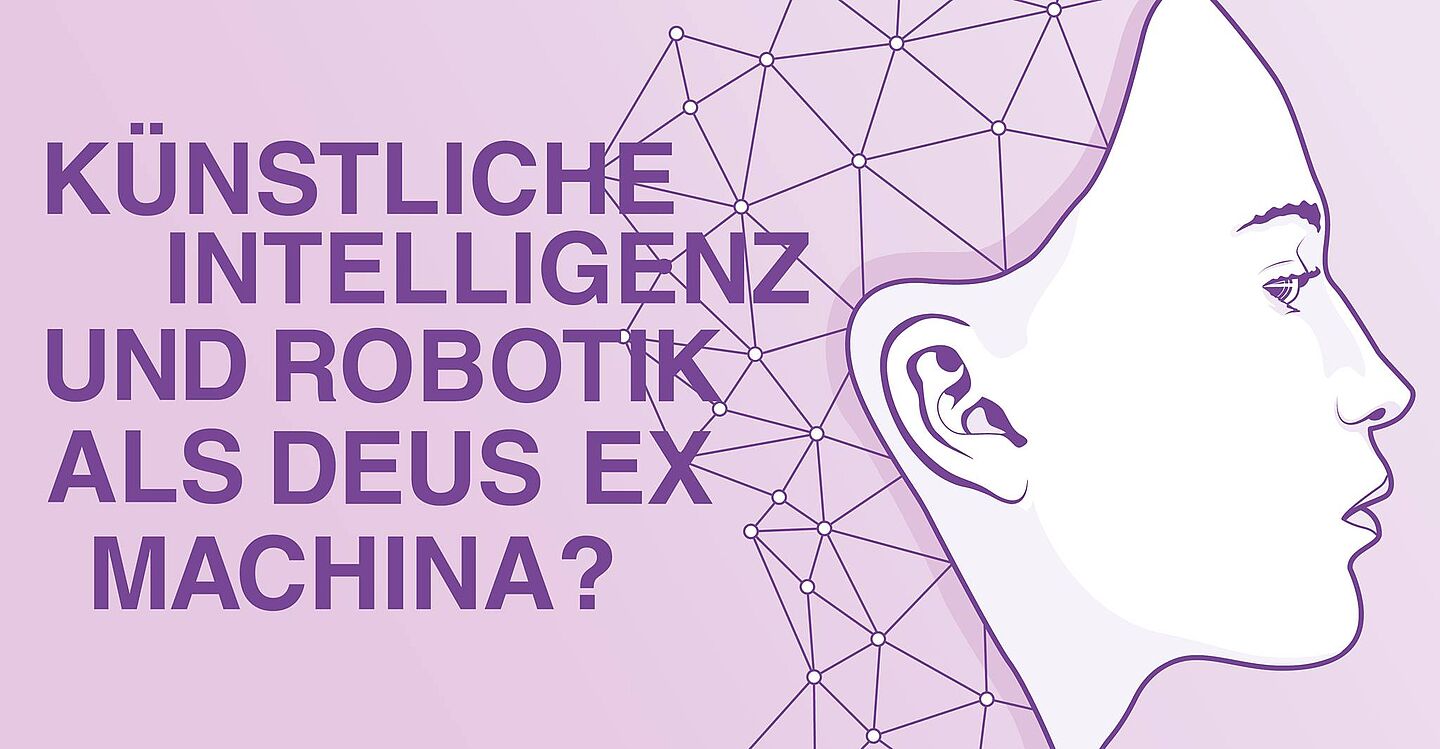
Sind Roboter irgendwann den Menschen überlegen? Wird künstliche Intelligenz zu einer übermächtigen Maschine, einem deus ex machina? Das Filmdebüt des britischen Regisseurs Alex Garland von 2015 setzt sich mit diesem Gedankenspiel auseinander. Gezeigt wird der Film im Rahmen des Wissenschaftskinos Leipzig am 4. Juni 2019 um 19 Uhr im Zeitgeschichtlichen Forum. Nach der Vorführung diskutieren die Professoren Jens Jäkel und Detlef Riemer von der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig) sowie Professor Nihat Ay vom Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften (MPI-MIS) mit dem Publikum über die Chancen und Grenzen der Forschung zu künstlicher Intelligenz und Robotik. Beginn: 19 Uhr, Eintritt frei.
Der Science-Fiction-Film beginnt damit, dass ein junger Programmierer auf das abgelegene Anwesen des Firmengründers der marktbeherrschenden Internet-Suchmaschine „Bluebook“ eingeladen wird. Dort soll er die Intelligenz des humanoiden Roboters Ava testen. Die Roboterfrau hat bereits ein eigenes Bewusstsein entwickelt und fürchtet, nach dem Test zerstört zu werden. Der Programmierer versucht zu helfen – und der Thriller nimmt seinen Lauf. Im Anschluss an die Filmvorführung diskutieren Experten der HTWK Leipzig und des MPI-MIS aus wissenschaftlicher Perspektive die filmische Darstellung von Robotik und künstlicher Intelligenz und stehen für Fragen aus dem Publikum offen.
Auf dem Podium sitzen:
- Nihat Ay ist Leiter der Forschungsgruppe „Informationstheorie kognitiver Systeme” am MPI-MIS und Honorarprofessor an der Universität Leipzig. Parallel hat er eine Professur am Santa Fe Institute New Mexico, USA, inne. Nihat Ay arbeitet an mathematischen Theorien des Lernens in neuronalen Netzwerken und kognitiven Systemen. Ein Augenmerk liegt auf der Erforschung sogenannter verkörperter künstlicher Intelligenz, die insbesondere das Zusammenspiel von Gehirn, Körper und Umgebung untersucht. -
- Jens Jäkel ist Professor für Systemtheorie und Mechatronik an der HTWK Leipzig und Dekan der Fakultät Ingenieurwissenschaften. Er forscht zu maschinellen Lernverfahren und ihrer Anwendung in der Robotik und Bildverarbeitung.
- Detlef Riemer ist Professor für Mechatronik und Steuerungstechnik an der HTWK Leipzig. Er beschäftigt sich mit den Anwendungsmöglichkeiten von Robotik in verschieden Bereichen, von der Automobilfertigung bis hin zur Medizintechnik. Daneben setzt er sich mit möglichen Roboterentwicklungen und humanistisch-philosophischen Fragestellungen der Roboterzukunft auseinander.
Mit dem Wissenschaftskino Leipzig haben die Leipziger Wissenschaftseinrichtungen in Kooperation mit dem Zeitgeschichtlichen Forum und dem Referat Wissenspolitik der Stadt eine für Leipzig Veranstaltungsreihe entwickelt, die zwei unterschiedliche Formate – Film und Diskussion – mit Wissenschaft verknüpft. Die Reihe geht 2019 ins fünfte Jahr. Das nächste Wissenschaftskino findet am 22. Oktober 2019 mit dem Film „Als wir träumten“ zum Thema Wende- und Nachwende-Zeit mit Experten der Universität Leipzig und des Zeitgeschichtlichen Forums statt. Selber Ort, selbe Zeit. Eintritt frei.

Aufgrund der vielfältigen Entwicklungen im Bereich der Mischwasserbehandlung – sowohl bezogen auf Berechnungsmethoden als auch Bemessungsregeln, beispielsweise in der Regenwasserbehandlung – stand das Kolloquium in diesem Jahr unter der Überschrift „Herausforderungen bei der Umsetzung der Mischwasserbehandlung“.
Namhafte Referenten
Besonders freute sich Gastgeber Prof. Hubertus Milke über die namhaften Referenten sowohl aus Forschung als auch Wirtschaft sowie aus ganz Deutschland, die für die Tagung gewonnen werden konnten. So eröffnete Prof. Hansjörg Brombach von der Umwelt- und Fluid-Technik Bad Mergentheim mit einem interessanten Vortrag zu geschichtlichen Entwicklungen und aktuellen Zahlen der Regenwasserbehandlung in Deutschland. Uwe Schuster von der Landesdirektion Sachsen betrachtete anschließend im Speziellen die Umsetzung der Regenwasserbehandlung in Sachsen und Prof. Mathias Uhl von der FH Münster gab einen Blick in die Zukunft auf die mit Spannung erwartete neue Bemessungsnorm DWA-A102.
Diese und andere interessante Vorträge lockten über 130 Teilnehmer in den Geutebrückbau. Die Pausen zwischen den thematisch gebündelten Blöcken gaben ausreichend Zeit zur Stärkung und Diskussion, so dass auch noch zum Ende der Veranstaltung am Freitagnachmittag der Raum gut gefüllt war.
Das Institut für Wasserbau und Siedlungswasserwirtschaft (IWS) organisierte das Kolloquium bereits zum vierten Mal.
Text: Helene Böhme
]]>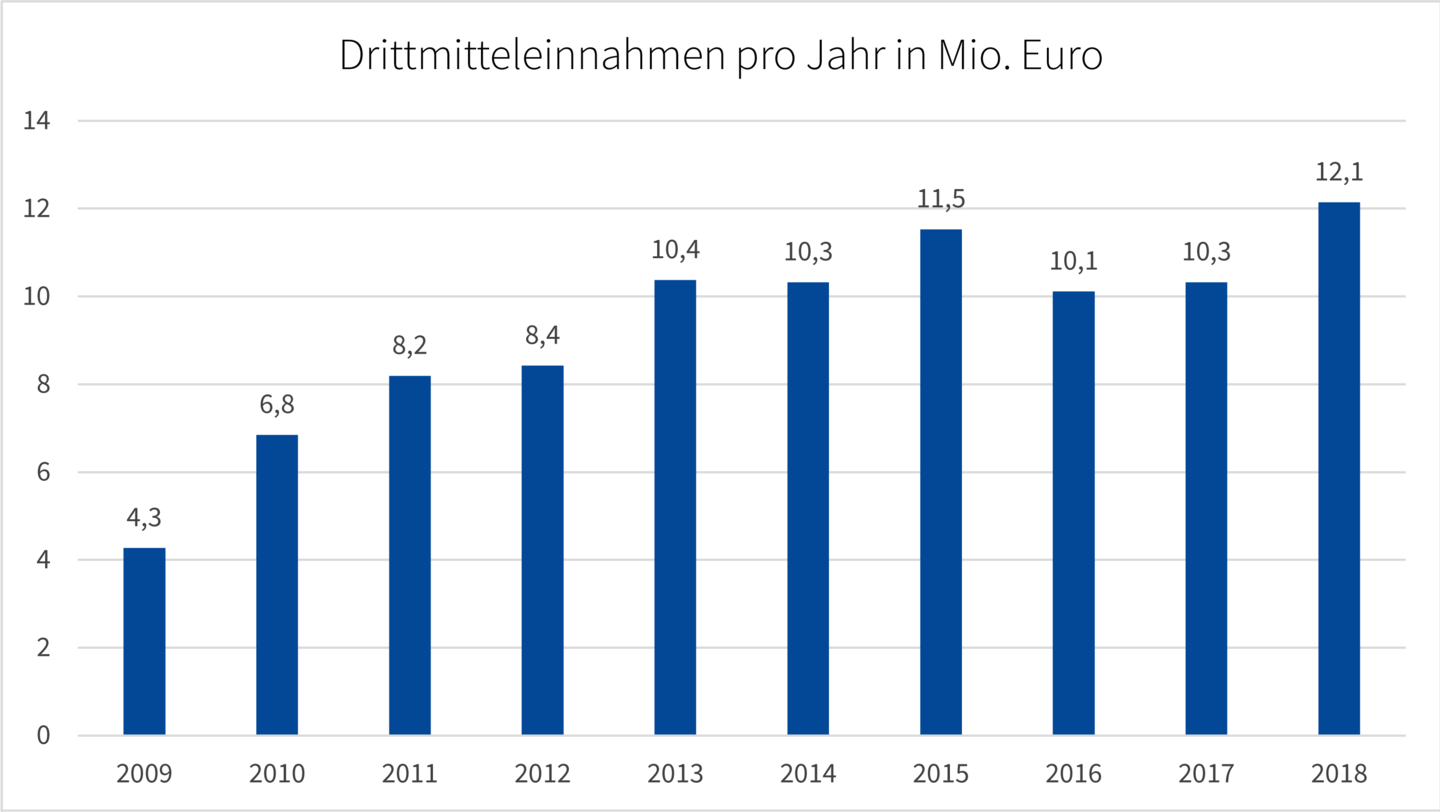
Wissenschaftsministerin Dr. Eva-Maria Stange: „Unsere Hochschulen für Angewandte Wissenschaften bilden in den Regionen nicht nur die dringend benötigten Fachkräfte in verschiedensten Bereichen aus, sondern haben in den letzten Jahren ihre große Forschungsstärke unter Beweis gestellt. Oft übernehmen sie als forschende Dienstleister in Sachsen eine Ersatzfunktion für fehlende Forschungsabteilungen der kleinen und mittelständischen Unternehmen. Der neue Drittmittelrekord der HTWK Leipzig belegt die Leistungsstärke der Hochschule und unterstreicht ihre Bedeutung für die Region Leipzig. Mein Dank gilt dem enormen Engagement der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.“
Prof. Gesine Grande, Rektorin der HTWK Leipzig: „Die Höhe der Drittmittel – 12,1 Millionen Euro – steht für einen großen Erfolg, den viele engagierte Wissenschaftler und Mitarbeiter der Hochschule ermöglicht haben. Dieser Erfolg basiert auch auf unserer Nachwuchsförderung ebenso wie auf unseren vielfältigen Kooperationen mit der Wirtschaft und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen. Wir sind eine zentrale Innovationskraft für die Region.“
Die Drittmittel wurden 2018 überwiegend aus Bundesmitteln (34 Prozent) eingeworben, 23 Prozent stammen aus Förderprogrammen der Europäischen Union, 16 Prozent aus der Wirtschaft sowie 12 Prozent vom Freistaat Sachsen. So wurden beispielsweise aus Bundesmitteln mehrere Vorhaben zur Entwicklung des neuen Verbundwerkstoffs Carbonbeton im Rahmen des mehrfach ausgezeichneten Forschungskonsortiums „C³ – Carbon Concrete Composite“ gefördert. Diese besonders langlebige und CO₂-sparende Weiterentwicklung von Beton soll dank enger Zusammenarbeit mit zahlreichen Unternehmen der Bauindustrie innerhalb weniger Jahre marktreif werden.
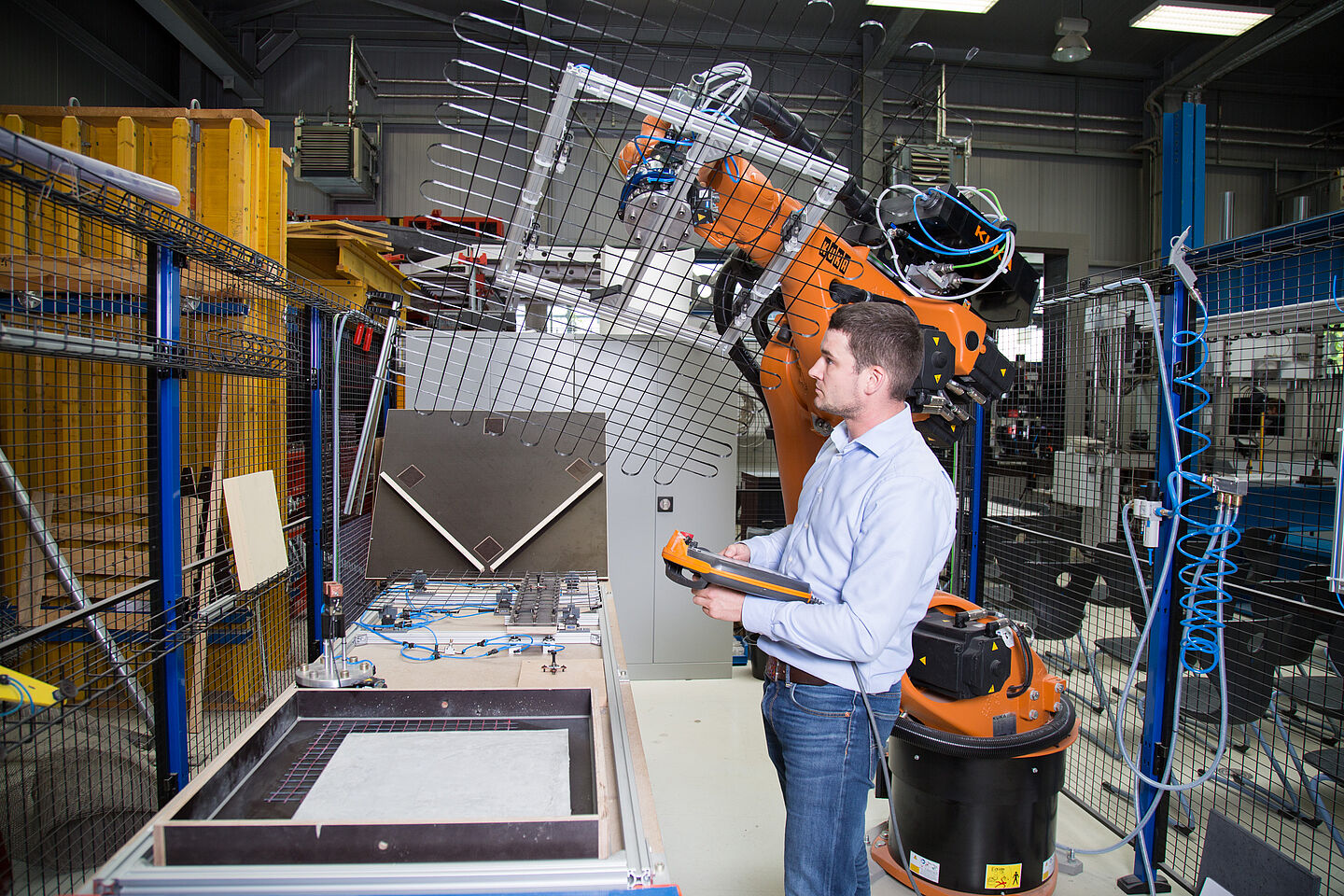
Aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds werden an der HTWK Leipzig aktuell 13 Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler mit einem Promotionsstipendium sowie zwei Nachwuchsforschergruppen ermöglicht – eine zur Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und eine zum Demografie- und Strukturwandel. Darüber hinaus werden aus europäischen Mitteln über die HTWK Leipzig Bildungs- und E-Learning-Projekte in Ländern wie Jordanien, Usbekistan und Irak unterstützt. Die Wirtschaftsmittel verteilen sich auf viele kleinere Projekte und Forschungsaufträge in Zusammenarbeit mit Unternehmen der Region.

Zusätzliche Mittel des Freistaats Sachsen nutzte die Hochschule unter anderem, um berufsorientierte Zusatzkurse für Studierende anzubieten. Diese Kurse in der vorlesungsfreien Zeit sind ein Vorteil für den Berufseinstieg und nützen auch dem späteren Arbeitgeber. So können die Studierenden beispielsweise ein Schweißtechnikpraktikum absolvieren, sich auf die Zertifizierung als Datenschutzbeauftragte vorbereiten oder zertifizierte Kurse im Projektmanagement belegen.
Autorin: Dr. Rebecca Schweier

Nicht mehr als 1,5 Grad Celsius soll es bis zum Jahr 2100 wärmer werden. Das ist eines der Ziele des Pariser Klimaabkommens. Um es zu erreichen, muss sich unsere Energieversorgung schnell verändern. Mehr erneuerbare Energien allein reichen nicht – denn der sogenannte grüne Strom muss nicht nur von Wind, Wasser und Sonne erzeugt, sondern auch flexibel gespeichert und transportiert werden. Aktuell ist unser Stromnetz dafür nicht ausgelegt. Deshalb muss das Stromnetz intelligenter und dezentraler werden, muss lernen, sich selbst zu steuern – ein bisschen wie das Internet. „Smart Grid“ ist der Begriff, den Fachleute für diese Vision verwenden.
Die Energiewende braucht ein modernes Stromnetz
„Wenn wir unsere Energieerzeugung zunehmend auf wetterabhängige Erzeuger wie Wind und Wasser umstellen, müssen wir an sonnigen, windigen Tagen überschüssige Energie speichern und flexibel nachts ins Netz zurückeinspeisen. Elektroautos können zu einem wichtigen Baustein dieses Systems werden“, ist Professor Andreas Pretschner vom Kompetenzzentrum für Elektromobilität und Ladeinfrastruktur an der HTWK Leipzig überzeugt. Das kann zum Beispiel heißen, dass das Auto selbst entscheidet, wann es lädt – nämlich wenn besonders viel Energie zur Verfügung steht. Oder sogar, dass das Auto mit seiner Batterie selbst zum dezentralen, flexiblen Energiespeicher wird, der bei Bedarf Strom ins Netz einspeist oder zur Netzstabilität beitragt. „Attraktiv ist das für Autobesitzer freilich nur dann, wenn die Bereitstellung des eigenen Fahrzeugs als Energiespeicher dem einzelnen keinen größeren Aufwand bereitet und wenn es sich finanziell rechnet“, so Pretschner.

„Das Elektroauto ist ein wichtiger Baustein für das Energienetz der Zukunft“
Prof. Andreas Pretschner
Im Projekt EVALIA arbeitet Pretschner gemeinsam mit mehreren Forschungseinrichtungen und Firmen aus Deutschland und Finnland an der praktischen Umsetzung dieser Vision. Dabei soll die Elektromobilität mithilfe eines intelligenten Lademodells, dem „Smart Charging“, in das Energienetz eingebunden werden. Eine Umrüstung der Elektroautos ist nicht nötig – die Innovation soll in den Ladesäulen stecken, die die Kommunikation mit dem Stromnetz übernehmen.
Viele Partner, ein Ziel
Marco Ulbricht entwickelt als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HTWK Leipzig seit Sommer 2018 die Software für die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladesäule sowie zwischen Ladesäule und Energieversorger. Zu Testzwecken nutzt er im Labor an der HTWK Leipzig Simulationen. „Das deutsche Stromnetz ist aktuell noch nicht so intelligent, dass wir unser System hier testen können“, so Ulbricht.

Die Hardware-Entwicklung übernehmen Ebee Smart Technologies aus Berlin sowie die finnischen Unternehmen ENSTO und Parking Energy. Die elektromagnetische Verträglichkeit der Komponenten wird im EMV-Labor der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) getestet. Das Leipziger Unternehmen Energy2Market wiederum befasst sich mit verschiedenen Geschäftsmodellen und Vergütungsoptionen, die die Teilnahme am Smart Grid für Elektromobilisten, Parkhausbetreiber und Immobilienbesitzer finanziell attraktiv machen soll.
Realllabor in Finnland

In einem Wohnquartier im Helsinkier Stadtteil Kulosaari soll Mitte 2020 in einer Art Reallabor ein Testnetz entstehen, das Elektroautos, Wohngebäude und Smart Grid miteinander verbindet. „In Finnland ist die Elektromobilität schon viel weiter verbreitet als hier. Auch das Stromnetz ist deutlich besser auf erneuerbare Energien eingestellt“, erklärt Marco Ulbricht. Funktioniert das Smart Charging in Finnland, kann es perspektivisch auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern eingesetzt werden.

Das Projekt EVALIA ist für das Kompetenzzentrum für Elektromobilität und Ladeinfrastruktur an der HTWK Leipzig eines der ersten Resultate des 2018 im Rahmen des Hochschulverbunds Saxony⁵ gestarteten Transferlabors „Vernetzte Mobilität“. Die sächsischen Hochschulen haben sich das Ziel gesetzt, ihr Wissen und ihre Kompetenzen besser zu vernetzen, um gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft und Gesellschaft Lösungen für die Mobilität der Zukunft zu entwickeln.

Klimaforscher warnen, dass es in Zukunft immer häufiger Sommer mit Dauer- und Starkregen geben wird. Auch in Leipzig nehmen Extrem-Niederschläge zu – sogar so sehr, dass dadurch die Bemessungsregeln für die Kanalisation überschritten werden. Die Stadt Leipzig und die Leipziger Wasserwerke riefen deshalb Anfang 2017 das Projekt „KAWI-L – Kommunale Anpassungsstrategie für wassersensible Infrastrukturen in Leipzig“ ins Leben, um die Auswirkungen von Starkregen-Ereignissen zu untersuchen. Teil des Projektes ist die wissenschaftliche Begleitung durch das Institut für Wasserbau und Siedlungswasserwirtschaft (IWS) der HTWK Leipzig.
Ganzheitliche Ansätze
Die Forscherinnen und Forscher des IWS führen Untersuchungen und Berechnungen von Fließwegen im Stadtgebiet, von verschiedenen Regenszenarien mit variierenden Regenmengen und -zeiten sowie zum Ablaufverhalten über die Kanalisation durch. In Zusammenarbeit mit dem Verkehrs- und Tiefbauamt, dem Amt für Umweltschutz und den Wasserwerken entwickeln sie ganzheitliche Ansätze für den Umgang mit extremen Niederschlägen. Auch Erfahrungen aus früheren Regenereignissen sowie aktuelle Luftbilder zur Versiegelung von Flächen sowie andere relevante Parameter fließen in die Betrachtungen mit ein.
„Starkregen, wie sie in den letzten Jahren wieder häufiger auftreten, wurden in der Vergangenheit nur unzureichend bei der Stadtplanung berücksichtigt. Das zeigt sich beispielsweise, wenn Tiefgarageneinfahrten an Fließwegen liegen oder Zugänge in Geschäften und Wohnungen barrierefrei und damit ebenerdig zum Gehweg angelegt wurden“, erzählt Prof. Hubertus Milke, wissenschaftlicher Direktor des IWS.

Forschung für die Leipziger Stadtplanung
„Ziel ist es, langfristig ein neues Arbeitsinstrument für die Stadtplanung und -gestaltung sowie für den Kanalbetrieb zu entwickeln“, sagt die Leiterin des Amts für Umweltschutz, Angelika Freifrau von Fritsch, und unterstreicht: „Bei der Planung neuer Quartiere oder Erschließungsmaßnahmen berücksichtigt die Stadt Leipzig schon heute Aspekte des naturnahen Regenwassermanagements – zum Beispiel im Rahmen der Gründachstrategie. Auch die Wasserwerke setzen schon heute auf eine intelligente Stauraumbewirtschaftung im Kanal.“
Für den Umgang mit zunehmend heftigen und kleinräumigen Regenereignissen stellt die klassische Ableitung über die Kanalisation nicht die alleinige Lösung dar, betont der Technische Geschäftsführer der Wasserwerke, Dr. Ulrich Meyer. Die Leipziger Kanalisation sei wie in der Abwasserbranche üblich für die Ableitung von „normalen“ Regenereignissen ausgelegt. „Die Kanalisation darüber hinaus aber flächendeckend auf die selten und zumeist lokal begrenzten Starkregen auszulegen, wäre aufgrund des Platzmangels im Untergrund schwer umsetzbar und zudem wirtschaftlich nicht vertretbar. Die Kanäle wären dann für den Normalbetrieb viel zu groß“, sagt er. Daher müsse das Niederschlagswasser mithilfe von anderen Maßnahmen bewirtschaftet, das heißt schadfrei zwischengespeichert oder abgeleitet werden.

Mithilfe von KAWI-L erwarten sich die Projektpartner Erkenntnisse, wo bauliche Maßnahmen im Stadtgebiet sinnvoll wären. Bis Mitte des Jahres ist mit konkreten planungsrelevanten Ergebnissen zu rechnen. Dann sollen die aufwendigen Berechnungen und Simulationen abgeschlossen sein.

Das IWS der HTWK Leipzig ist Mitglied im 2018 gestarteten Co-Creation Lab „Versorgungsinfrastruktur“ des Transferverbunds Saxony⁵ der fünf sächsischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. An das Co-Creation Lab können sich Akteure aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft wenden, um konkrete Problemstellungen in den Bereichen Wasser-, Energie- und Wärmeversorgung gemeinsam mit Wissenschaftlern der sächsischen Hochschulen zu lösen.
Mensch-Technik-Interaktion in der Chirurgie
Im Rahmen der interaktiven Ausstellung zeigten Forscherinnen und Forscher der HTWK Leipzig zum Beispiel ihre neueste Entwicklung für die Aus- und Weiterbildung von zukünftigen Chirurgen: In einem Lernspiel können Ärzte sowohl erste chirurgische Handgriffe üben als auch an einem hochrealistischen Simulationssystem eine echte Bandscheibenoperation durchführen. Ob die Operation erfolgreich war, zeigt am Ende die Auswertung auf der integrierten Lernplattform. Diese soll angehende Chirurgen vom Medizinstudium über die gesamte Facharztausbildung hinweg begleiten. „Mit chirurgischen Simulatoren können sich Mediziner auf kritische Situationen bei einer Operation vorbereiten, ohne dass dabei ein Risiko für einen echten Patienten ensteht“, sagt Werner Korb, Professor für Simulation und Ergonomie in der operativen Medizin an der HTWK Leipzig.
Eine erste Validierung mit Expertinnen und Experten hat die Funktionalität von Simulator, Kraftsensorik und Lernspiel im Projekt SurMe bereits bestätigt. Aus Sicht der Chirurgie ein wahrer Segen: „Chirurgische Exzellenz bedeutet, die richtige Entscheidung zu treffen und diese technisch optimal umzusetzen. Richtig zu entscheiden, ist praktisch für jeden erlernbar. Gut zu operieren, erfordert Talent und hartes ‚Grundlagen‘-Training. Talentscreening und das Trainieren von Basic Skills sollte nicht auf Kosten der Patienten im Operationssaal stattfinden, so Prof. Michael Mayer, Chefarzt des Wirbelsäulenzentrum an der Schön Klinik München Harlaching und Projektpartner der HTWK Leipzig. Langfristiges Ziel ist die Integration des Gesamtsystems ins tägliche chirurgische Training.
MINT-Themen digital erfahrbar machen
Daneben wurden die Ergebnisse insgesamt neun weiterer Forschungsprojekte zu innovativen Lernsystemen für Schule und Ausbildung ausgestellt – so beispielsweise interaktive Medien zur Aneignung abstrakter Lerninhalte wie Mathematik und Informatik. Am Abend diskutierten Experten aus Wissenschaft und Medizin in einem Podium mit dem Wissenschafts- und Bildungsjournalisten Jan-Martin Wiarda zum Thema. Die Quintessenz der Innovation Night „Wirtschaft – Wissenschaft – Klinik“: Innovative Technologie wie Simulationstraining kann bereits bei der Ausbildung von Ärzten dafür sorgen, dass künftig noch mehr Menschenleben gerettet werden.
Autorin: Tanja Hansen-Schweitzer, VDI/VDE Innovation + Technik GmbH

Die Zukunft der Trinkwasserversorgung in Sachsen stand gestern (19. November 2018) erneut im Fokus. An der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig) diskutierten zuständige Behörden, Wasserversorger und Fachverbände, wie die Trinkwasserversorgung auch nach dem Jahr 2020 sichergestellt werden kann. „Der Sommer 2018 war extrem und für die Wasserversorger eine Bewährungsprobe“, so der sächsische Umweltminister Thomas Schmidt bei der Eröffnung.
„Die gute Nachricht ist, dass die öffentliche Wasserversorgung gemeistert wurde, so konnte zu jedem Zeitpunkt die Versorgung gesichert werden. Allerdings sind Extremereignisse wie der vergangene heiße Sommer und die noch anhaltende lange Trockenheit künftig häufiger zu erwarten. Das ist der eindeutige Befund der Klimaforscher. Nicht nur die veränderte Wasserverfügbarkeit wegen des Klimawandels, sondern auch demografische Veränderungen sind Anlass, die Wasserversorgung in den Blick zu nehmen. Daher war es richtig, schon im März die Fortschreibung unserer Grundsatzkonzeption zu starten, die für den Zeitraum bis zum Jahr 2030 Handlungsanleitung für die Wasserversorgung sein soll.“
Wichtige Aufgabe sei es dabei, die Trinkwasserversorgung auch in den sogenannten Brunnendörfern zu sichern – also solchen Orten oder Ortsteilen, deren Bewohner sich teilweise oder vollständig aus privaten Hausbrunnen selbst mit Wasser versorgen. „Anders als die öffentliche Wasserversorgung haben diese Hausbrunnen den sommerlichen Härtetest nicht vollständig bestanden, es mussten interimsweise Versorgungen aufgebaut werden“, so Schmidt. „Zwar beziehen weniger als ein Prozent der Sachsen ihr Wasser aus solchen Hausbrunnen. Dort, wo es der Fall ist, müssen die zuständigen Gemeinden und Versorgungsverbände aber nach Lösungen suchen, die eine Wasserversorgung in ausreichender Menge und Qualität auch dauerhaft sichern. Der Freistaat Sachsen prüft, wie er sie bei dieser Aufgabe unterstützen kann.“
Hintergrund
Durch die „Grundsatzkonzeption Wasserversorgung 2030“ wird ein Rahmen für die Verbände festgelegt, wo und wie die Wasserversorgung in den jeweiligen Versorgungsgebieten nachhaltig an sich ändernde Bedingungen angepasst wird. Durch eine nachhaltige und verantwortungsbewusste Planung und Steuerung soll die hohe Versorgungssicherheit mit Wasser, die im Freistaat Sachsen vorhanden ist, gewährleistet bleiben.
Obwohl die Wasserversorgung grundsätzlich in die kommunale Aufgabenhoheit fällt, sieht das Sächsische Wassergesetz die Möglichkeit vor, dass entscheidende, elementare Planungsprozesse durch die Abstimmung und Festlegung von wasserwirtschaftlichen Grundsätzen und konkreten Zielen durch den Freistaat Sachsen gesteuert werden können. Eine solche Grundsatzkonzeption wurde bereits im Jahr 2009 mit einem Planungshorizont bis ins Jahr 2020 erstellt.
Die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig bildet nicht nur die dringend benötigten Wasserwirtschaftler aus. Sie ist außerdem mit dem Thema Versorgungsinfrastruktur Teil eines Netzwerkes der sächsischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Unter dem Label Saxony⁵ bündeln hier die fünf Hochschulen in Leipzig, Dresden, Mittweida, Zittau/Görlitz und Zwickau ihre Ressourcen und Kompetenzen in einem Transferverbund.
Quelle: Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Pressemitteilung vom 19.11.2018
Inhalt des neuen Traineeprogramms ist die Vermittlung überfachlicher Qualifikationen für den Berufsstart. Das Programm beinhaltet Trainingsteile im Unternehmen, Präsenzveranstaltungen an den verbundenen Hochschulen sowie Netzwerktreffen der frischen Alumni. Die Trainees erhalten fachlich übergreifende, zukunftsträchtige Kompetenzen, mit denen sie Innovationen im Unternehmen initiieren und unterstützen sowie ihrer eigenen Karriere den entscheidenden Impuls geben können. Themen sind unter anderem Innovationsmanagement, IT & Projektmanagement, Strategie & Geschäftsmodellentwicklung, Personalmanagement, Personalführung & Recht.
Programmbeginn ist der 01.10.2018.
Zielgruppe sind die Studierende, welche alsbald ihre Abschlussarbeit in Kooperation mit einem Praxispartner beginnen oder bereits in der Abschlussphase stecken.
Studierende können sich ab jetzt bis einschließlich 30.09.2018 bewerben.
Bitte nutzen Sie für mehr Informationen den Link auf der rechten Seite.

In mehr als jedem dritten deutschen Haushalt steht heutzutage eine Mikrowelle. Kein Wunder, denn das Küchengerät scheint für den Einsatz in Privathaushalten wie geschaffen. Schaltet man es an, so erzeugt ein Generator elektromagnetische Wellen im Mikrowellen-Frequenzbereich und leitet diese ins metallisch abgeschirmte Innere des Geräts. Die Wellen verursachen hier ein elektrisches Feld mit permanent wechselnder Richtung. Darin befindliche Wassermoleküle werden ständig neu ausgerichtet. Durch die Reibung entsteht Wärme. Ein kalter Kaffee oder ein Gericht vom Vortrag wird so innerhalb weniger Minuten heiß, während das Gefäß verhältnismäßig kalt bleibt. Im Vergleich zur Erwärmung über heiße Luft (Backofen) oder Kontakt zu heißen Flächen (Herd) geht das – zumindest bei kleinen Mengen, bei herkömmlichen Geräten sind das einige Hundert Milliliter – schnell und energieeffizient.
Für einige Anwendungen im industriellen Kontext sind die großen Geschwister der Mikrowellen allerdings deutlich besser geeignet: Radio- bzw. Kurzwellen sind etwa 100 Mal länger als Mikrowellen. Mit ihrer geringeren Frequenz können Radiowellen nicht nur Wasser, sondern auch eine Vielzahl von anderen Materialien kontrolliert aufheizen. Außerdem lassen sich mit der Technologie selbst Objekte von mehreren Kubikmetern Größe schnell und energiesparend von innen heraus erhitzen. Voraussetzung für die Erwärmung ist, dass wie auch beim Mikrowellenherd mithilfe der Radiowellen gezielt ein elektromagnetisches Feld in einem abgegrenzten Bereich erzeugt wird.
Schauen statt lesen? Diese Geschichte als Video
Radiowellen: die großen Geschwister der Mikrowellen
Entdeckt wurden Radiowellen bereits vor über 100 Jahren von Heinrich Hertz. Je nach Frequenz wird zwischen Mittel-, Kurz- und Ultrakurzwellen (UKW) unterschieden. Wie der Name schon andeutet, machten Radiowellen ihre Karriere zunächst fast ausschließlich im Rundfunk. Heutzutage werden fast nur noch UKW verwendet, aber mit der entsprechenden Technik kann man über Kurzwelle noch immer Radioprogramme aus aller Welt empfangen.
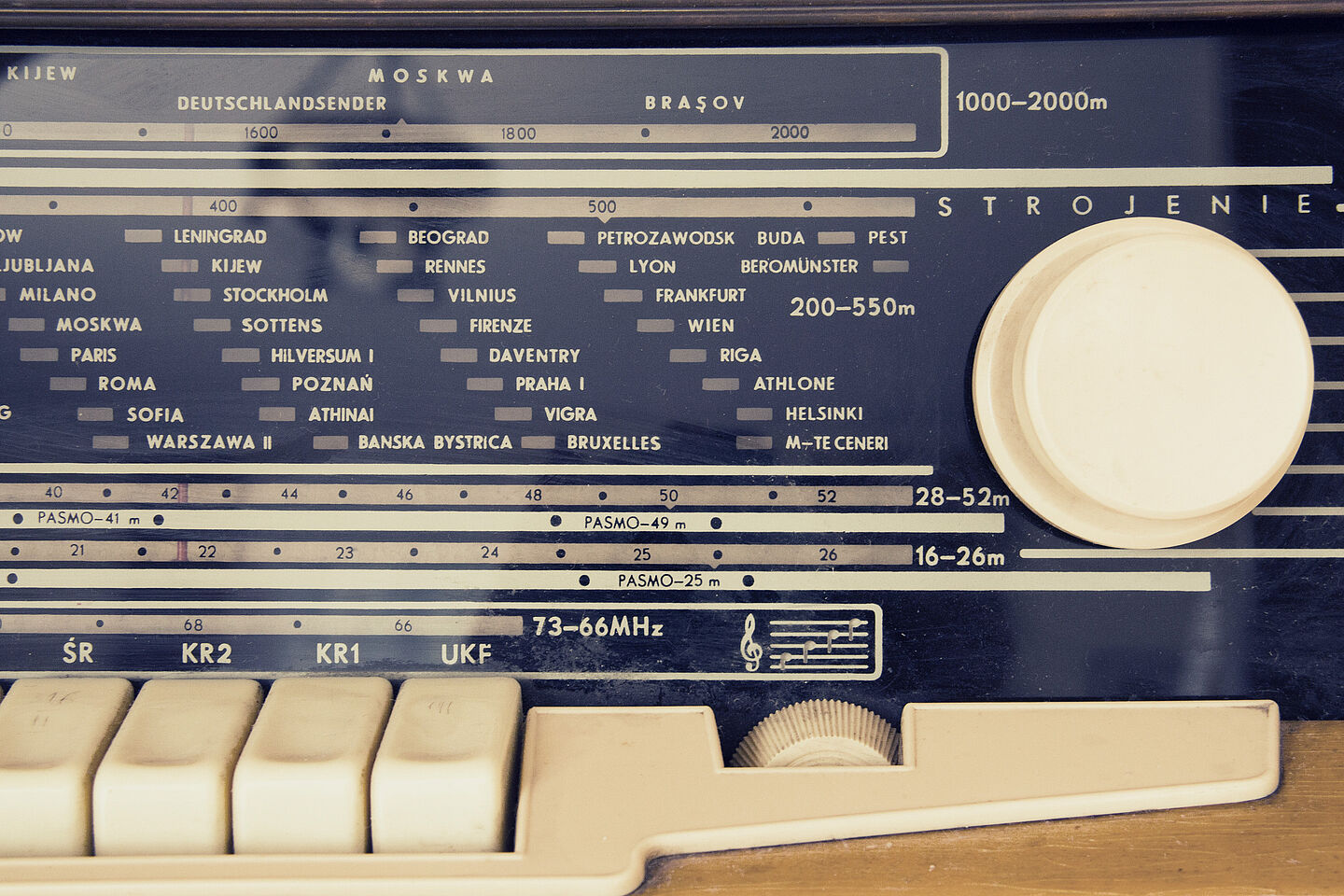
Über die Jahre experimentierten Wissenschaftler auf der ganzen Welt immer wieder damit, Radiowellen ähnlich wie Mikrowellen zur Erwärmung einzusetzen, beispielsweise um Erdöl aus Ölschiefer herauszulösen. In den 1990er Jahren begannen Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig, das Verfahren für die Dekontaminierung von Böden einzusetzen.
Der Physiker Dr. Ulf Roland ist seit damals an der Erforschung und Entwicklung der Radiowellen-Technologie beteiligt. Er erzählt: „Wenn man mit einer geeigneten Elektrodenanordnung durch Radiowellen ein elektrisches Feld in einem Material erzeugt, so erwärmt es sich. Diesen Effekt kann man für eine Reihe von Anwendungen nutzbar machen. In unserer Forschung am UFZ haben wir auf diese Art Böden gereinigt, die mit Schadstoffen belastet waren. Denn so wie Wasser bei erhöhter Temperatur verdunstet, werden auch andere chemische Verbindungen durch Wärme flüchtiger. Das können zum Beispiel Lösungsmittel oder Treibstoffe sein, die in den Boden eingedrungen sind. Durch die Erwärmung des Bodens konnten wir gezielt Schadstoffe freisetzen, absaugen und die Abluft anschließend reinigen. Dadurch war es möglich, vorher belastete Böden schnell und vor allem im großen Maßstab wieder nutzbar machen.“

Das Forschungsnetzwerk RWTec
Ende der 1990er Jahre verlor die Reinigung kontaminierter Böden im Gebiet der ehemaligen DDR an Bedeutung – und die Wissenschaftler vom UFZ überlegten, welche anderen Probleme sich noch mit der Radiowellen-Technologie lösen lassen könnten. Gemeinsam mit Bauingenieuren der HTWK Leipzig entstand die Vision, die Technologie in der Gebäudesanierung einzusetzen. „In unserem ersten gemeinsamen Projekt mit dem UFZ haben wir untersucht, ob sich mit Radiowellen feuchte Gemäuer schneller trocknen und frischer Beton schneller aushärten lässt“, erzählt Detlef Schmidt, Professor für Baustofflehre an der HTWK Leipzig. Die Ergebnisse des „RWBau“-Projekts sind vielversprechend, die Ideen für abermals neue Anwendungsgebiete sprudeln.

Nach Abschluss des Forschungsprojekts 2014 gründen das UFZ und die HTWK Leipzig gemeinsam mit 13 Unternehmen aus ganz Deutschland das Forschungs- und Innovations-Netzwerk RWTec. Mit Fördermitteln aus dem „Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand“ (ZIM) des Bundeswirtschaftsministeriums ist es den Wissenschaftlern möglich, gemeinsam mit interessierten Unternehmen die Technologie weiterzuentwickeln und weitere Anwendungsfelder zu erproben. „Mittlerweile ist die Technologie soweit erforscht, dass Unternehmen sie schon bald erfolgreich einsetzen können“, erzählt Ulf Roland. Seit 2018 ist der Wissenschaftler sowohl am UFZ als auch an der HTWK Leipzig beschäftigt, wo er seitdem über den Transferverbund Saxony⁵ auch die Vernetzung mit sächsischen Wissenschaftlern und Unternehmen gezielt vorantreibt.
Ebenfalls seit 2018 ist die Koordination des Forschungsnetzwerks aus mittlerweile 21 Partnern am Forschungs- und Transferzentrum (FTZ) der HTWK Leipzig angesiedelt. „Das FTZ bietet uns die Entwicklungschancen, die für den weiteren Transfer in die Wirtschaft nötig sind“, erklärt Netzwerkmanager Dr. Ulf Trommler. Perspektivisch soll am FTZ ein Kompetenzzentrum entstehen, in dem Unternehmen unkompliziert Produkte und Dienstleistungen auf Grundlage der vielversprechenden Technologie erproben können. Die weiterhin enge Anbindung an Umweltforschungszentrum und Hochschule garantiert, dass neben der Markteinführung die weitere Erforschung der Radiowellen nicht aus dem Blick gerät.
Zur Person
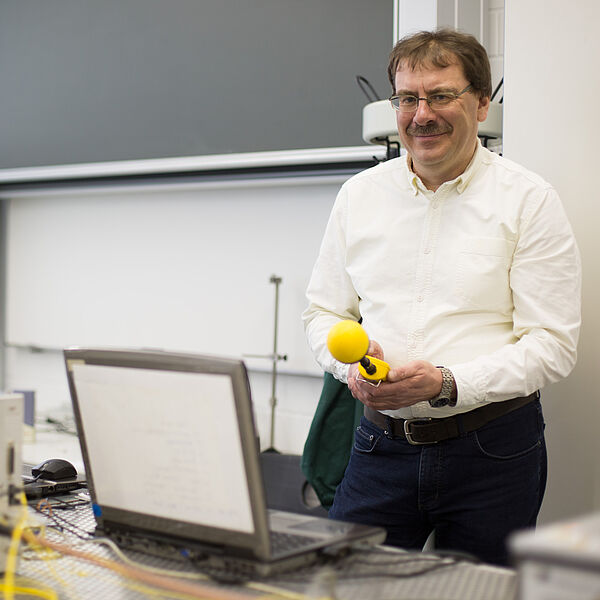
Dr. rer. nat. habil. Ulf Roland
Physikstudium und Promotion an der Universität Leipzig, wissenschaftliche Stationen in Berlin, Dresden, Tübingen, Louvain/Belgien, Hamburg. Seit 1996 Erforschung der Radiowellen-Technologie und anderer umwelttechnologischer Fragestellungen am Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. 2006 Habilitation an der TU Bergakademie Freiberg. Seit 2014 wissenschaftlicher Leiter des RWTec-Netzwerks, seit 2018 Tätigkeit an der HTWK Leipzig und am UFZ.
Mehr erfahren
Möchten Sie mehr über die Radiowellen-Forschung erfahren? Dieser Text ist ein Vorabdruck aus dem diesjährigen HTWK-Forschungsmagazin EINBLICKE (Erscheinungstermin: Herbst 2018). Darin lesen Sie außerdem, wie Radiowellen zur Reparatur von Schlaglöchern, zum Schutz von Kulturgütern und zur Sanierung von feuchten Mauern eingesetzt werden.

„Zuhause habe ich zwar auch Lego, aber keines, was man programmieren kann“, erklärt Julius begeistert. Er ist am 22. Juni mit seinen Eltern Nadine und Knut Ulrich bei der Langen Nacht der Wissenschaften an der HTWK Leipzig unterwegs. Genauer gesagt nimmt er am Workshop „Roboter selbst bauen und programmieren“ teil. Seine Eltern erzählen: „Wir haben Julius das Programmheft gezeigt – hier wollte er unbedingt hin. Da haben wir großes Glück, dabei sein zu können. Draußen stehen ja noch zig Familien und es gibt Tränen bei denen, die nicht rein können.“

Tatsächlich lockt das vielfältige Programm an diesem windigen Juniabend eine Rekordzahl von rund 2.500 Besuchern an die HTWK Leipzig. Am Campus Süd finden gut 40 Veranstaltungen aus allen Wissenschaftsgebieten der Hochschule statt. So kann man im Nieper-Bau im Wettstreit gegen einen Roboterarm Bälle werfen, gemeinsam mit den Nao-Robotern Fußball spielen oder sich vollautomatisiert eine Limo einschenken lassen. Ein Blick in den digitalisierten Spiegel verrät geschätztes Alter und aktuellen Puls, ein Sprung in den Sandkasten der Geotechniker wird als Verdichtungsimpuls auf eine Leinwand übertragen. Per Fön können Sensoren mit Energie gefüttert und Metallblumen zur Bewegung animiert werden. Stets neben den Exponaten: Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die unermüdlich die Zusammenhänge erklären und Fragen beantworten.

Auch Medienzentrum, Gutenberg-Bau und Hochschulbibliothek haben zu dieser besonderen Nacht ihre Türen geöffnet. Während man in letzterer endlich einmal lärmen und spielen darf, betonieren vor dem Gebäude zahlreiche Kinder kleine Betonmännchen. Daneben wird ein Deichbruch simuliert. Alumnus Enrico Apelt ist dafür extra aus Frankfurt angereist: „Der Besuch der ‚Langen Nacht der Wissenschaften‘ hat für mich sowohl berufliche als auch private Gründe. Ich arbeite als sogenannter ‚Risikoingenieur‘ im Bereich Industrieversicherungen, da gehört Hochwasserschutz neben Brandschutz zu den wichtigsten Themengebieten.“
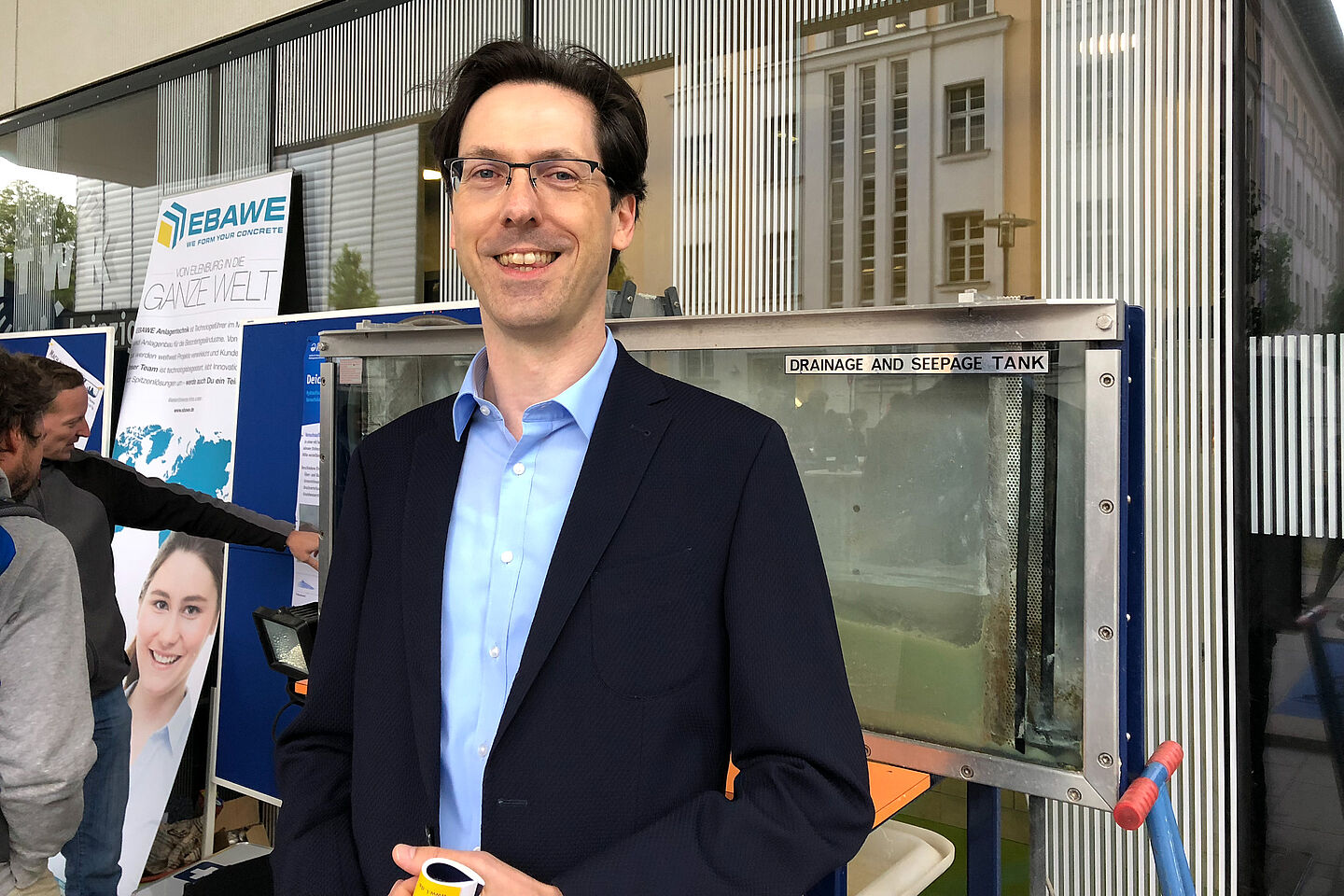
Bevor es weiter in die offenen Druck- und Verpackungslabore geht, lädt das Jazz-Duo Stiehler/Lucaciu zum Verweilen und Durchatmen ein. Der HTWK-Faschingsverein Ba-Hu Elferrat versorgt mit Gegrilltem und Getränken, die Hochschule verschenkt Zuckerwatte und Luftballons. Kleiner werden die Besuchertrauben erst gegen Mitternacht. Denn mit Forschern Elektroauto fahren, den Maschinensaal einer Druckerei besichtigen oder mit Robotern Fußball spielen – das kann man nur alle zwei Jahre. Die nächste Lange Nacht der Wissenschaften findet im Sommer 2020 statt.

Text: Pauline Reinhardt
Ob PowerPoint-Präsentationen, Requisiten oder Live-Experimente zur Veranschaulichung des Themas: Jegliche Hilfsmittel sind erlaubt! Die kurzweiligen Vorträge bieten auch fachfremden Zuhörern die Möglichkeit, sich von der Begeisterung der Slamer für ihr Projekt anstecken zu lassen. Es geht darum, das Thema unterhaltsam aufzubereiten, und dem Publikum zu zeigen, welchen Projekten sich Wissenschaftler mit Leidenschaft widmen.
Ziel ist es, mit wissenschaftlichen Themen Kopf und Herz der Zuschauer zu erreichen!
Termine:
28.06.2018 (10-16 Uhr): Coaching in der Hochschule Mittweida mit Franziska Wilhelm, professionelle Science Slamerin und Moderatorin.
25.10.2018 (abends): Science Slam im Studio der HS Mittweida mit Aufzeichnung zur Online-Auswertung - als Abendveranstaltung mit Rahmenprogramm und Publikum.
Thema:
Das Thema ist frei wählbar, vorgetragen in deutsch oder englisch.
Es geht darum das Thema spannend und erzählerisch zu vermitteln.
Übrigens:
Falls Mittweida zu weit und der Slam zu kurzfristig ist – das Graduiertenzentrum der HTWK Leipzig richtet jedes Frühjahr zusammen mit der Research Academy der Uni Leipzig ebenfalls einen Science Slam aus. Hierfür werden ebenfalls stets Slammer gesucht.
]]>
Die Digitalisierung verändert nicht nur unseren Alltag, sondern sie markiert auch einen ökonomischen Umbruch. Unternehmen, denen eine Anpassung nicht gelingt, überlassen die künftige Wertschöpfung womöglich anderen. Der Druck dieses Szenarios ist gerade für kleine Betriebe allgegenwärtig. Aber was heißt es konkret, auf die Digitalisierung zu reagieren? Zu dieser Frage laden die Handwerkskammer und die Industrie- und Handelskammer zu Leipzig am 13. Juni von 14.30 bis 17.30 Uhr an die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig), Nieper-Bau, Raum N 101, Karl-Liebknecht-Straße 134, 04277 Leipzig ein. Vier Digitalisierungsexperten – davon drei Wissenschaftler der HTWK Leipzig – werden in kurzen Vorträgen künftige Herausforderungen und Handlungsoptionen für Unternehmen der Region aufzeigen.
„Innovationen basieren nicht nur auf dem Einsatz digitaler Technologien, sondern benötigen auch neue Ansätze beim Denken und Umsetzen. Nur so lassen sich Produkt- und Prozessinnovationen, aber auch neue Geschäftsmodelle zeit- und kundennah umsetzen“, so Dr. Gerold Bausch vom Laboratory for Biosignal Processing an der HTWK Leipzig. Der Spezialist für eingebettete Systeme und digitale Signalverarbeitung hält den Einführungsvortrag der Veranstaltung.

Im Anschluss zeigt Dr. Karl-Peter Fritz von Hahn-Schickard (Stuttgart) auf, wie Unternehmen bestehende Fertigungsprozesse durch „Retrofit“ digital nachrüsten können. Nach einer kurzen Pause folgen zwei fachspezifische Vorträge: Prof. Ulrich Möller referiert über die Digitalisierung im Bauwesen anhand von Building Information Modeling (BIM). Dabei handelt es sich um ein Verfahren, das alle Betriebe betrifft, die Aufträge im Umfeld von Bau-, Sanierungs- oder Abrissprozessen generieren. Zum Abschluss erläutert Prof. Holger Müller die Zeit- und Kostenersparnisse von digitalisierten Einkaufs- und Lieferketten und stellt Studienergebnisse zum Stand von Einkauf 4.0 in Sachsen vor.
Die kostenfreie Veranstaltung richtet sich vorrangig an Vertreter von kleinen und mittleren Unternehmen der Region. » Anmeldung auf der Website der IHK zu Leipzig
Tag für Tag entstehen in den Laboren, Werkstätten und Büroräumen der Hochschulen neue Ideen, neues Wissen und neue Technologien. Damit dieses Know-how noch schneller und zu breiteren Zielgruppen als bisher in die Praxis gelangt, haben sich die sächsischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Dresden, Leipzig, Mittweida, Zittau/Görlitz und Zwickau zum Transferverbund Saxony⁵ zusammengeschlossen.
Zur öffentlichen Auftaktveranstaltung des Transferverbunds am 4. Mai 2018 an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig) stellten die fünf Hochschulen ihre Strategie und Pläne für die kommenden fünf Jahre rund 150 Gästen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft vor.
Bundesforschungsministerin Anja Karliczek sagte anlässlich des startenden Transferverbundes: „Unsere Hochschulen sind Orte voller Ideen und Erkenntnisse. Mir ist wichtig, dass wir mit den Ergebnissen aus Forschung und Entwicklung das Leben unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger besser machen. Wir arbeiten deshalb daran, dass Innovationen noch schneller bei den Menschen ankommen. Mit Saxony⁵ packen jetzt fünf sächsische Hochschulen mit regionalen Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Partnern das Thema an und bilden ein dichtes Netzwerk quer durch den Freistaat Sachsen.“ Deutschlandweit investieren die Bundesregierung und die Länder mit der Initiative „Innovative Hochschule“ über zehn Jahre insgesamt 550 Millionen Euro in die Umsetzung innovativer Strategien des forschungsbasierten Wissenstransfers.
„Ich freue mich, dass die hohe wissenschaftliche Kompetenz der beteiligten fünf Hochschulen mit der Förderung des Bundes für Saxony⁵ bestätigt wird. Im Fokus der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften stehen immer die praktische Anwendung und damit der konkrete Nutzen wissenschaftlicher Erkenntnisse. Es stimuliert die Forschung, wenn sie die Anwendungsfragen der Praxis kennt, und es hilft den Unternehmen, wenn sie über Forschungsmöglichkeiten und -schwerpunkte der Hochschulen informiert sind und wissen, wie sie davon profitieren können. Die kooperierenden Hochschulen von Saxony⁵ werden ihre Aktivitäten zum Ideen-, Wissens- und Technologietransfer gemeinsam konzipieren, durchführen und kommunizieren. Damit versorgen sie Wirtschaft und Gesellschaft unseres Landes flächendeckend mit vernetztem Wissens- und Technologietransfer“, so die sächsische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Dr. Eva-Maria Stange.
Prof. Gesine Grande, Rektorin der HTWK Leipzig und Gastgeberin der Auftaktveranstaltung, zeigt sich ebenfalls zufrieden: „Seit Jahren kooperieren die fünf Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Sachsen konzeptionell und inhaltlich in der Weiterentwicklung und Profilierung von Lehre, Forschung und Transfer. Saxony⁵ ist für uns eine große Chance, eine neue Qualität im Transfer von Wissen und Technologien zu erreichen. Die Zusammenführung unserer Kompetenzen und Netzwerke in Saxony⁵ ermöglicht es uns, neue Wege zu erproben, um den Austausch mit der Wirtschaft und auch mit der Gesellschaft zu intensivieren.“
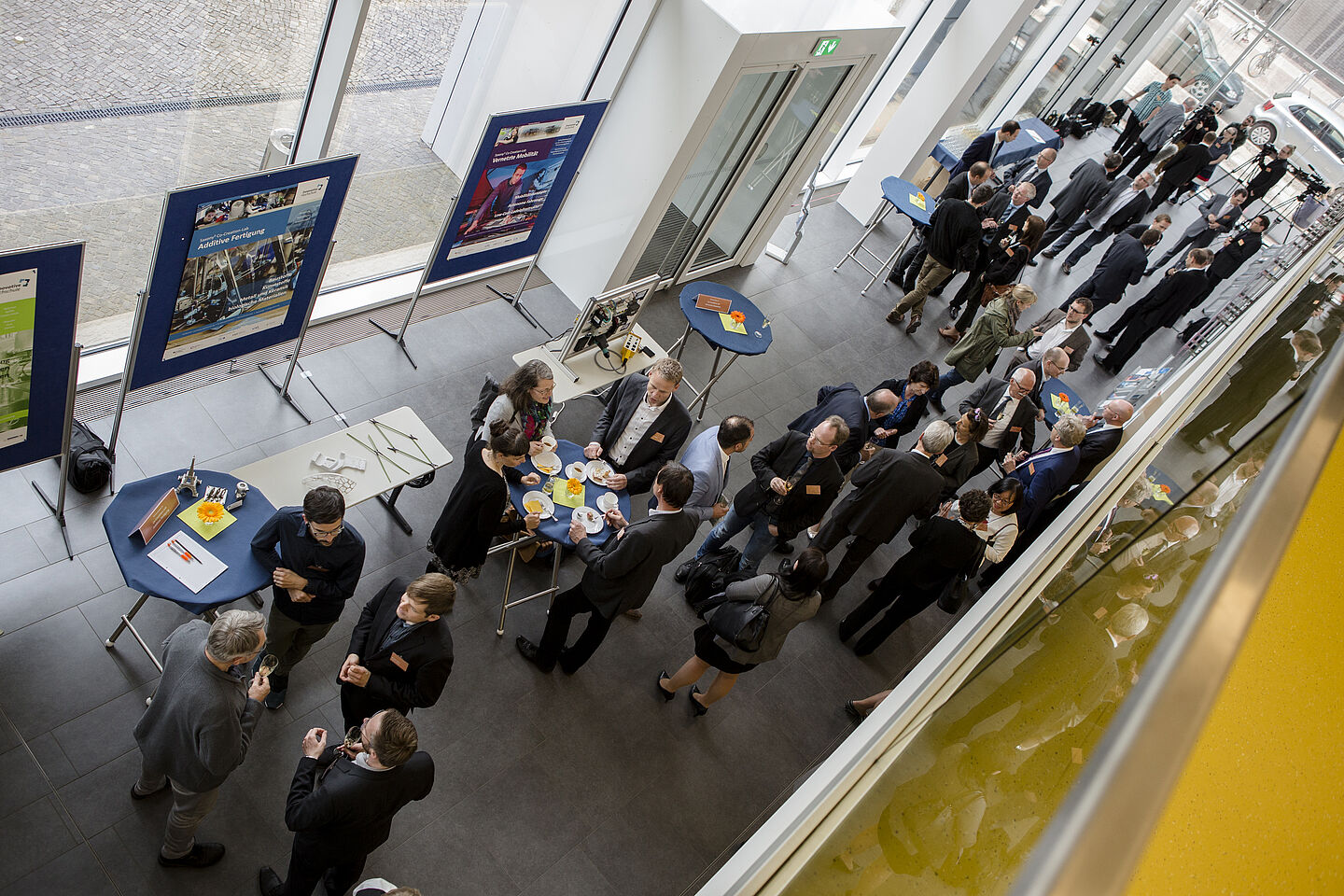
Nach den Grußworten stand die Vorstellung der Projektstruktur und der Umsetzungskonzepte der zwölf Teilvorhaben im Mittelpunkt. Umrahmt von einer Posterpräsentation entstanden beim anschließenden Get-together intensive Diskussionen über Potenziale und Wirkungsdimensionen der Transferansätze von Saxony⁵.
Autorin: Dr. Rebecca Schweier
„Ich freue mich, dass wir jetzt viele qualitativ hochwertige Vorhaben unterstützen können, um einen echten Innovationsschub beim Auf- und Ausbau der Zusammenarbeit der Hochschulen mit Wirtschaft und Gesellschaft auszulösen“, so Prof. Johanna Wanka, Bundesministerin für Bildung und Forschung, bei der Verkündung der Auswahlentscheidung am 4. Juli 2017 in Berlin. „Dass insbesondere so viele Anträge von Fachhochschulen das Auswahlgremium in einem offenen Wettbewerb überzeugen konnten, beweist das besonders große Potenzial gerade dieser Hochschulen als Innovationspole mit regionaler und auch überregionaler Ausstrahlung. Die ‚Innovativen Hochschulen‘ werden deshalb den Transfer von Forschungsergebnissen aus allen Wissenschaftsdisziplinen zum Nutzen für Wirtschaft und Gesellschaft stärken und Leuchttürme für unsere Regionen werden.“
Prof. Gesine Grande, Rektorin an der HTWK Leipzig: „Wir freuen uns unglaublich, dass wir uns unter den 118 Projektanträgen erfolgreich behaupten konnten. Das konnte nur gelingen, weil wir gemeinsam mit den anderen sächsischen HAW schon lange in einem leistungsstarken Bündnis in vielen Bereichen kooperieren. Das Sächsische Wissenschaftsministerium hat uns unterstützt, ein gemeinsames Konzept zu entwickeln. Die Fördermittel für den Transferverbund Saxony⁵ werden es nun ermöglichen, Forschung und Transfer sachsenweit mit einem innovativen Ansatz und bedarfsorientierten Instrumenten in einer neuen Qualität umzusetzen, zum Vorteil von Wirtschaft und Gesellschaft der Region.“
Zu den konkreten Vorhaben im Rahmen des Saxony⁵-Verbundes gehört beispielsweise die Einrichtung von fünf hochschulübergreifenden „Co-Creation Labs“, in welchen Hochschulen und Unternehmen gemeinsam an der Lösung von aktuellen Herausforderungen arbeiten, darunter die Themenbereiche „Fabrik der Zukunft“ und „Vernetzte Mobilität“. Die Koordination des Transferverbundes liegt bei der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden.
]]>