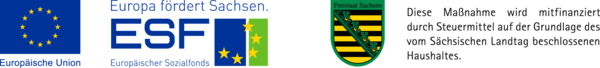Regelungen zu diesem Studiengang finden Sie in der Studien- und Prüfungsordnung.
Die kompletten Modulbeschreibungen des Studiengangs finden Sie im Modulux.
Die nachfolgende Moduldarstellung bietet nur einen ersten Überblick.

Bachelor of Arts (B.A.)
Social Work Bachelor of Arts
7 Semester / 210 ECTS Punkte
deutsch
Bewerbung: 1. Mai - 15. Juli, Teilnahme am bundesweiten Dialogorientierten Serviceverfahren (DoSV)
zwei Praxisphasen im 2. und 5. Semester
Soziale Arbeit orientiert sich an den Prinzipien des demokratischen sozialen Rechtsstaats. Menschenwürde, Freiheit, Gleichberechtigung und Solidarität bilden das Wertefundament. Das Grundgesetz und die Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen bilden die Grundlage ihres professionellen Handelns.
Soziale Arbeit ist mit dem Ziel beauftragt, die Gestaltung einer sozialen Gesellschaft zu formen. Mit sozialstaatlichen Leistungen, Bildungs- und Freizeitangeboten sowie politischer Einflussnahme soll soziale Benachteiligung behoben und im besten Fall präventiv verhindert werden. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter unterstützen, fördern und begleiten Menschen aller sozialer Milieus und Altersstufen, die von einer Notsituation bedroht bzw. betroffen sind.
Im Studium „Soziale Arbeit B.A.“ eignen sich die angehenden Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter wissenschaftlich fundiert und interdisziplinär Theorie- und Handlungswissen an - unter anderem aus den Bezugswissenschaften Recht, Psychologie, Pädagogik und Medizin. Dabei werden berufsethische, sozialrechtliche, pädagogische und methodische Kompetenzen vermittelt.
Das Studium umfasst insgesamt sieben Semester. Die ersten drei Semester vermitteln den Studierenden die wesentlichen theoretischen Grundlagen, wobei im zweiten Semester ein Einstiegspraktikum (300h) absolviert wird. An der HTWK Leipzig gehören Methoden und Theorien der Sozialen Arbeit, Gesellschafts- und Humanwissenschaften sowie Rechtswissenschaften zu den Lehrgebieten. In diesem Zeitraum finden darüber hinaus Lehrveranstaltungen zu Studien- und Methodenkompetenzen statt.
Das fünfte Semester besteht aus einer Praxisphase von mindestens 21 Wochen. Die Studierenden erhalten während ihrer fachlich angeleiteten Tätigkeit Einblick in ein Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit. Dabei erwerben sie grundlegende berufliche Erfahrungen. Ziel ist es, dass die rechtlichen, institutionellen und politischen Rahmenbedingungen Sozialer Arbeit exemplarisch in einem Bereich kennenzulernen. Die Praxisphase wird durch Ausbildungssupervision und einem Theorie-Praxis-Seminar von der Hochschule begleitet.
Während einer Projektarbeit im sechsten und siebten Semester erlangen die Studierenden Kenntnisse in Konzeption, Durchführung und Evaluation. Hierbei stehen mehrere Themenfelder zur Auswahl.
Darüber hinaus wählen sie im vierten und siebten Semester Veranstaltungen aus folgenden Wahlpflichtmodulen:
Damit wählen die angehenden Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter einen eigenen inhaltlichen Schwerpunkt in einem der Felder:
Zu weiteren Pflichtmodulen zählen die Bedingungen professionellen Handelns, Ethik in der Sozialen Arbeit und das Bachelormodul. Im letzten Semester können im Wahlpflichtbereich noch einmal Vertiefungen in bestimmten Bereichen (z.B. rechtlich, theoretisch oder methodisch) gewählt werden.
Regelungen zu diesem Studiengang finden Sie in der Studien- und Prüfungsordnung.
Die kompletten Modulbeschreibungen des Studiengangs finden Sie im Modulux.
Die nachfolgende Moduldarstellung bietet nur einen ersten Überblick.
(Die Studierenden wählen ein Angebot im 3. Semester und zwei Angebote im 5. Semester.)
(Die Studierenden wählen ein Angebot im 3. Semester und ein Angebot im 5. Semester)
(Die Studierenden wählen ein Angebot im 5. Semester)
Die exzellente Qualität von Studium und Lehre ist durch die Akkreditierung nach den Regeln des Akkreditierungsrates garantiert. Im Folgenden finden Sie die Akkreditierungsurkunden für die einzelnen Zeiträume:
Akkreditierungsurkunde SAB bis 30.04.2031 Akkreditierungsrat
Beschluss Akkreditierungsverlängerung SAB bis 30.09.2023
Bescheid Akkreditierungsverlängerung SAB bis 30.09.2023
Akkreditierungsurkunde SAB bis 30.09.2021 Akkreditierungsrat
Akkreditierungsurkunde SAB bis 30.09.2014 Akkreditierungsrat
Das Seminar vermittelt Grundlagen der Prävention und Intervention sowie für die Kinder- und Jugendarbeit relevanten Theorien. Außerdem werden praktische Beispiele für methodisches oder präventives Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen vermittelt, erprobt und ausgewertet.
Beispiele der praktischen Aufgaben:
Sozialpsychologie erforscht das Verhalten von Menschen in sozialen Kontexten. Die Vorlesung behandelt Theorien und Experimente zu Themenfeldern wie Lernen, Wahrnehmung, Persönlichkeit, Einstellung und Verhalten eines Individuums.
In diesem Modul werden die existenzsichernden Leistungen der Sozialgesetzbücher II, XII und des Asylbewerberleistungsgesetzes und deren Stellung im Rechtssystem vermittelt.
Folgendes Kompetenzen sollen dabei erworben werden:

Das Seminar vermittelt Wissen über soziales Lernen in Gruppen, Gruppenprozesse und - dynamiken. Darüber hinaus steht die Rolle der Gruppenleitung im Zentrum des Seminars. Die Studierenden können Methoden als Teilnehmende erfahren und anschließend im Seminar reflektieren.
Konkrete Wissensbereiche:
In der Gemeinwesenarbeit werden die Bedürfnisse des Gemeinwesens, also beispielsweise der Menschen eines Stadtteils, ermittelt und durch partizipative Methoden versucht zu befriedigen. Das Seminar behandelt die Geschichte der Gemeinwesenarbeit sowie praktische Methoden und theoretische Modelle. Eine Stadtteilbegehung und die Teilnahme an einer Quartiersratssitzung bieten den Studierenden praktische Anknüpfungspunkte an das Tätigkeitsfeld.
Das Seminar behandelt Theorie und Geschichte des deutschen Sozialstaats, analysiert ausgewählte Probleme des Sozialstaats und beschäftigt sich mit den aktuellen Entwicklungen der Kommunen. Die Studierenden sollen dazu befähigt werden, das deutsche Sicherungssystem im europäischen Kontext einzuordnen, staatliche Sozialleistungen zu kennen und diese diskutieren zu können.
Das Verwaltungsrecht und die Soziale Arbeit überschneiden sich häufig. Das Seminar vermittelt deshalb die juristischen Grundlagen und Verfahren im Kontext von Verwaltungsakten. Außerdem wird die Rolle der Verwaltung im demokratischen, sozialen Rechtsstaat beleuchtet. Die Studierenden arbeiten im Seminar mit dem Sozialgesetzbuch X, das Verwaltungsakte normiert.
Die Studierenden erhalten im Seminar einen Überblick über die Wohlfahrtspflege in Deutschland, ihre Grundlagen und ihre Entwicklungsgeschichte. Der Hintergrund zur heutigen Trägerlandschaft wird erläutert und wichtige Behörden, deren Zuständigkeiten und Organisation vorgestellt. Das Seminar vermittelt Wissen zu rechtlichen Regelungen im Bereich der Sozialen Arbeit.
In diesem Modul werden die existenzsichernden Leistungen der Sozialgesetzbücher II, XII und des Asylbewerberleistungsgesetzes und deren Stellung im Rechtssystem vermittelt.
Folgendes Kompetenzen sollen dabei erworben werden:
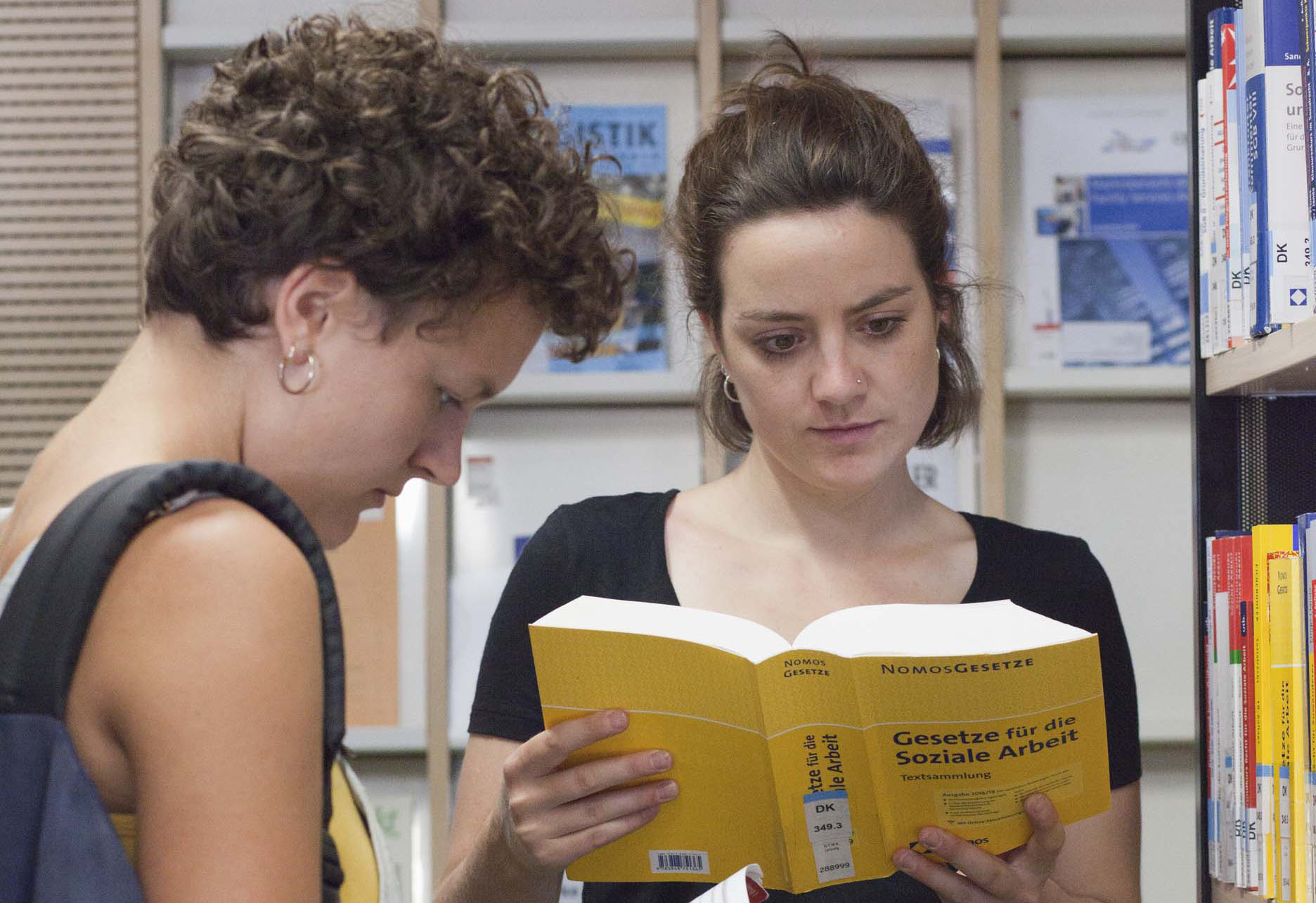
Die anwendungsnahe Vorlesung wird alle zwei Wochen abgehalten. Es werden für die Berufspraxis der Sozialen Arbeit relevante Rechtsgrundlagen vermittelt.
Diese sind beispielsweise:

Von Sokrates bis zu Maria Montessori behandelt das Seminar klassische Konzepte der Pädagogik. Neben der Geschichte der Pädagogik werden soziologische und philosophische Fragestellungen diskutiert. Dabei erwartet die Studierenden ein anregender Diskurs, Austausch und Lektüre im Selbststudium.
Die Studierenden erwartet eine fachbezogene Sprachausbildung, die die beruflichen Möglichkeiten erweitert. Das Seminar setzt Grundkenntnisse in der ausgewählten Sprache voraus. Behandelt wird fremdsprachliche Lektüre, Grammatik- und Fachterminologie sowie Kommunikation zu beruflich relevanten Themen und Anlässen.
Hier geht es zum aktuellen Lehrveranstaltungsplan. Wähle dazu zuerst den gewünschten Studiengang aus und dann eine beliebige Seminargruppe und anschließend "Alle Wochen".

„Gemeinsam Rätsel lösen, Flüsse überqueren und sich blind durch den Wald führen lassen im Studium der Sozialen Arbeit? Ja! Das Seminar der Sozialen Arbeit mit Gruppen hält einen Erlebnispädagogischen Ausflug für die Studierenden bereit! Vertiefen lässt sich die Erlebnispädagogik dann im 3. und 5. Fachsemester."
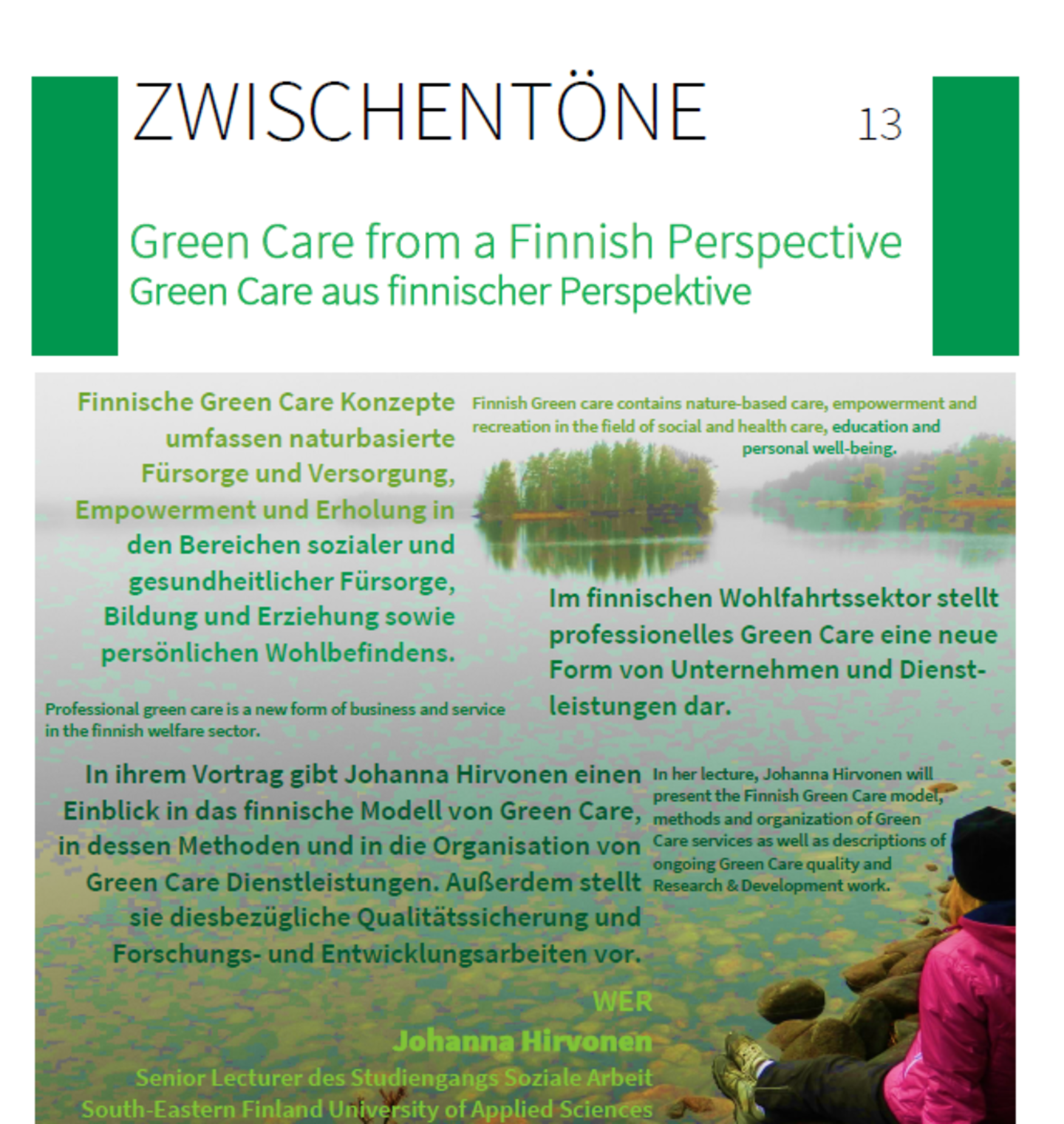
Die Vortragsreihe „Zwischentöne“ hält immer wieder spannende Themenreisen bereit. Hier: Greencare. Ein Konzept naturbasierter Sozialer Arbeit vorgetragen von Dozentin Johanna Hirvonen, die von der finnische Umsetzung von Greencare berichtete. Weitere Beispiele der Reihe finden sich hier (Facebook Page).

LAUTSPRECHER ist eine studentische Gruppe, die sich regelmäßig zu einem Stammtisch trifft. Ziel ist es einen Austausch zwischen Studierenden, Mitarbeitenden und Lehrenden zur kritischen Auseinandersetzung mit sozialpolitisch relevanten Themen zu ermöglichen.
Toll, dass Sie sich für den Studiengang Soziale Arbeit an der HTWK Leipzig interessieren! Hier gibt es die Möglichkeit kurze Beispielaufgaben zu typischen Inhalten auszuprobieren. Wichtig: Unsere Beispielaufgaben sind kein Leistungstest! Sie sollen vielmehr einen ersten Einblick geben, mit welchen Themen und Aufgabenstellungen sich Studierende dieses Studiengangs befassen.
Mit dem erfolgreichen Studienabschluss wird den Absolventinnen und Absolventen die staatliche Anerkennung erteilt, die zum Führen der Berufsbezeichnung "Staatlich anerkannte Sozialarbeiterin" bzw. „Staatlich anerkannter Sozialarbeiter“ berechtigt. Anstellungen finden die Absolventinnen und Absolventen beispielsweise bei der kommunalen Sozialverwaltung (z. B. Das Jugend- oder Gesundheitsamt) sowie bei freien Trägern der Wohlfahrtspflege (Wohlfahrtsverbände und andere gemeinnützige Organisationen/Vereine). Seit einigen Jahren sind Sozialarbeitende auch zunehmend freiberuflich tätig. Alternativ zum Berufseinstieg haben Studierende mit dem erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiums die Möglichkeit, einen Master - Praxisentwicklung und Forschung Soziale Arbeit an der HTWK anzuschließen.
Frühpädagogik
Kinder- und
Jugendarbeit
Heimerziehung
Gesundheits- und
Suchtkrankenhilfe
Krankenhaussozialdienst
Altenarbeit
Straffälligen- und
Wohnungslosenhilfe
Stadtteilarbeit
Allgemeine oder Fachgebundene Hochschulreife, Fachhochschulreife bzw. ein Hochschulzugang nach § 18 Abs. 3 - 7 SächsHSG.
Die überwiegende Mehrheit der Bachelorstudiengänge an der HTWK Leipzig ist zulassungsbeschränkt. Die Vergabe der Studienplätze erfolgt über das Dialogorientierte Serviceverfahren (DoSV) auf der Grundlage der zulassungsrechtlichen Vorschriften. Die Studienplätze werden nach Abzug verschiedener Vorabquoten (z.B. Zweitstudienbewerber-/innen) vergeben nach: der HZB-Note (Quote 20 %), der Wartezeit (Quote 20 %) und nach den Kriterien der hochschulinternen Auswahl (Quote 60 %).
Das detaillierte Zulassungsverfahren der HTWK ist hier beschrieben.
Die NC-Werte-Übersicht finden Sie unter Örtlicher Numerus clausus (NC).
Sofern eines der nachstehend aufgeführten Merkmale 1 - 4 zutrifft, wird die Durchschnittsnote der HZB um den entsprechenden Bonus verbessert. Werden innerhalb eines Merkmals gleichzeitig mehrere Untermerkmale erfüllt, findet nur ein Bonuswert Berücksichtigung (z. B. Merkmal 3 a.) und 3 c.) = 0,3). Erfüllen Studienbewerbernde mehrere Merkmale, so wird der Bonus addiert bis zu einem maximalen Wert von 1,0.
Merkmal 1 - Bonus 0,5
Merkmal 2 - Bonus 0,3
Merkmal 3 - Bonus 0,3
Nachweis sonstiger relevanter Erfahrungen
Merkmal 4 - Bonus 0,3
Die hier aufgeführten Bonuskriterien gelten für die Bewerbung zum Wintersemester 2025/26. Rechtsgrundlage ist die aktuell geltende Auswahlordnung (Ordnung für das hochschulinterne Auswahlverfahren grundständiger Studiengänge), nachzulesen unter Rechtsgrundlagen.
Alle Bachelorstudiengänge starten im Wintersemester (Oktober). Für Bewerberinnen und Bewerber, die ihre HZB bis zum 15.07. des Bewerbungsjahres erwerben, gilt die Bewerbungszeit vom 01.05. bis 15.07. Bewerbungen nach dem 15.07. des Bewerbungsjahres können nicht berücksichtigt werden (Ausschlussfrist). "Altabiturienten", d.h. alle, die ihr Abitur oder ihre Fachhochschulreife vor dem aktuellen Jahr erworben haben, bewerben sich bitte wenn möglich bis zum 31.05. Sie erleichtern uns damit die fristgerechte Bearbeitung aller - auch Ihrer - Bewerbungen.
Ausnahmen:
Bei Erfüllung gewisser fachspezifischer Vorkenntnisse, wie z. B. eine abgeschlossene Berufsausbildung oder die Teilnahme an fachspezifischen Leistungskursen, kann eine Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung (HZB) erreicht werden. Die verbesserte Durchschnittsnote (Eignungsnote) darf rechnerisch den Wert 1,0 nicht unterschreiten.
Alle Informationen zu den aktuell gültigen Bonuskriterien für Bachelorstudiengänge.
Dies entspricht der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung (HZB).
Folgende Qualifikationen werden als Hochschulzugangsberechtigung anerkannt: allgemeine Hochschulreife (Abitur), Fachhochschulreife (Anerkennung in Sachsen vorausgesetzt) und fachgebundene Hochschulreife (für die entsprechende Fachrichtung). Die Bewerbung für ein Studium ohne Abitur ist unter bestimmten Voraussetzungen (§18 SächsHSG) möglich. Ergänzende Informationen finden sich beim Dezernat Studienangelegenheiten und in der Studienberatung.
Reicht die Zahl der Studienplätze nicht für alle Bewerberinnen und Bewerber, entstehen im Ergebnis der Auswahlverfahren Zulassungsgrenzen (Numerus Clausus). Diese Grenzränge ergeben sich für jeden Studiengang nach Abschluss des Auswahlverfahrens jährlich neu. Hier finden Sie eine Übersicht der NC-Werte je Studiengang aus den letzten Jahren.
Die Wartezeit entspricht der Anzahl der Halbjahre (Wartesemester) nach Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung (HZB) abzüglich bereits absolvierter Studiensemester an deutschen Hochschulen. Eine über acht Jahre hinausgehende Wartezeit bleibt unberücksichtigt.