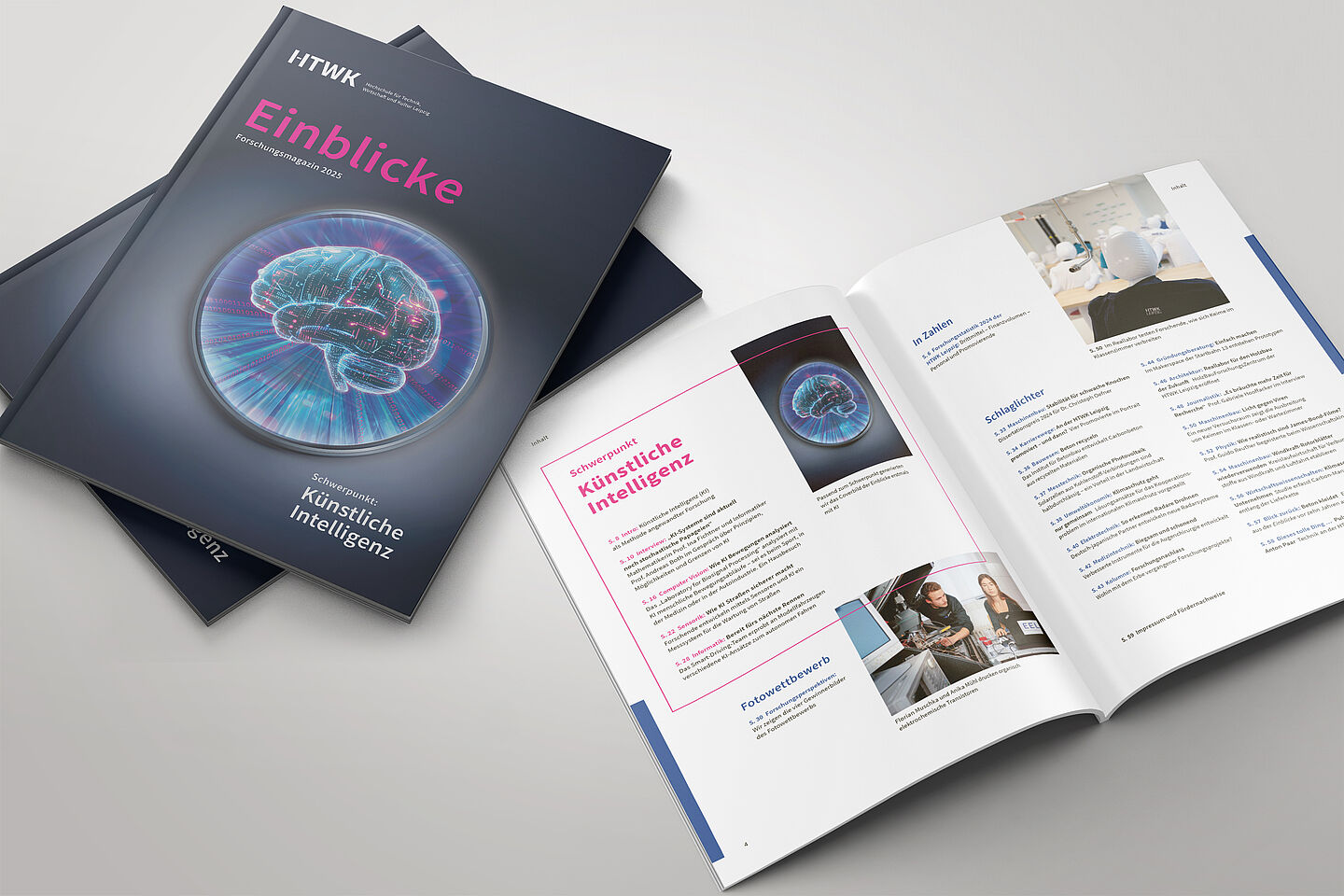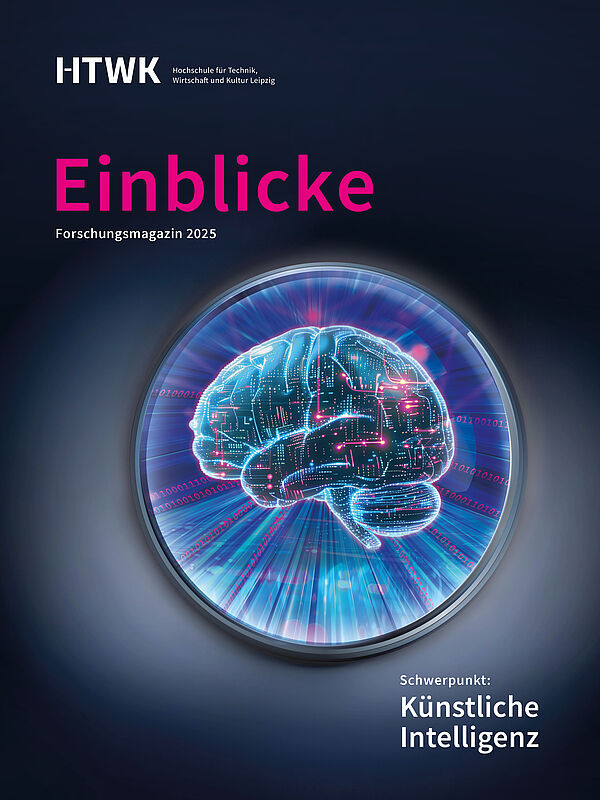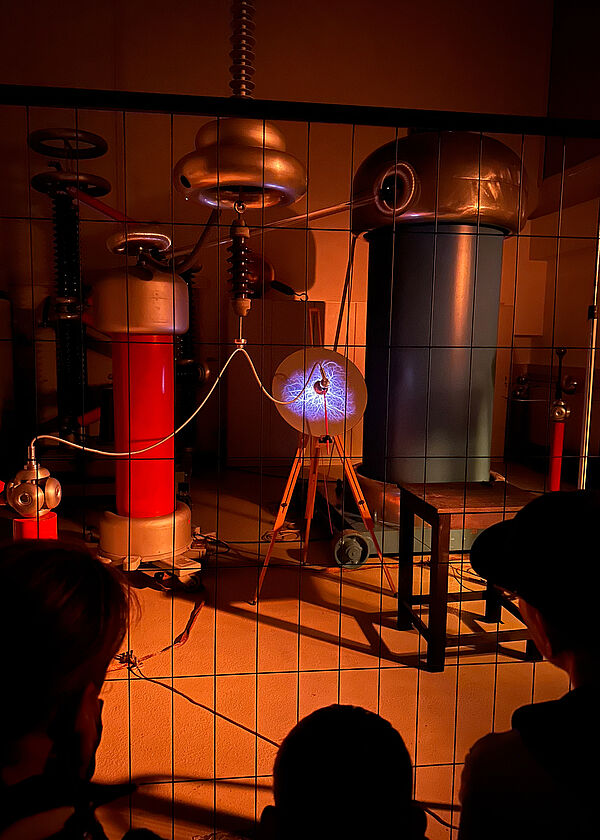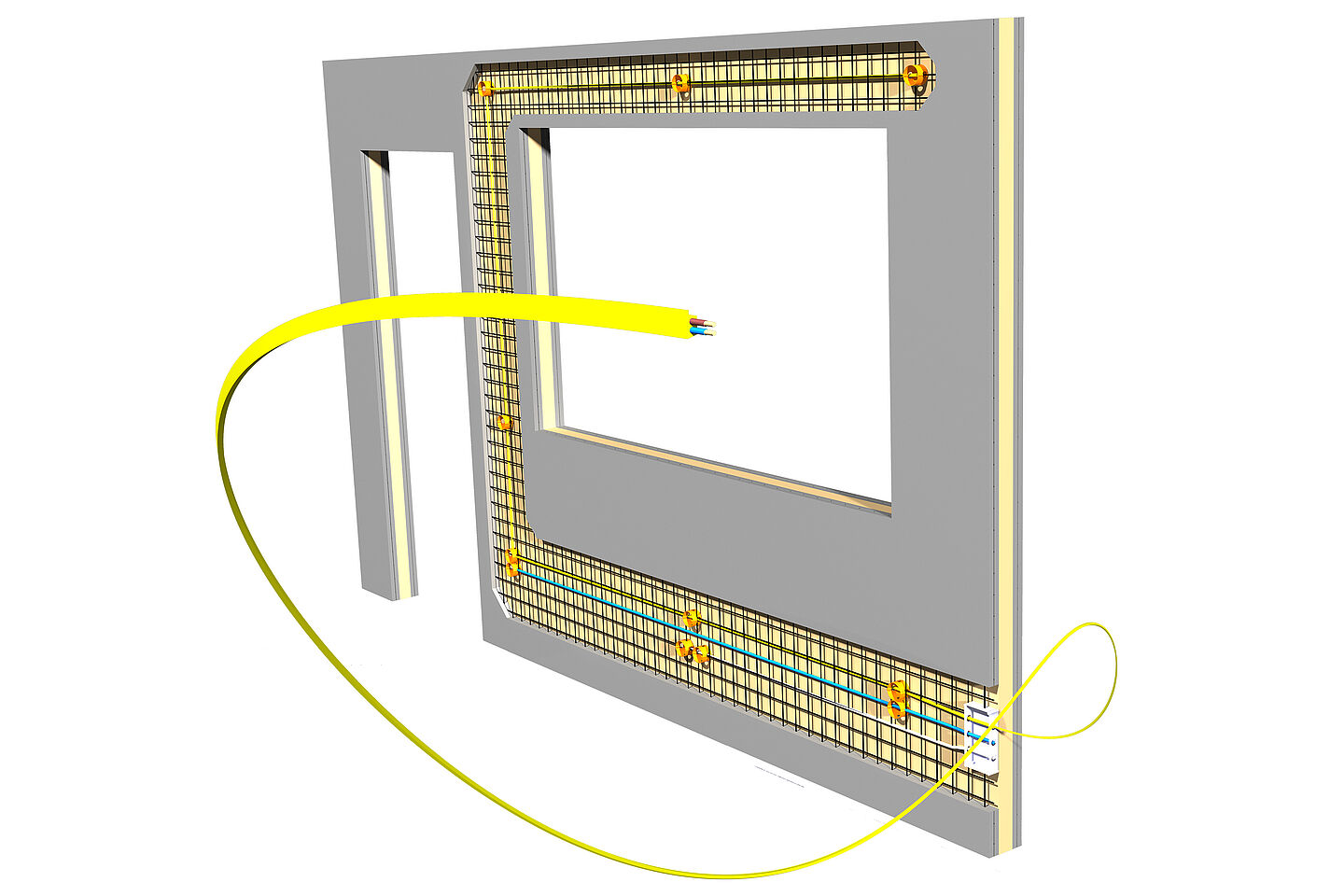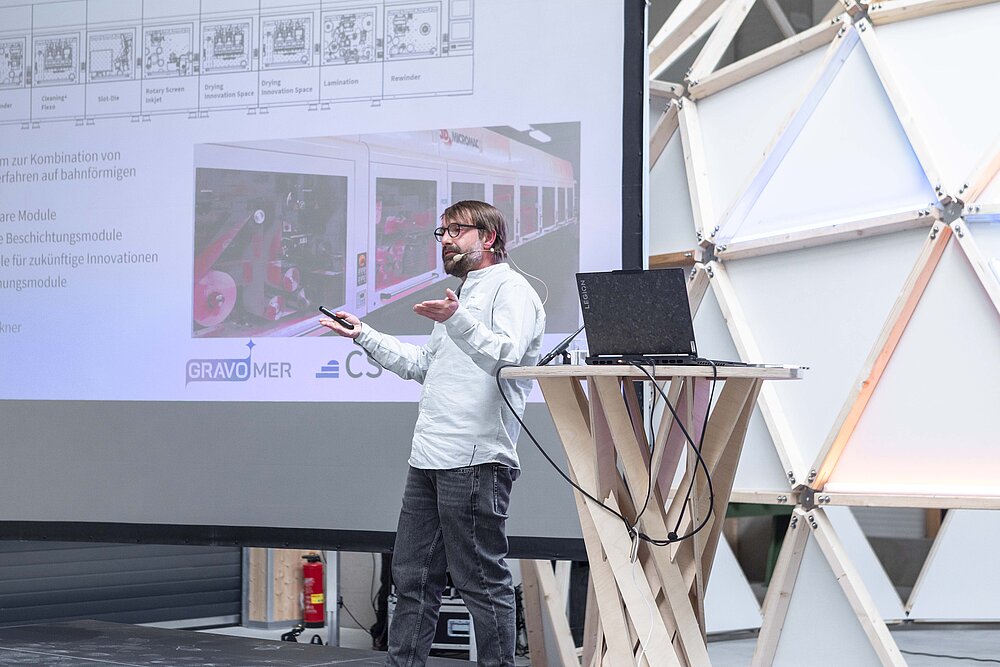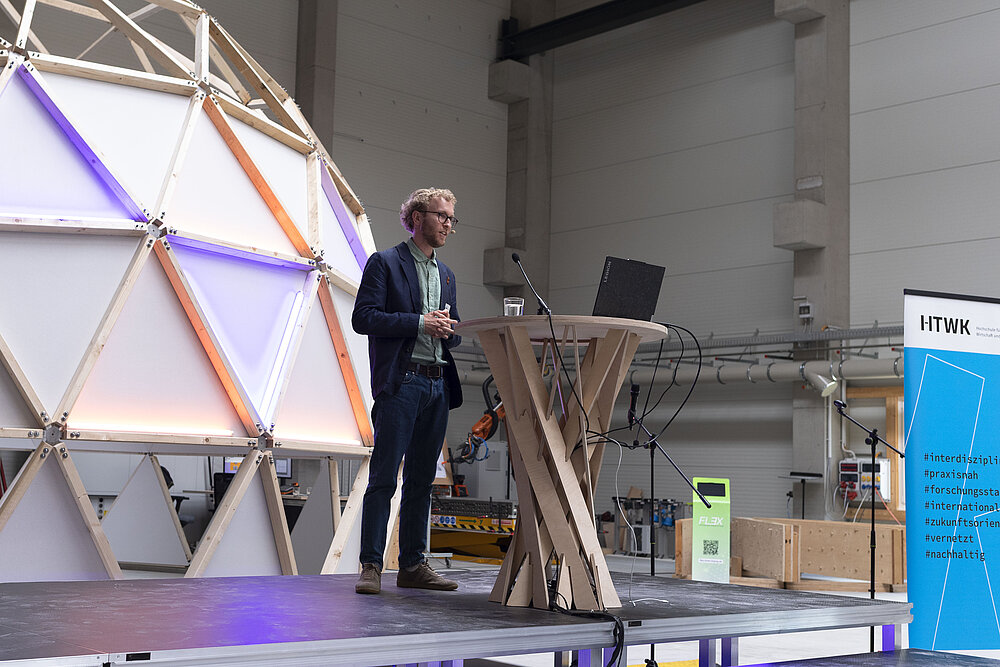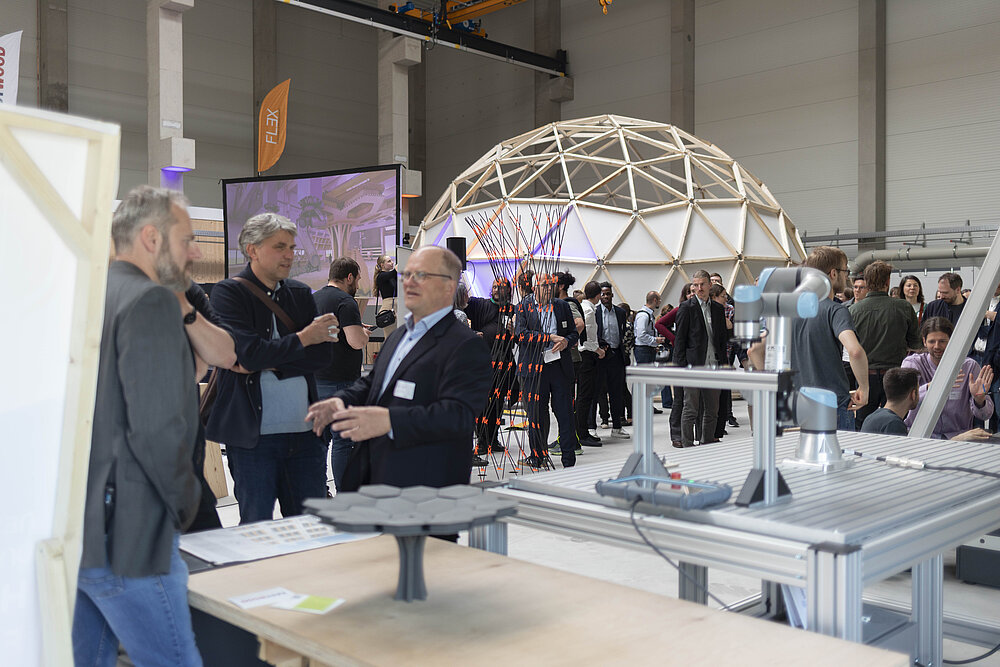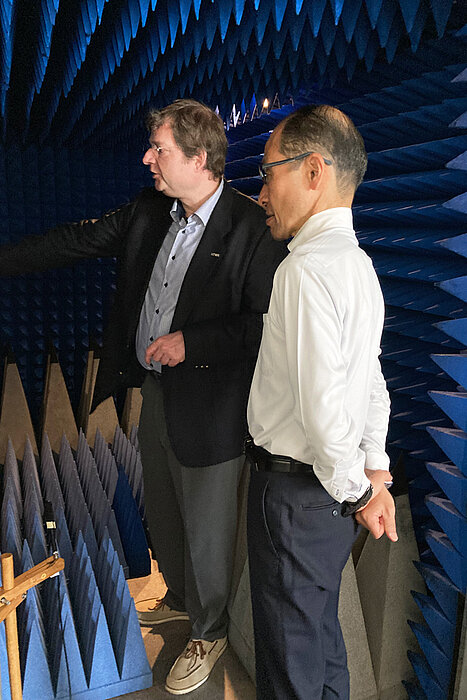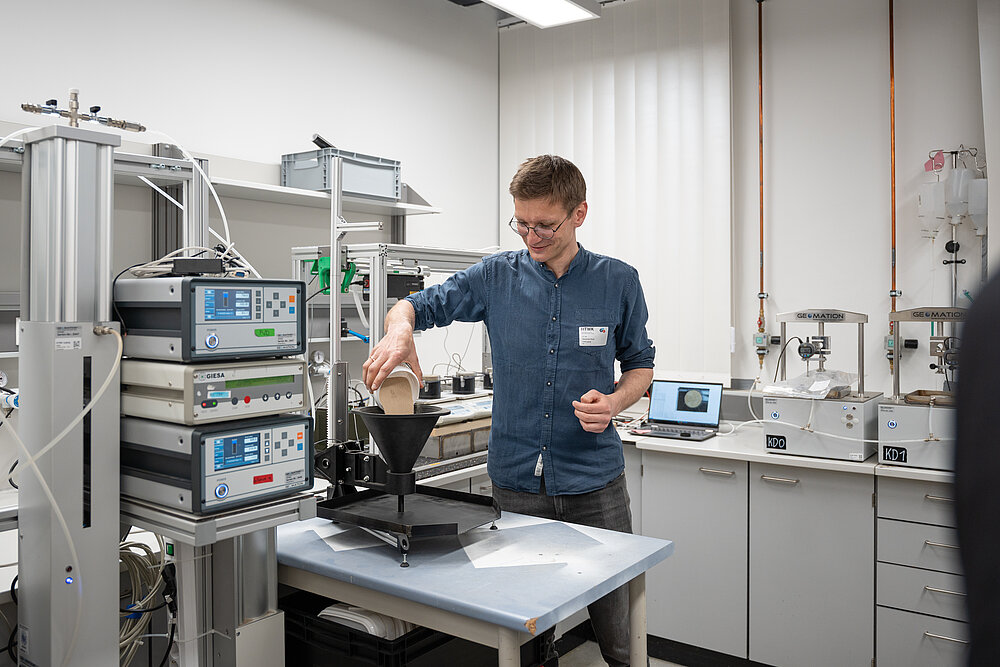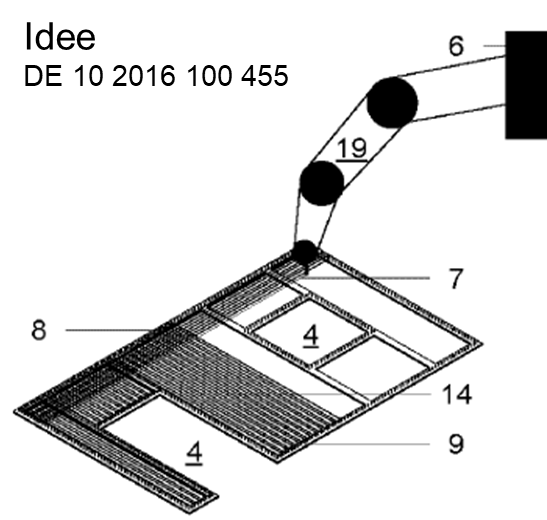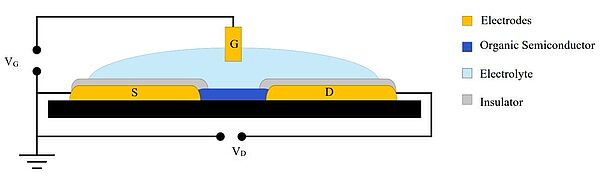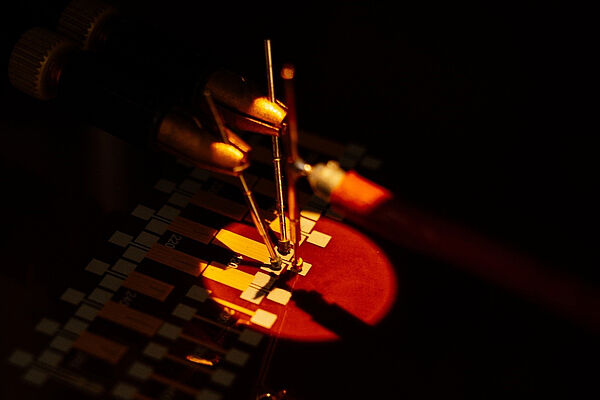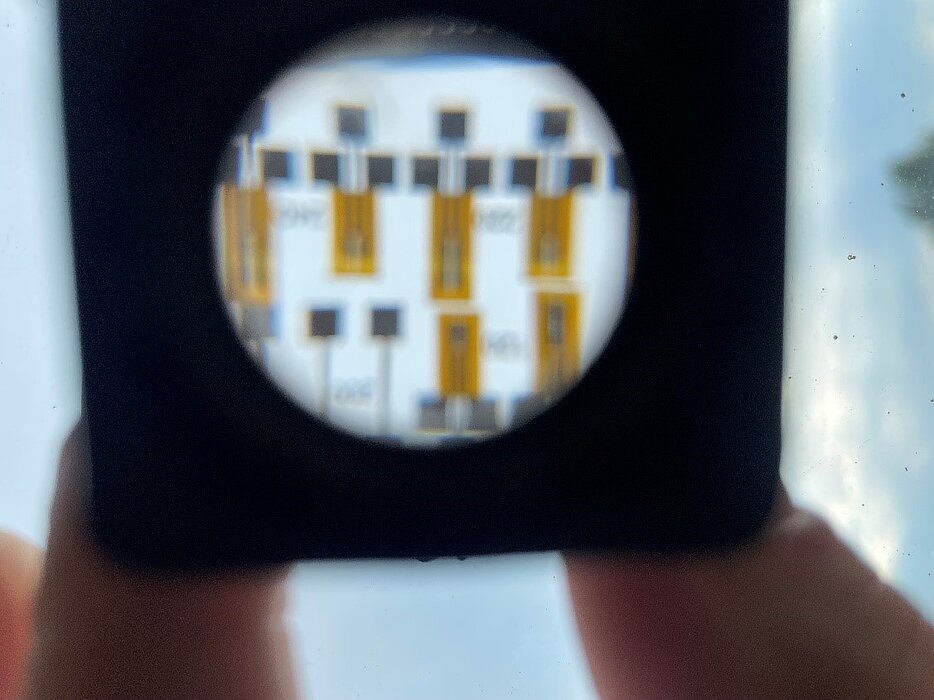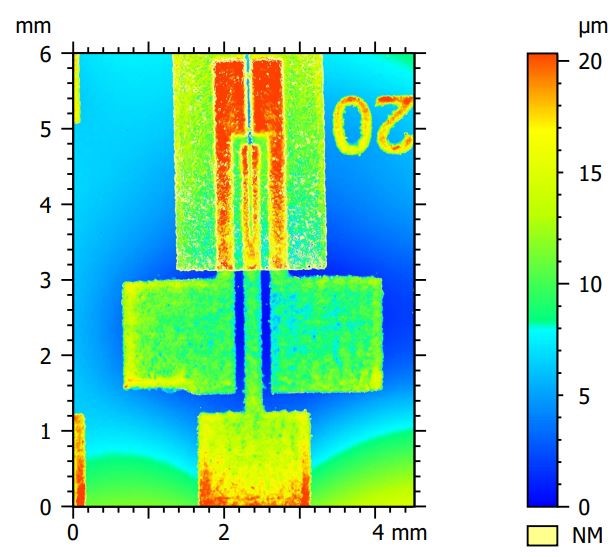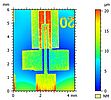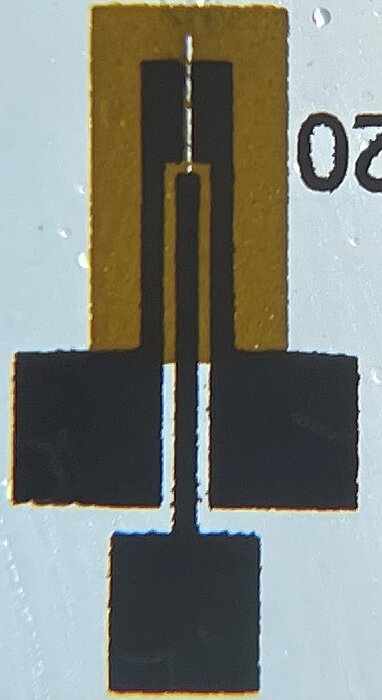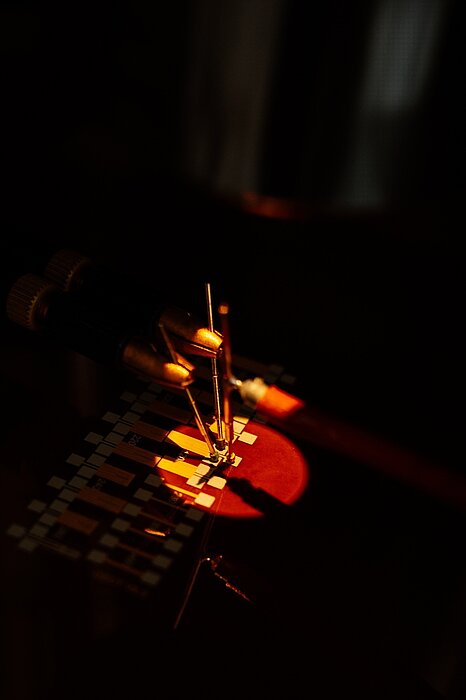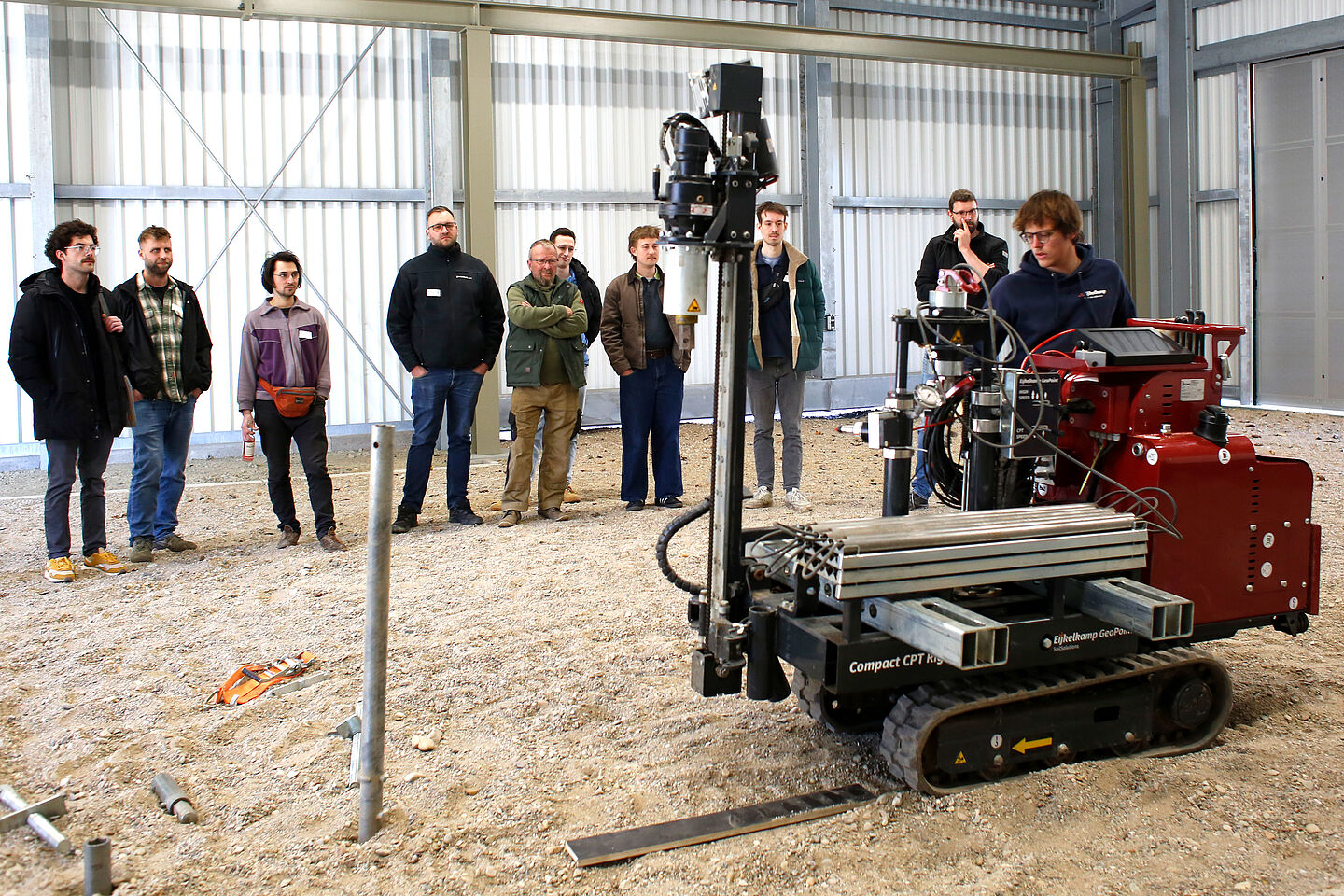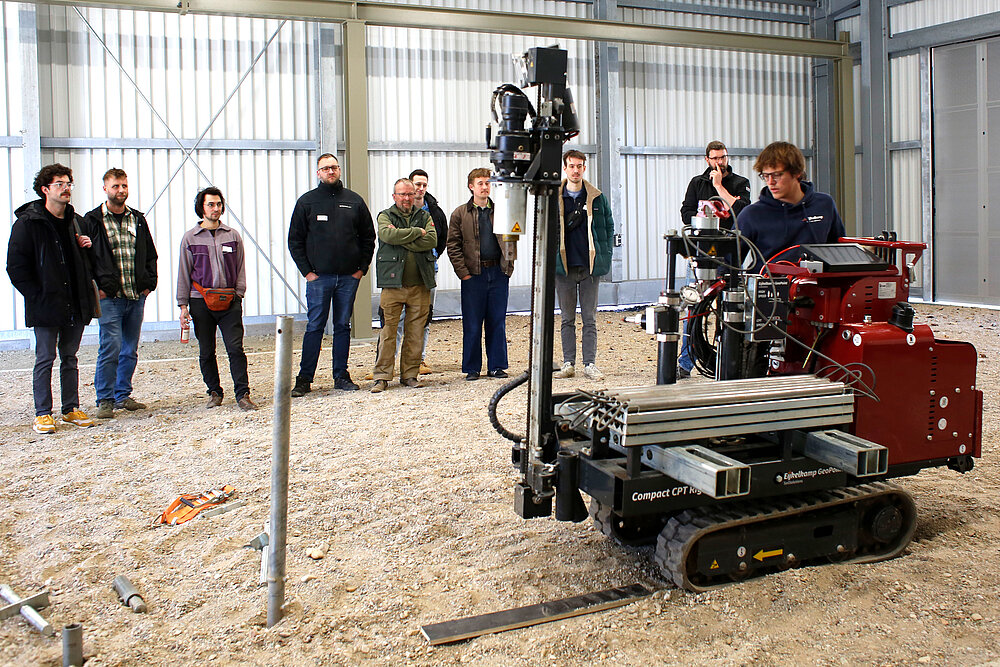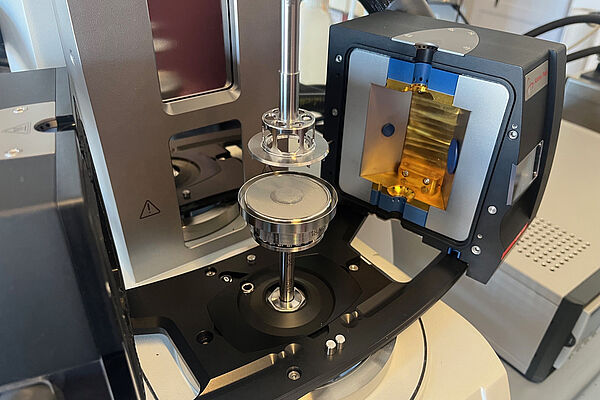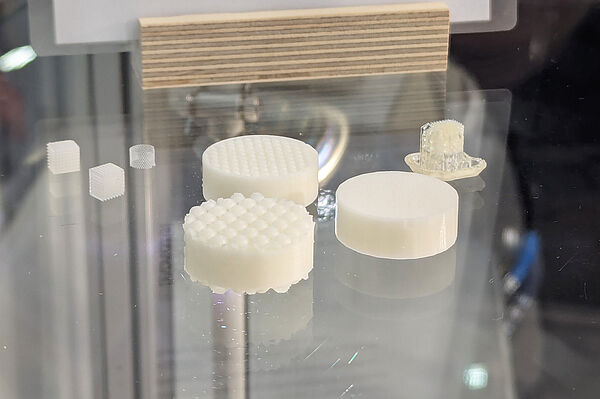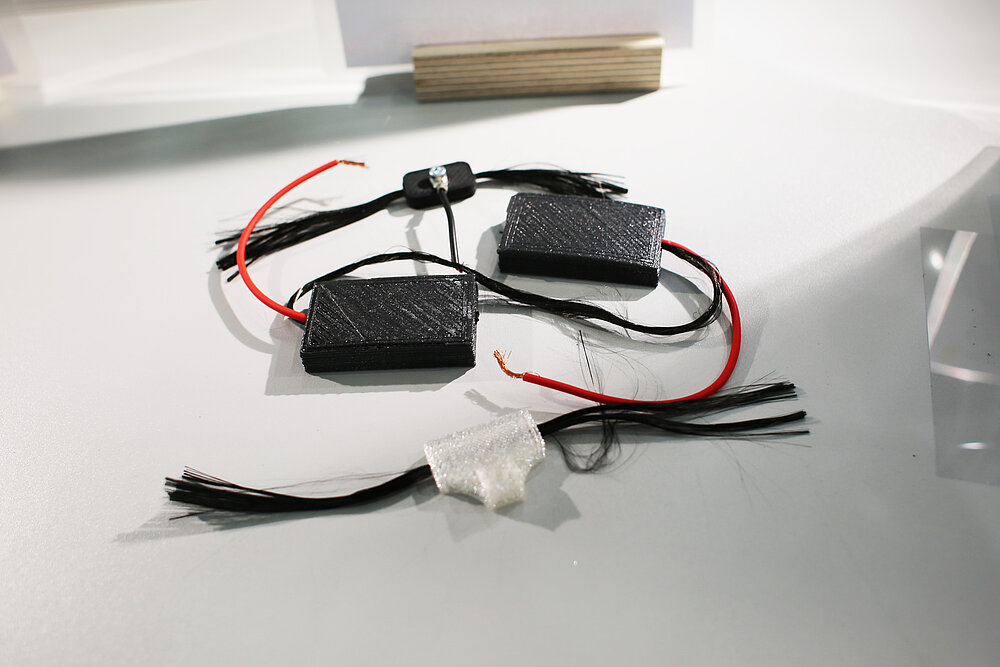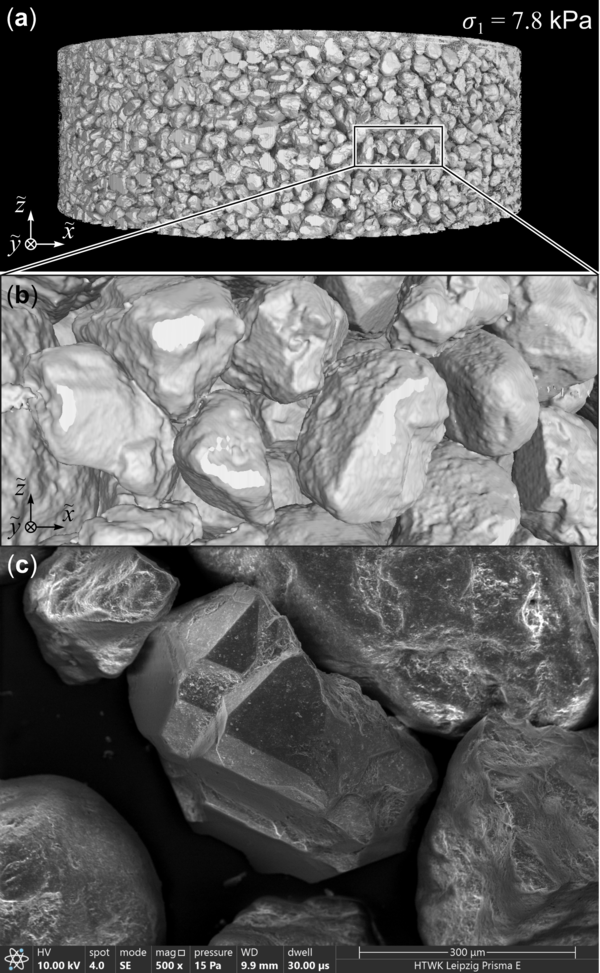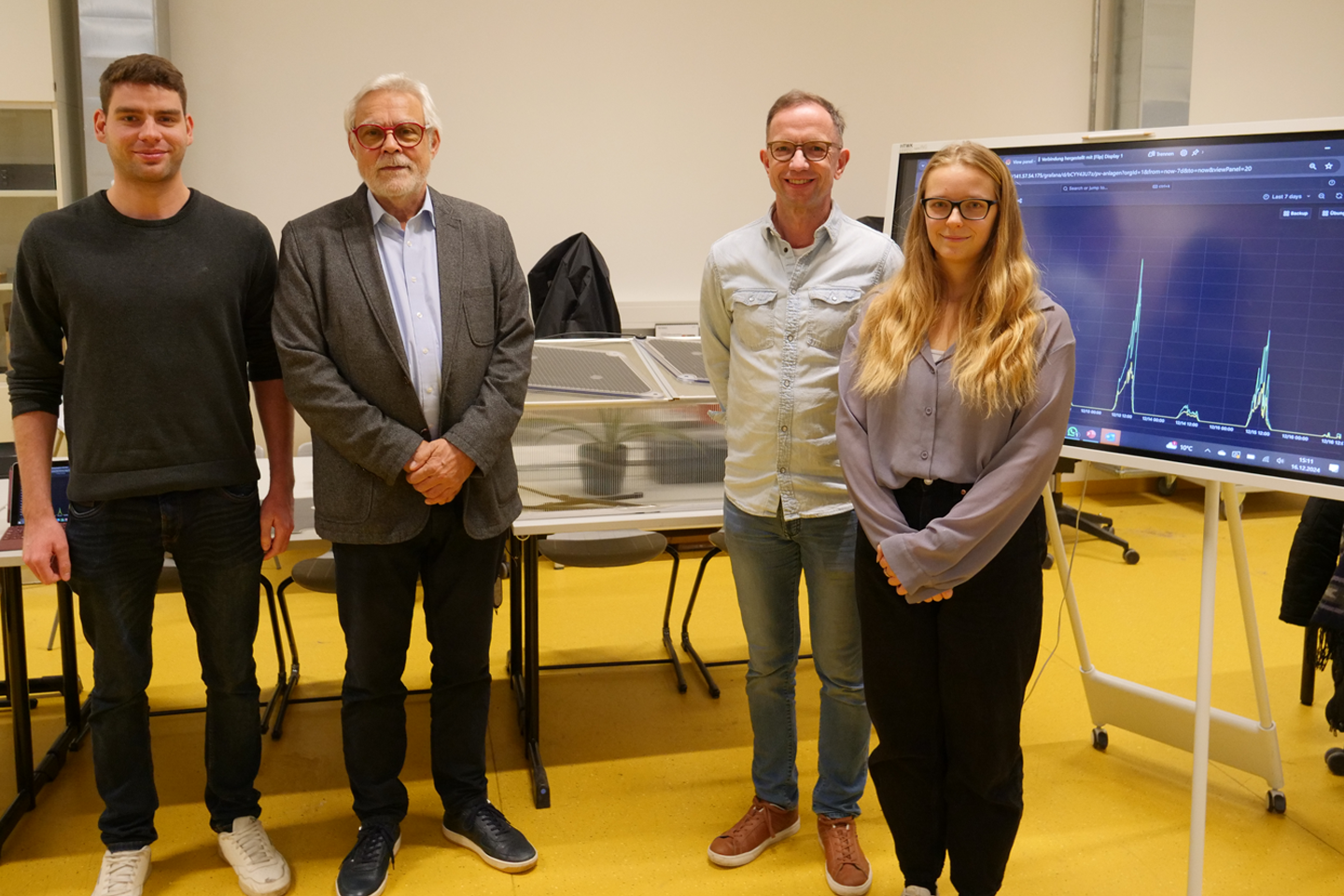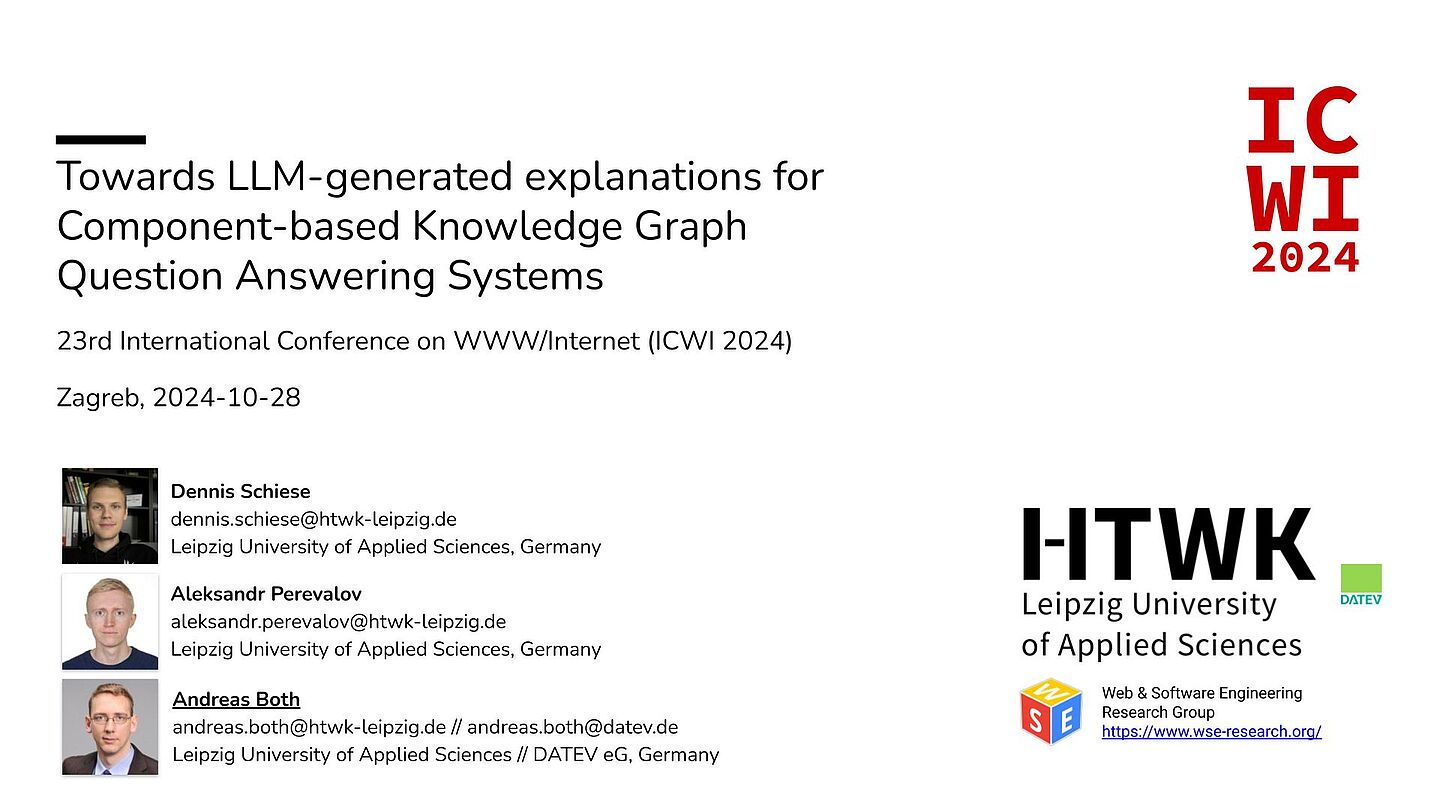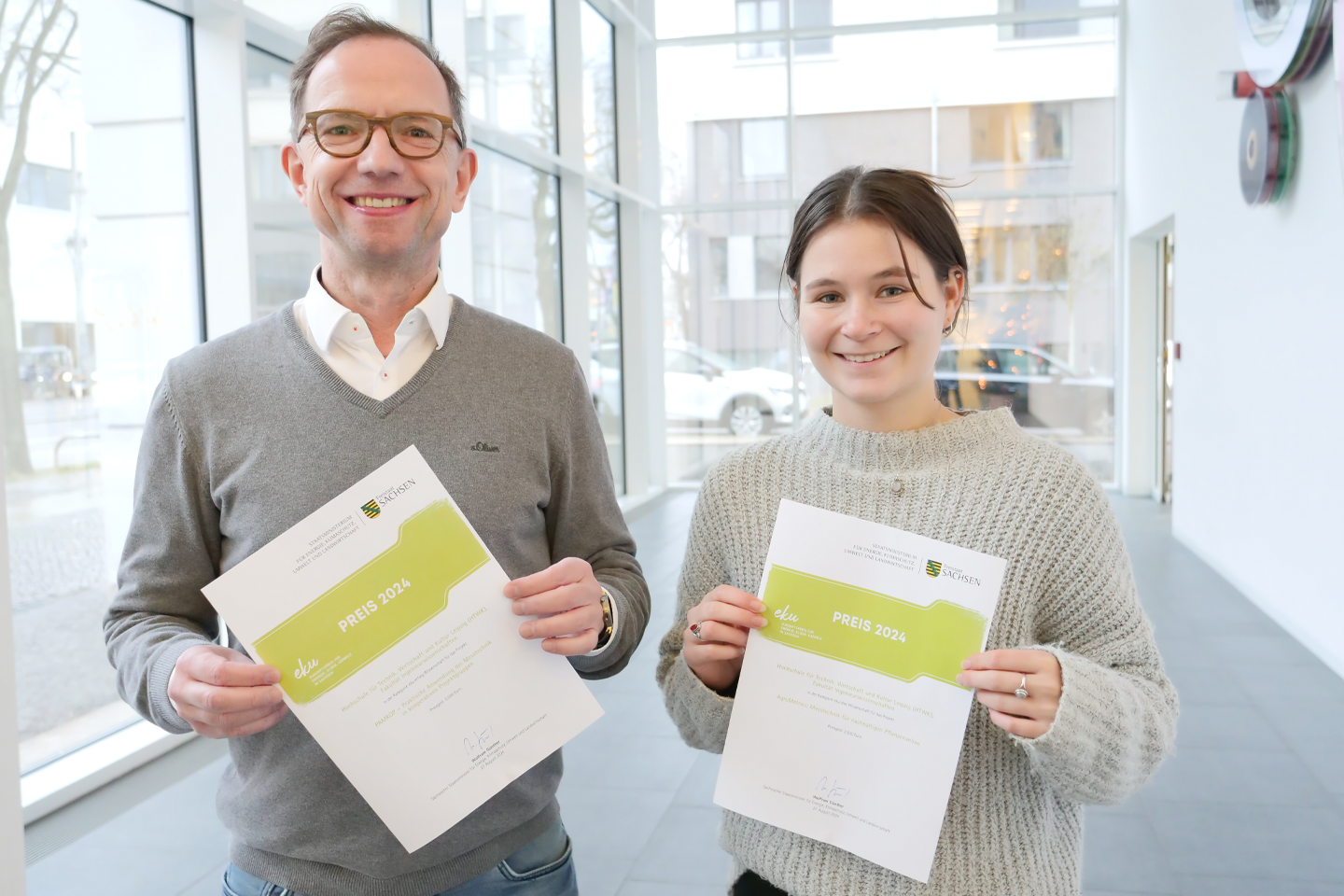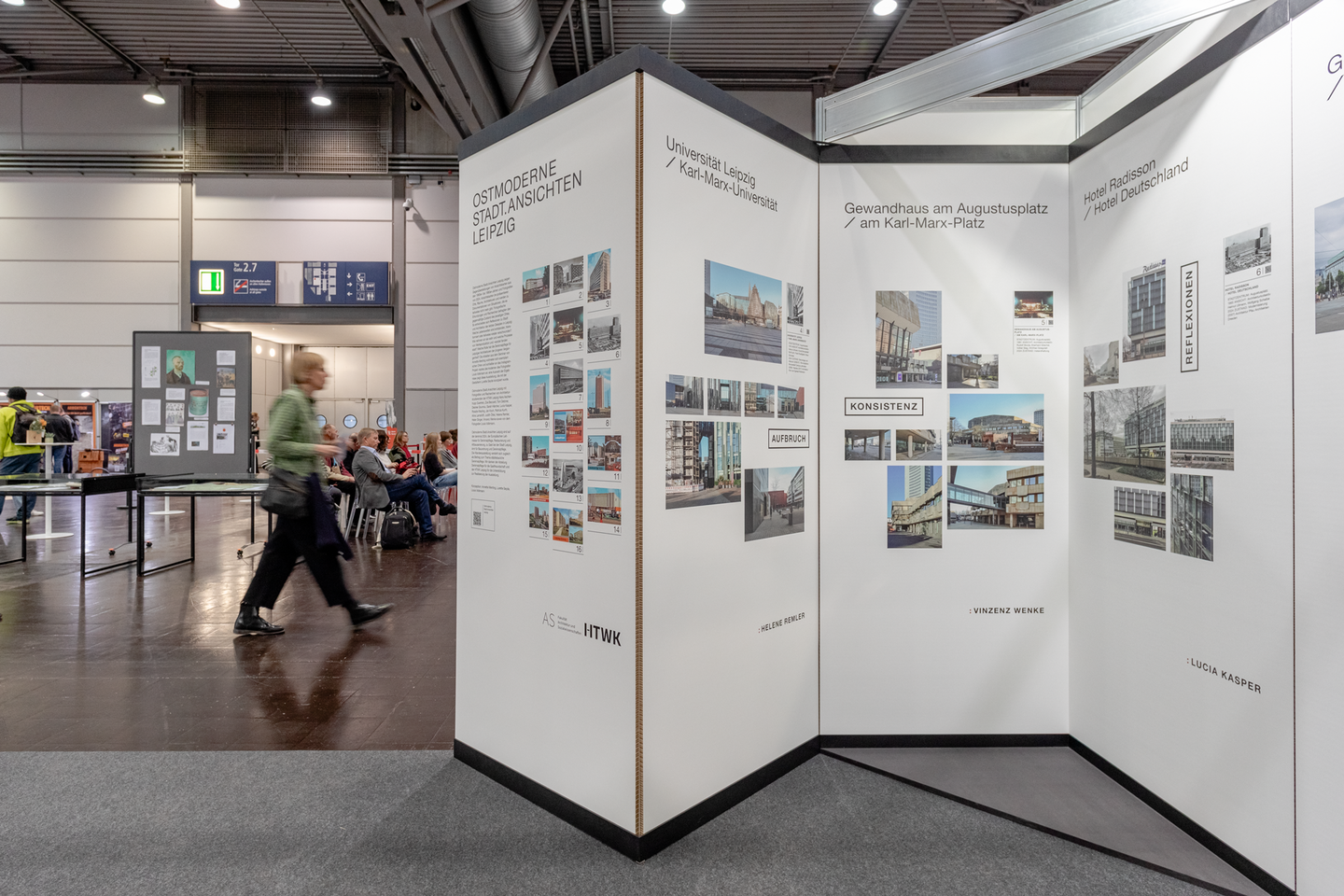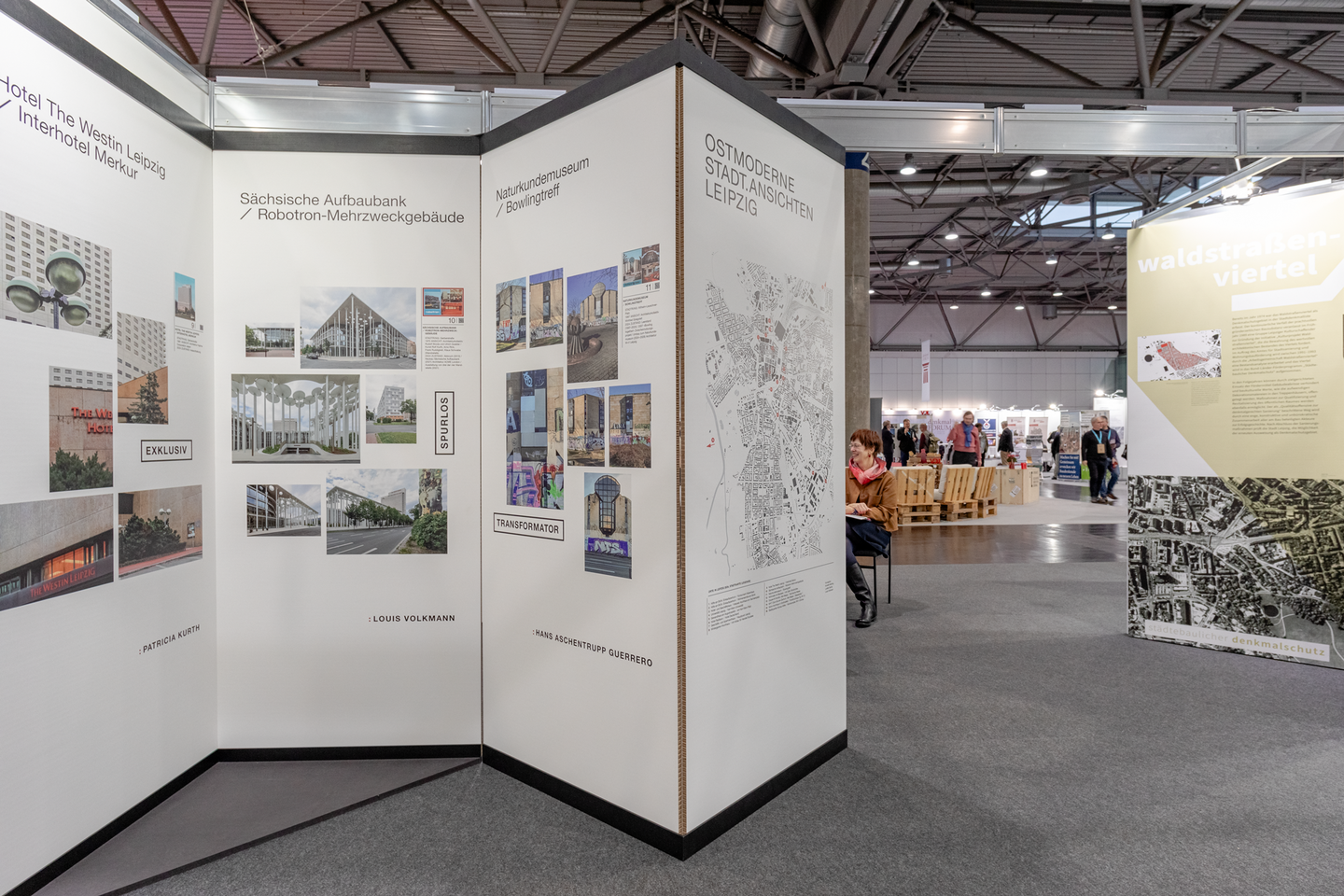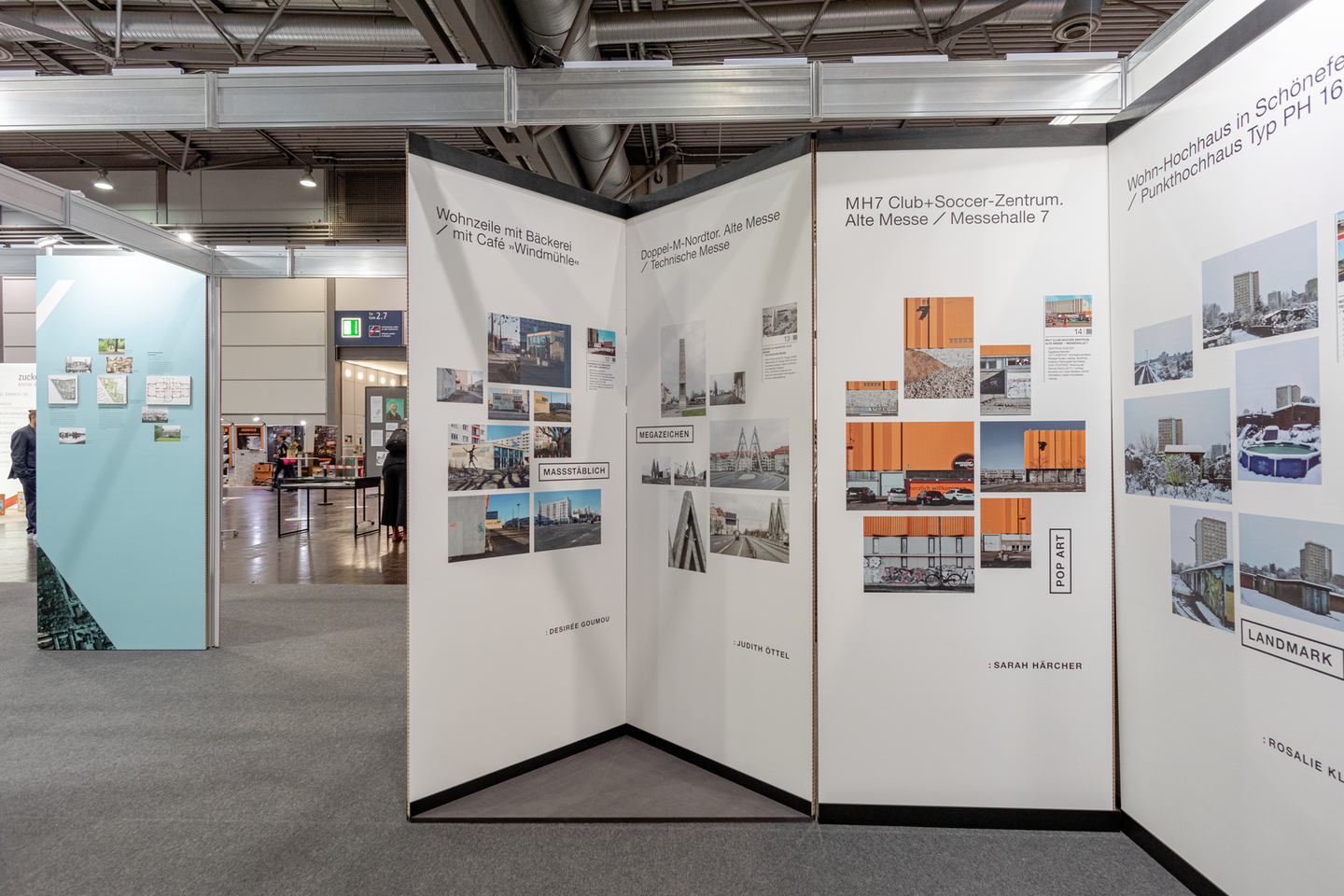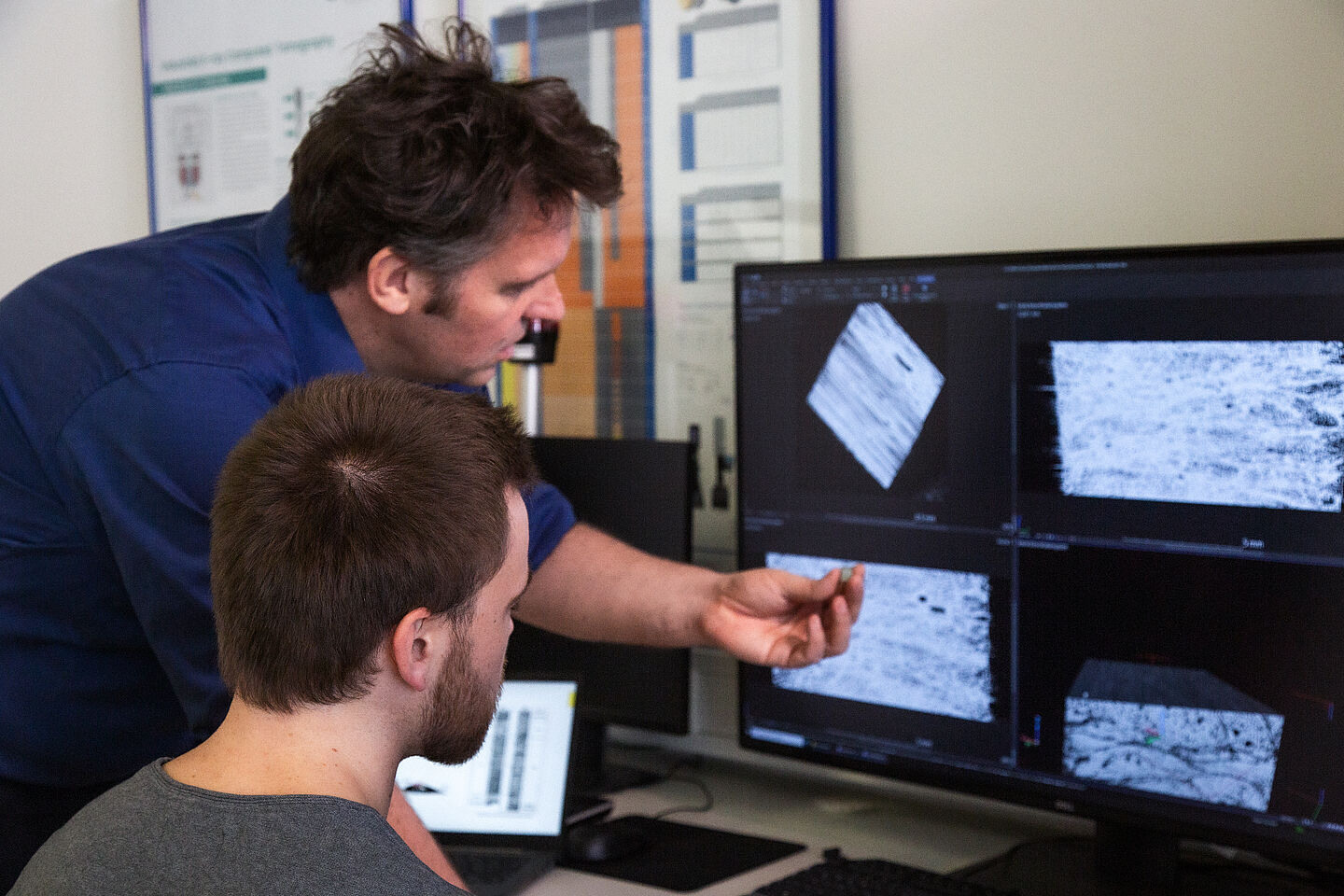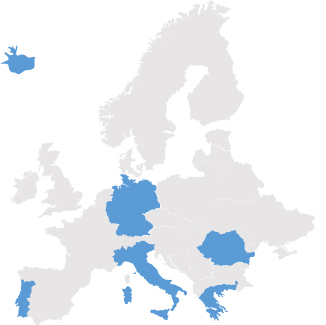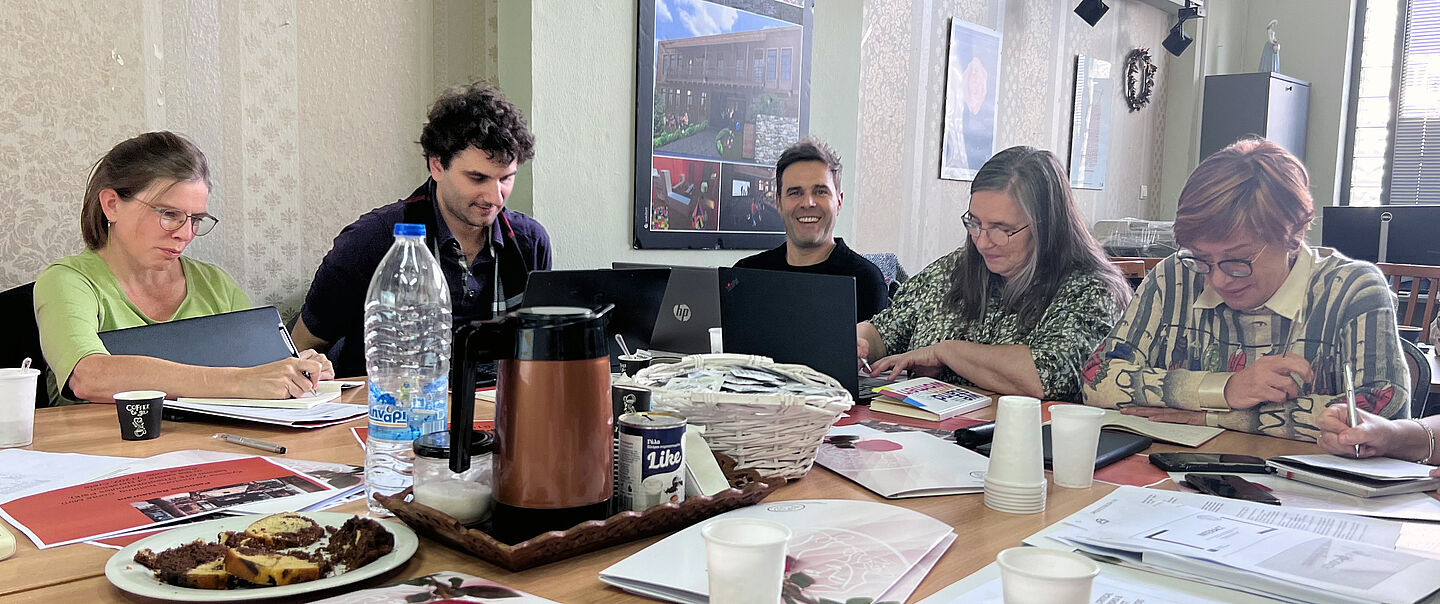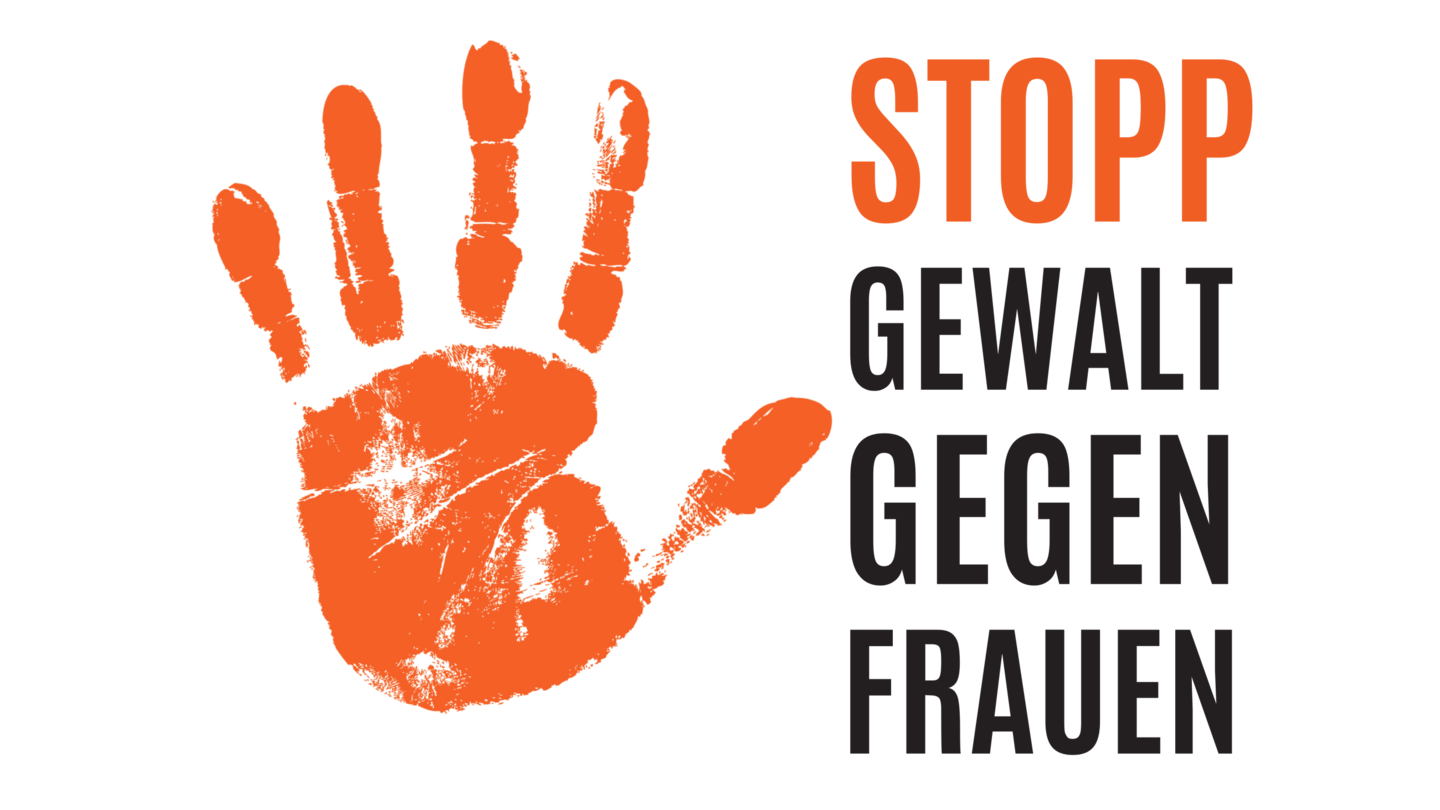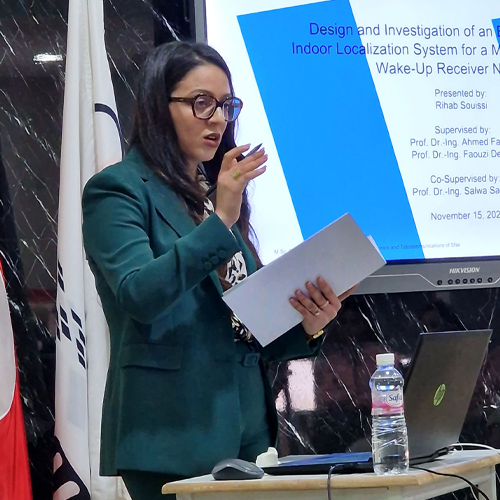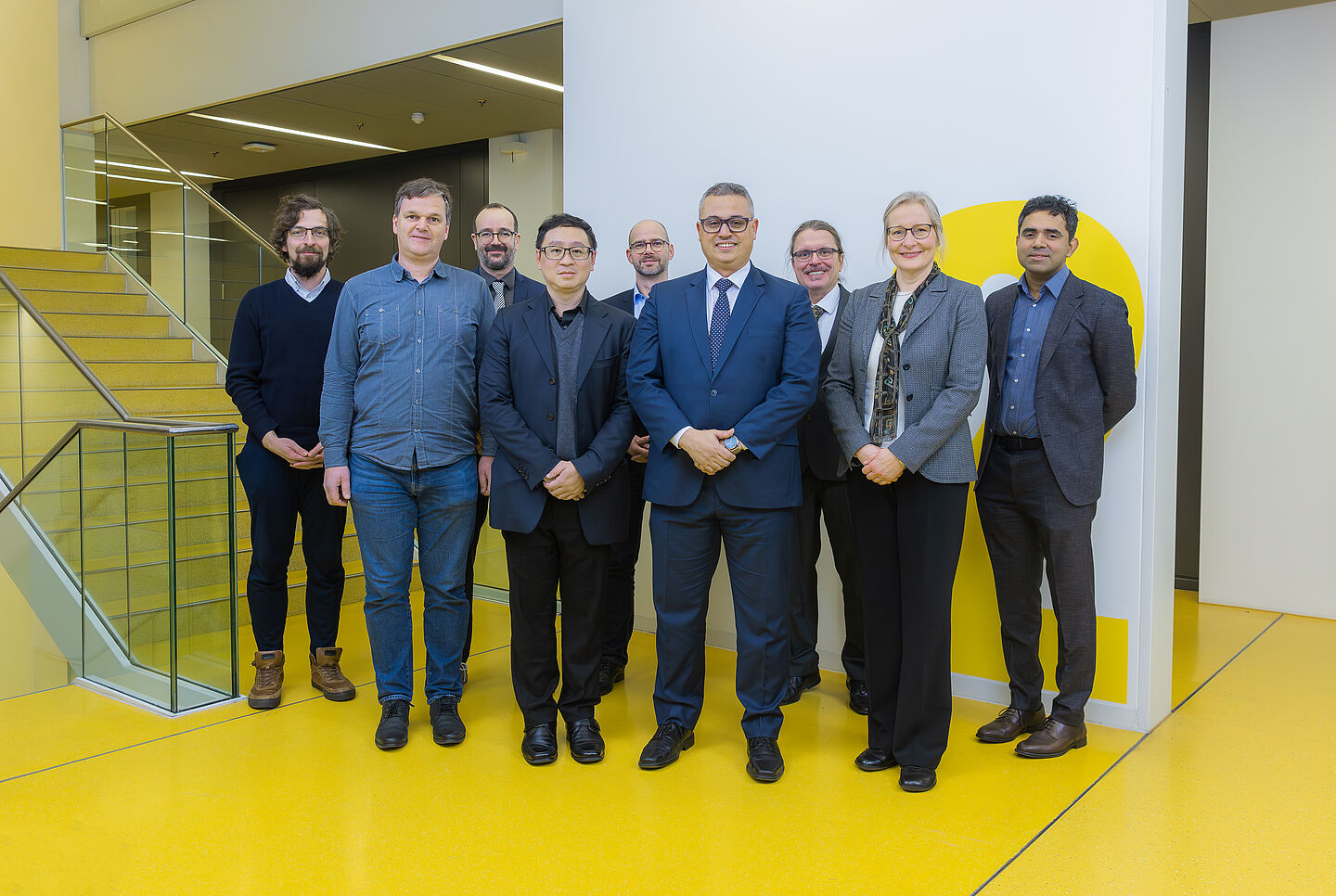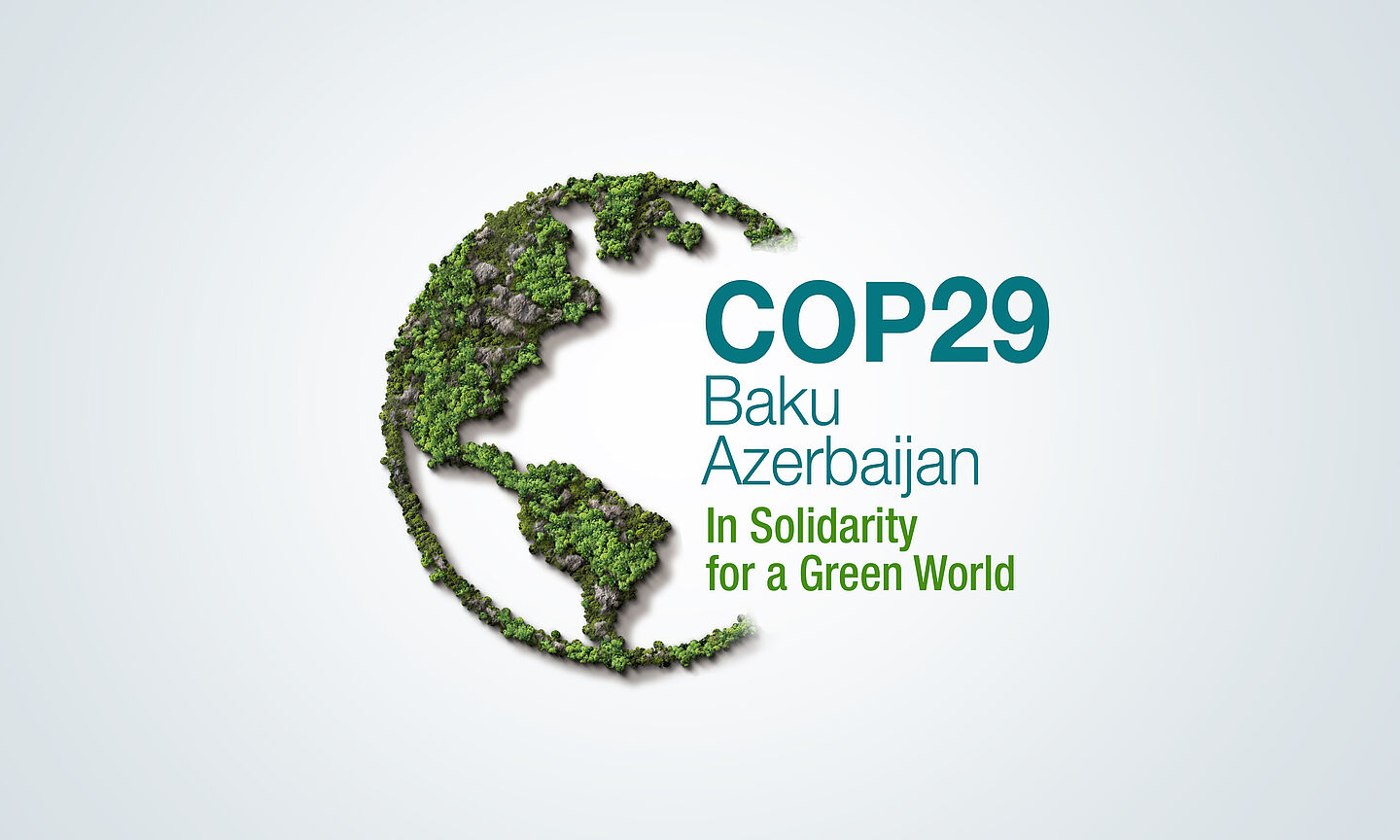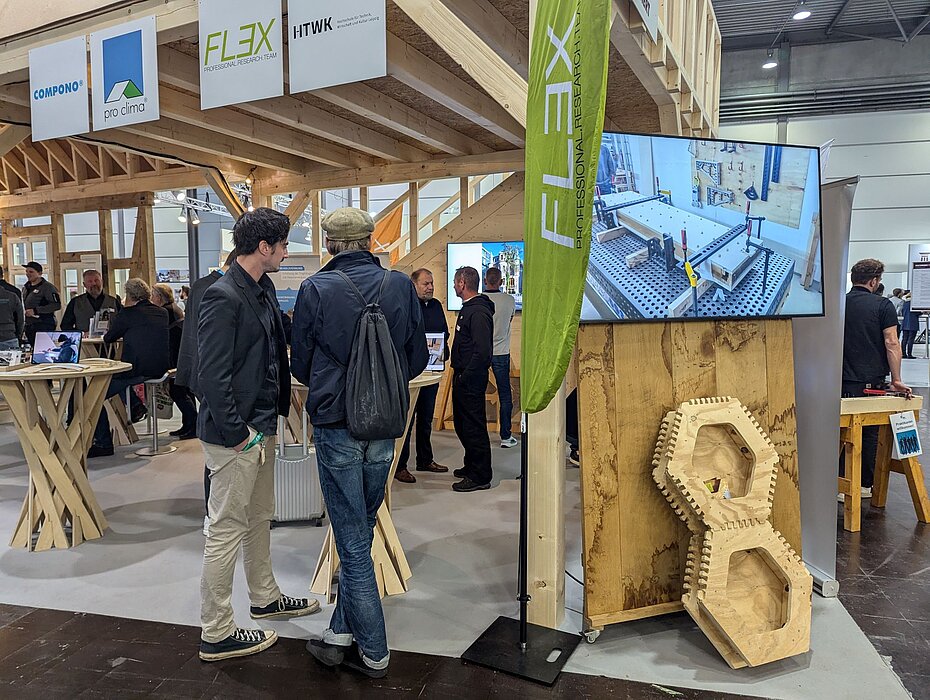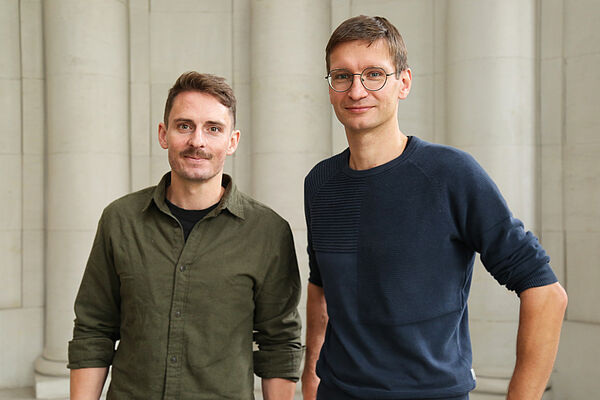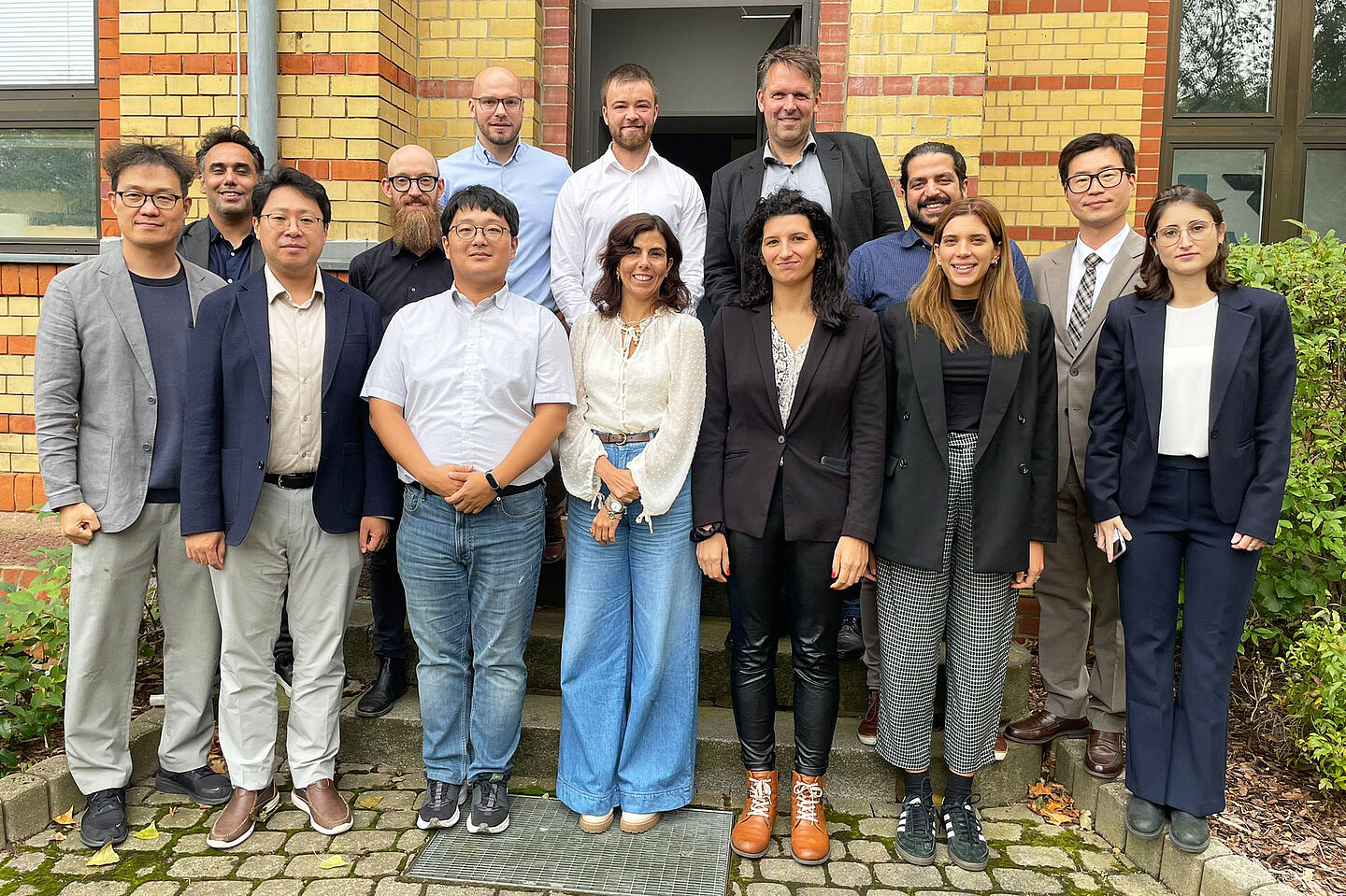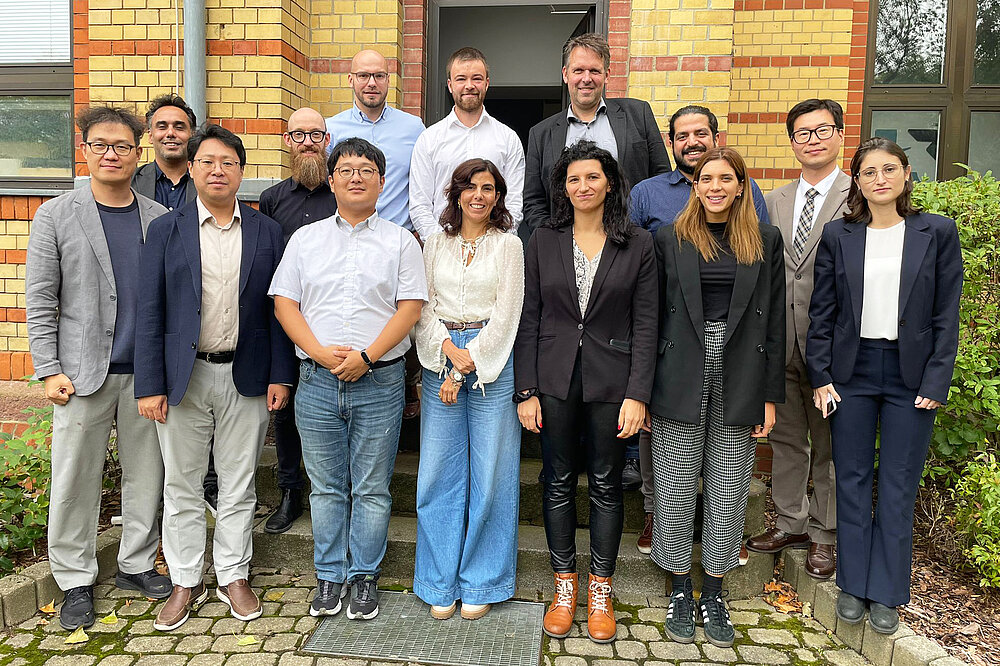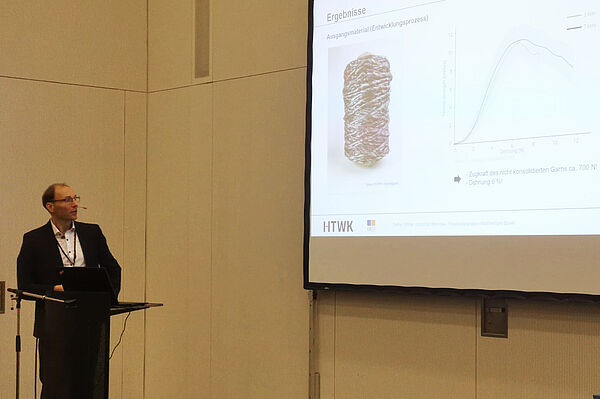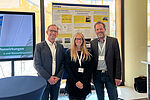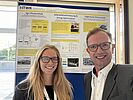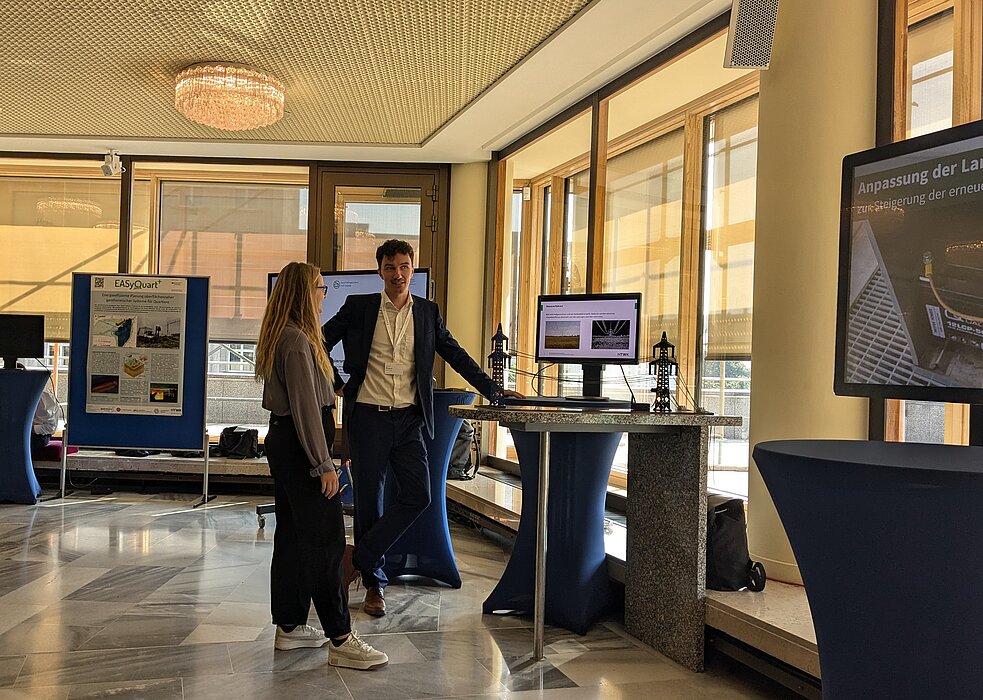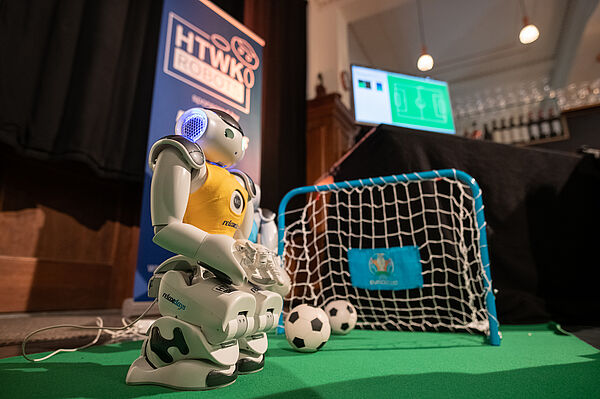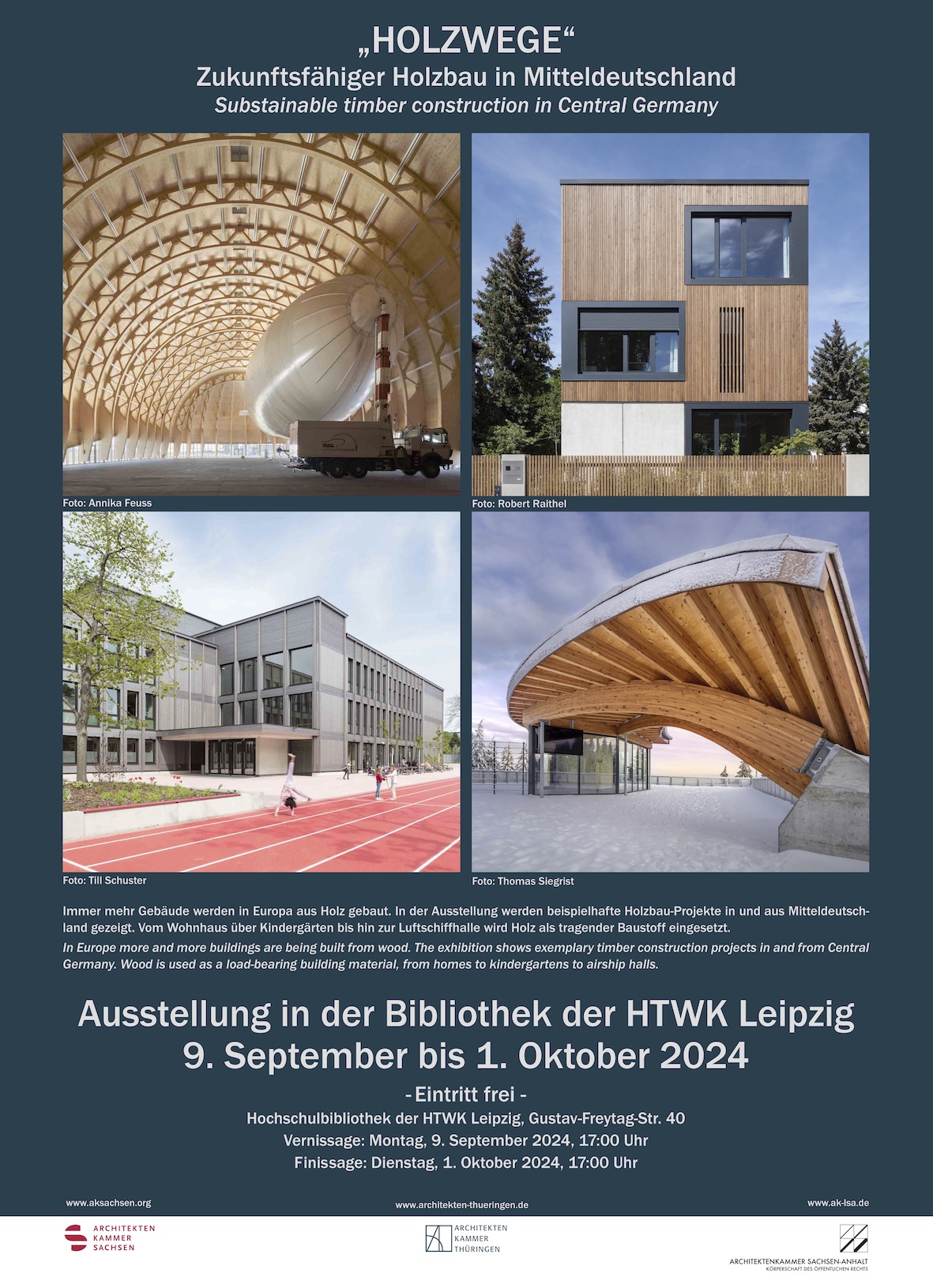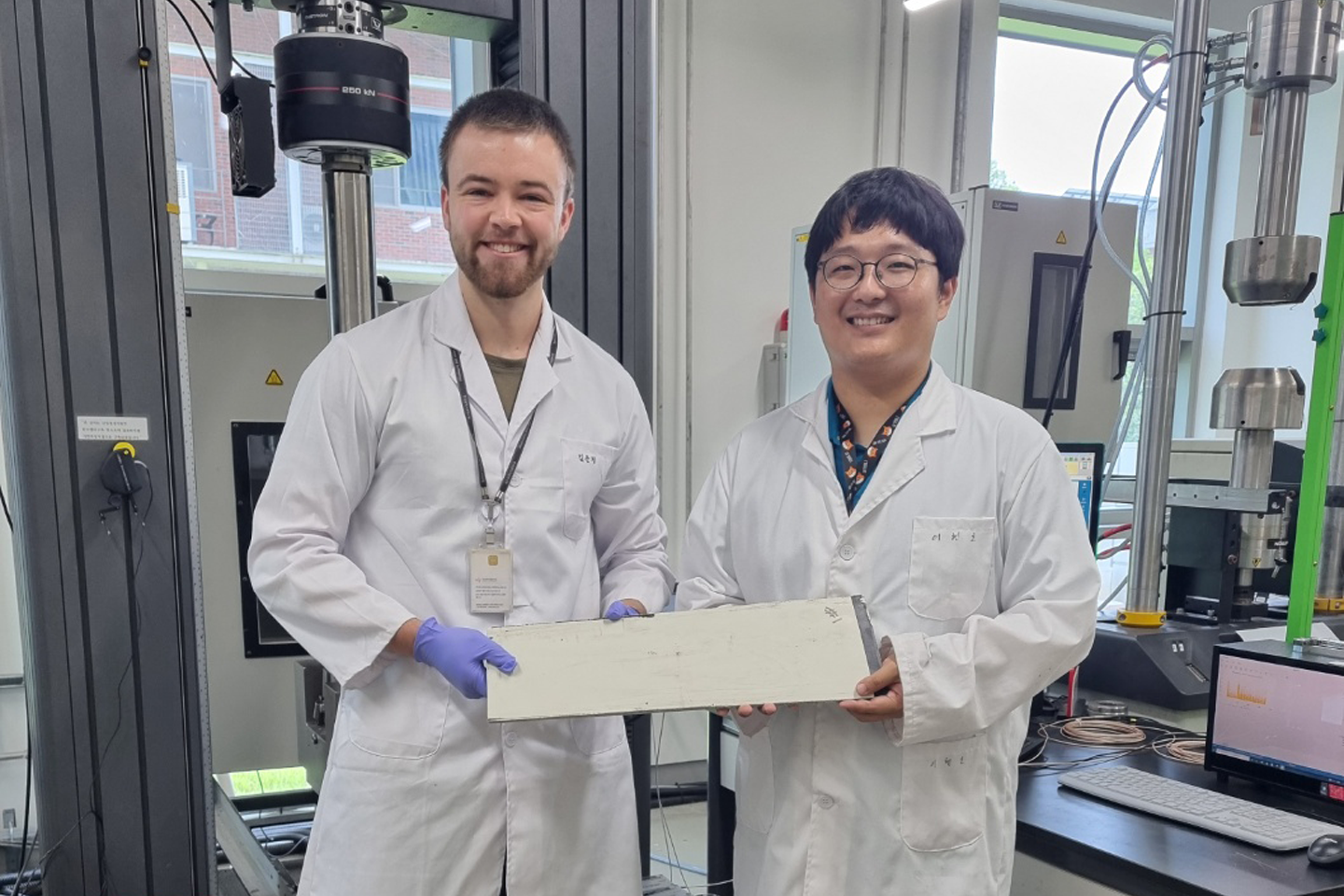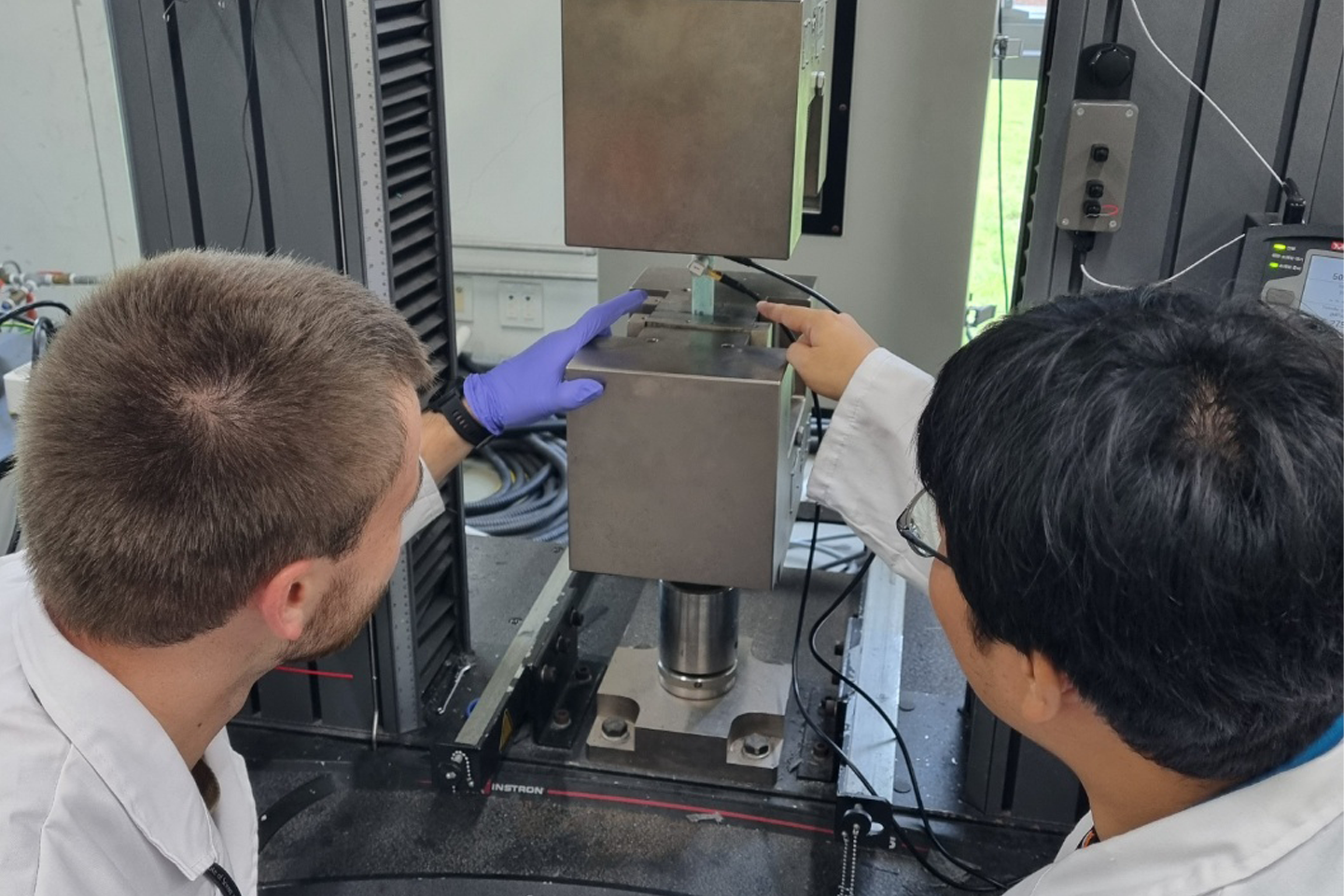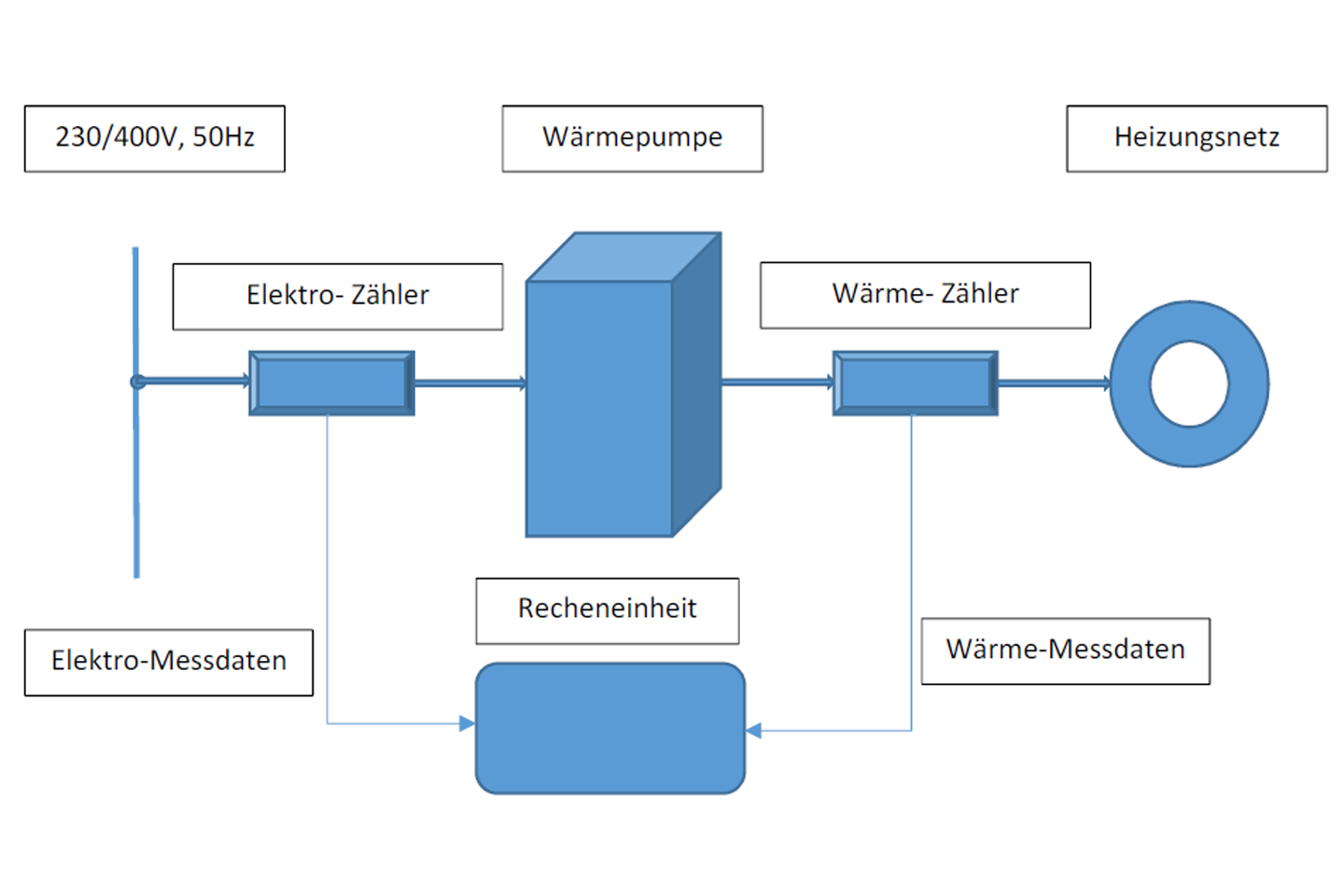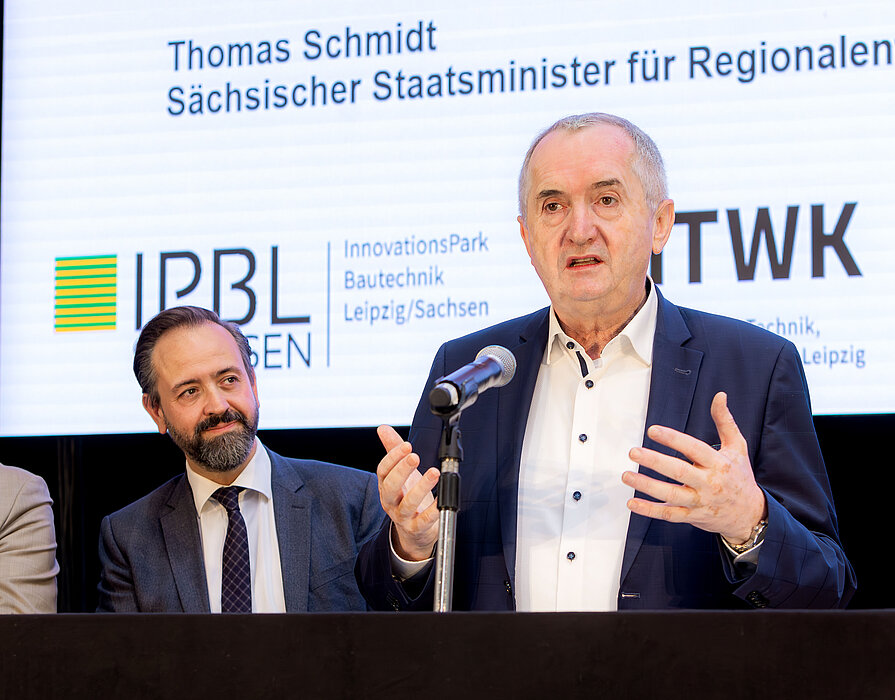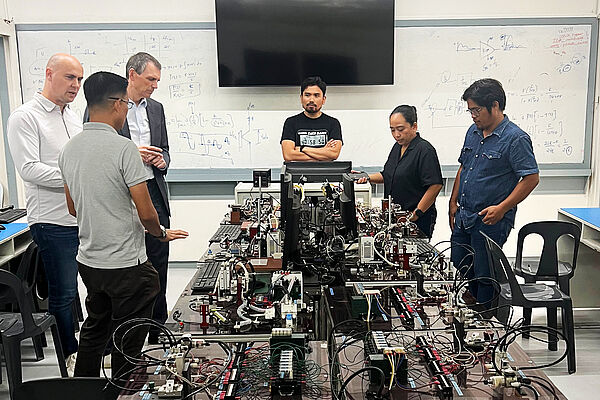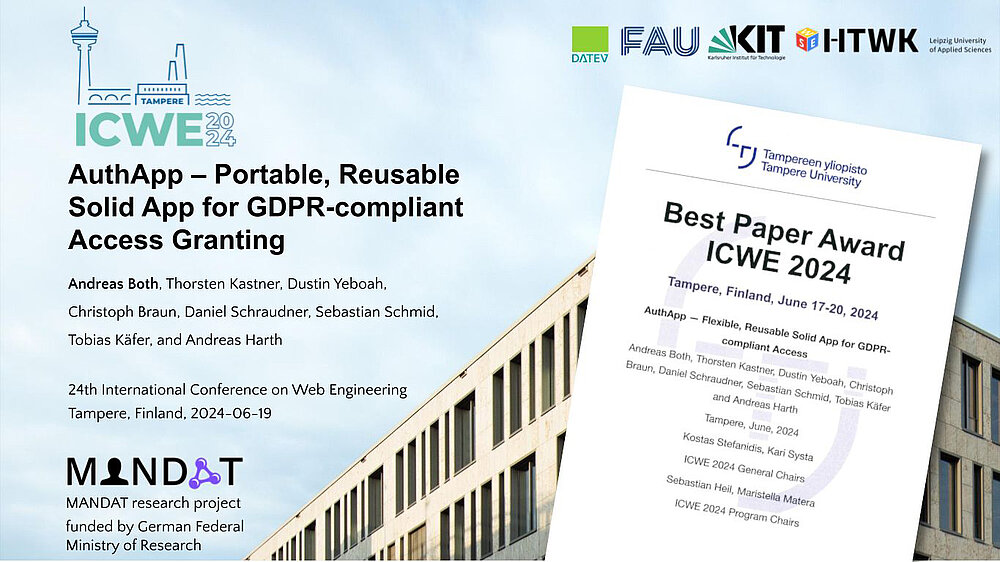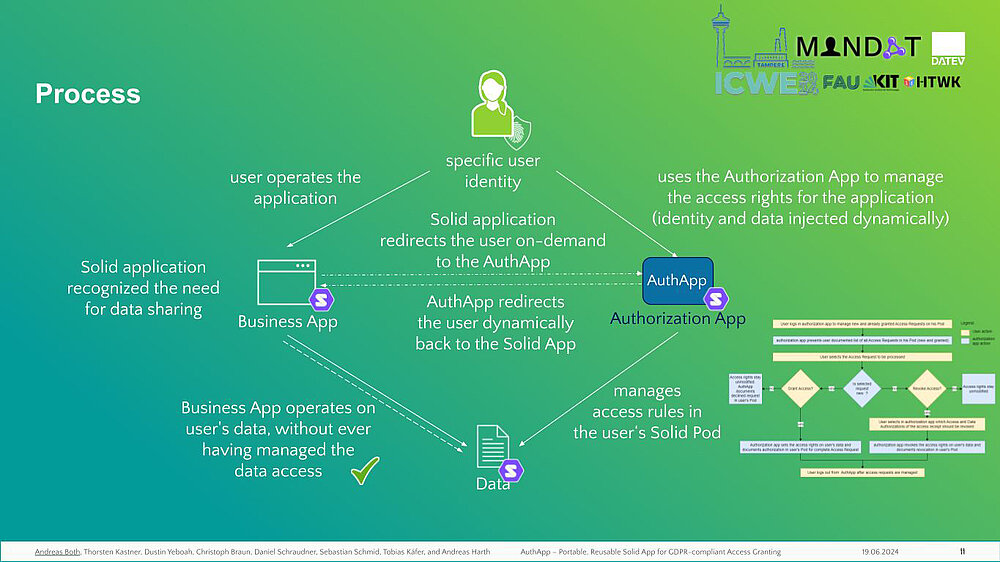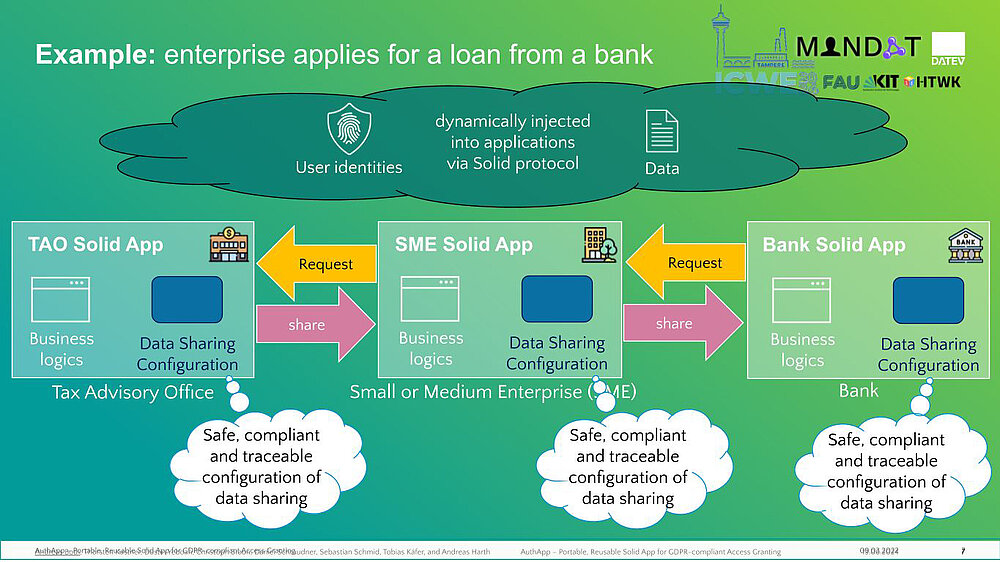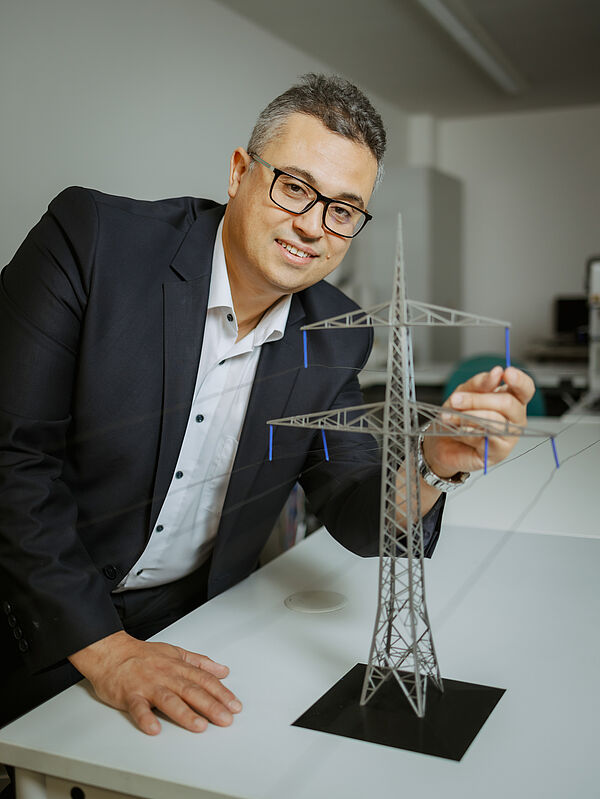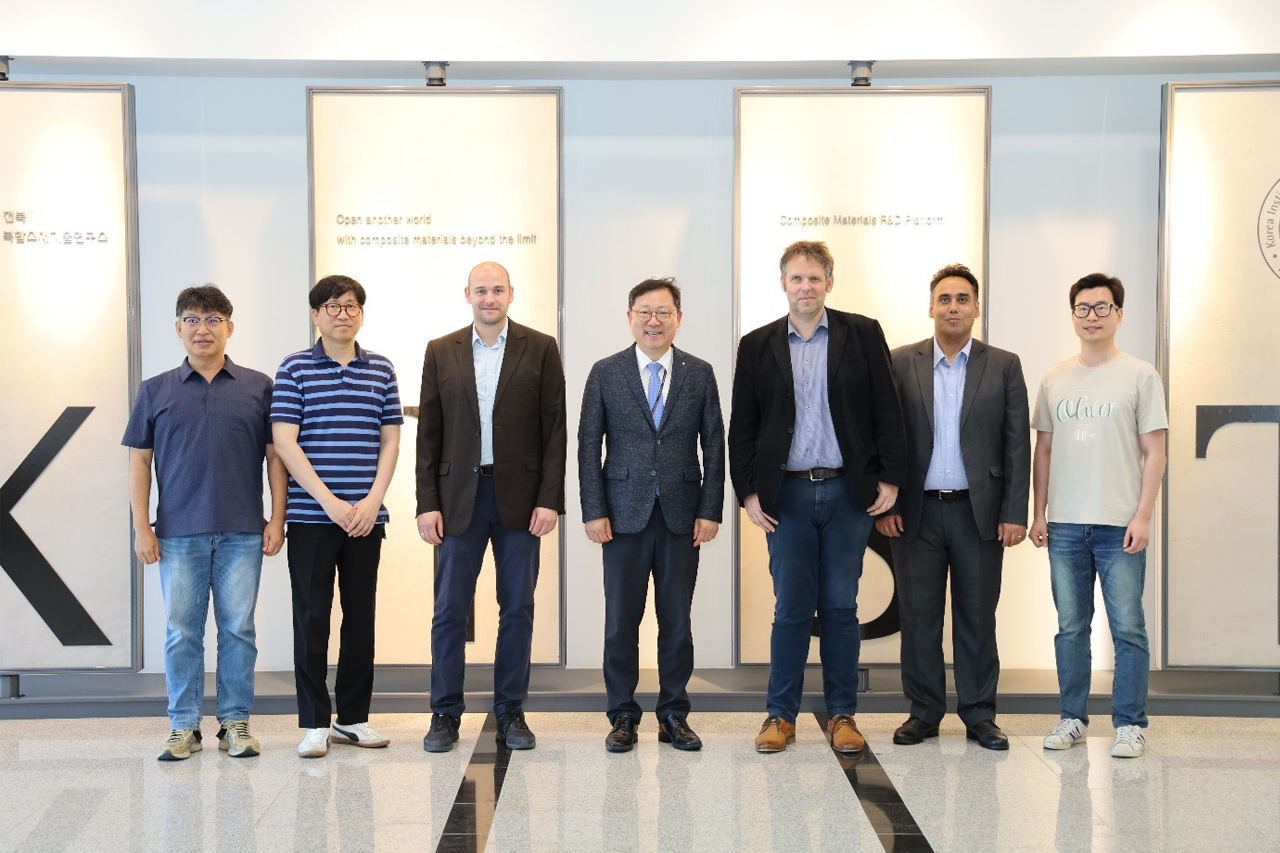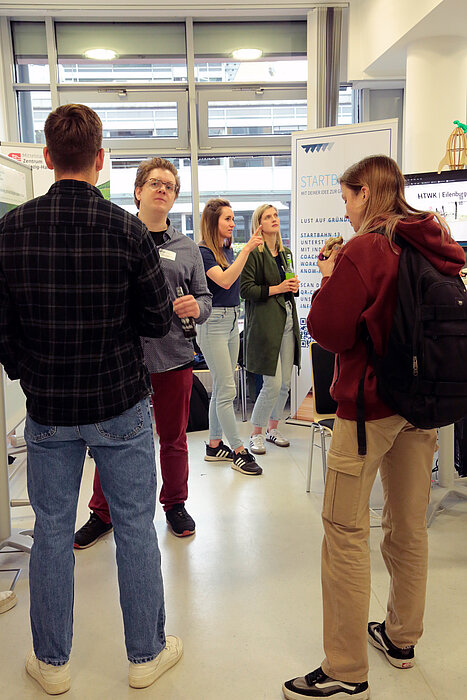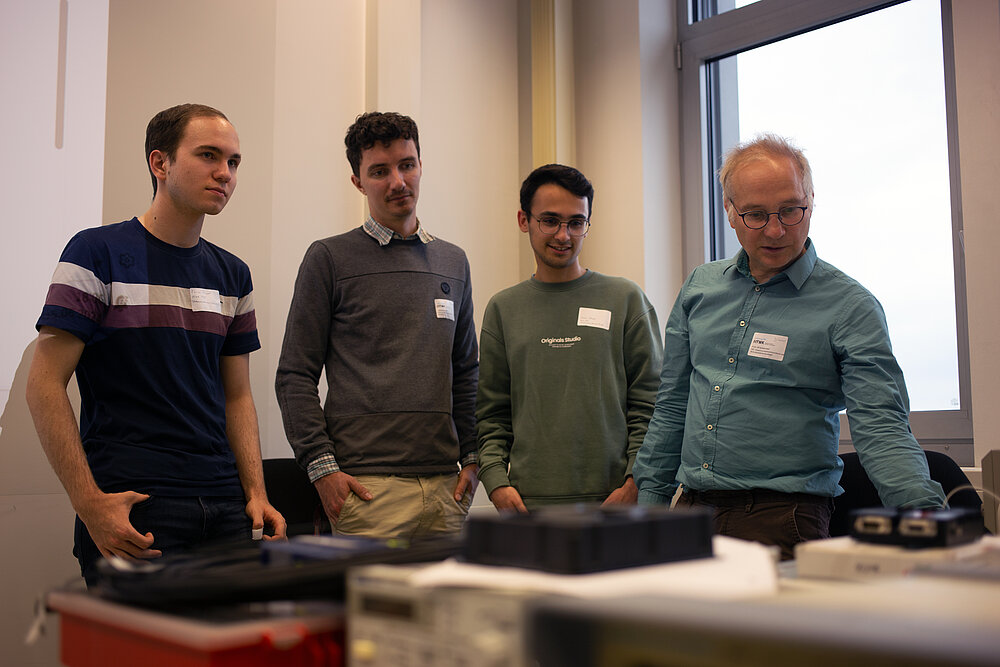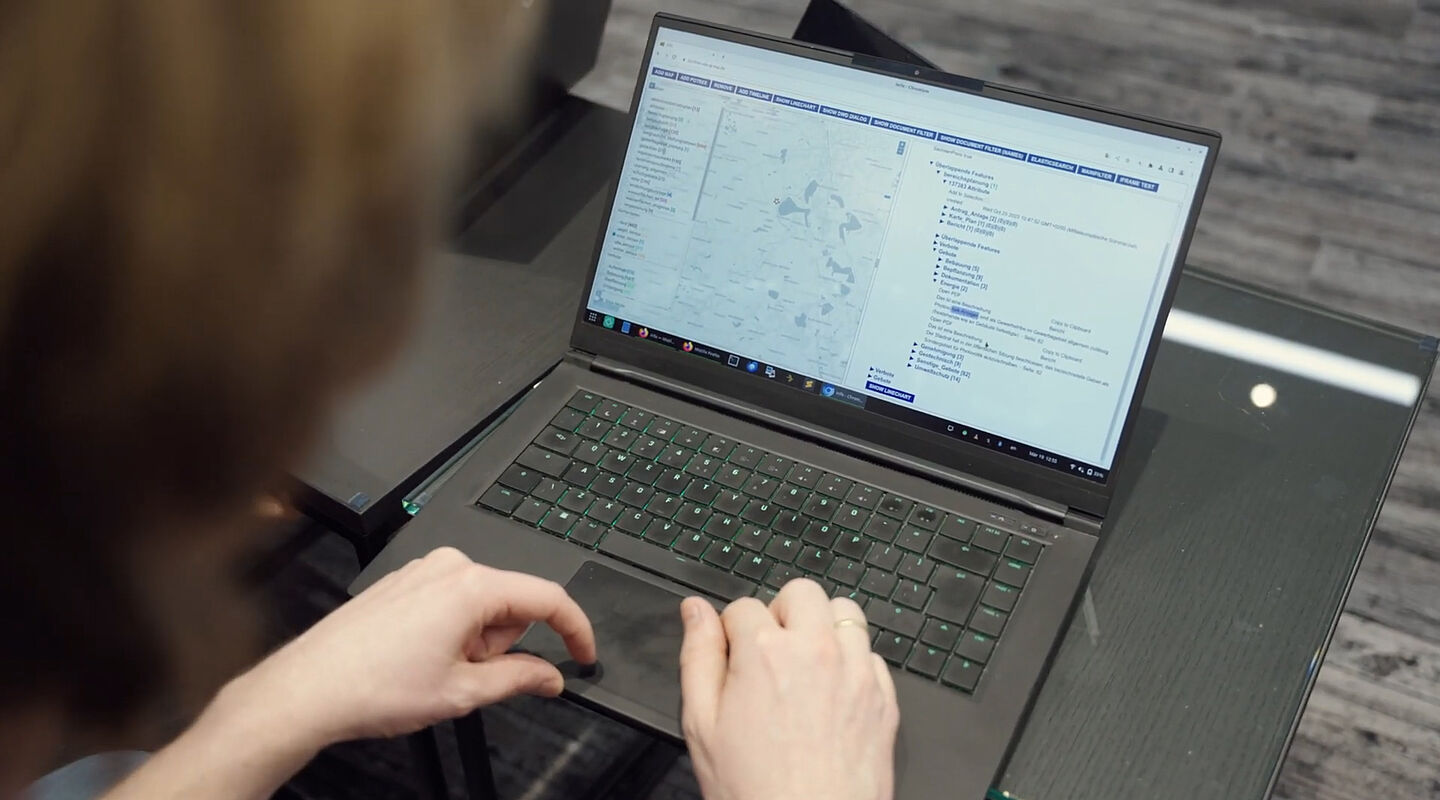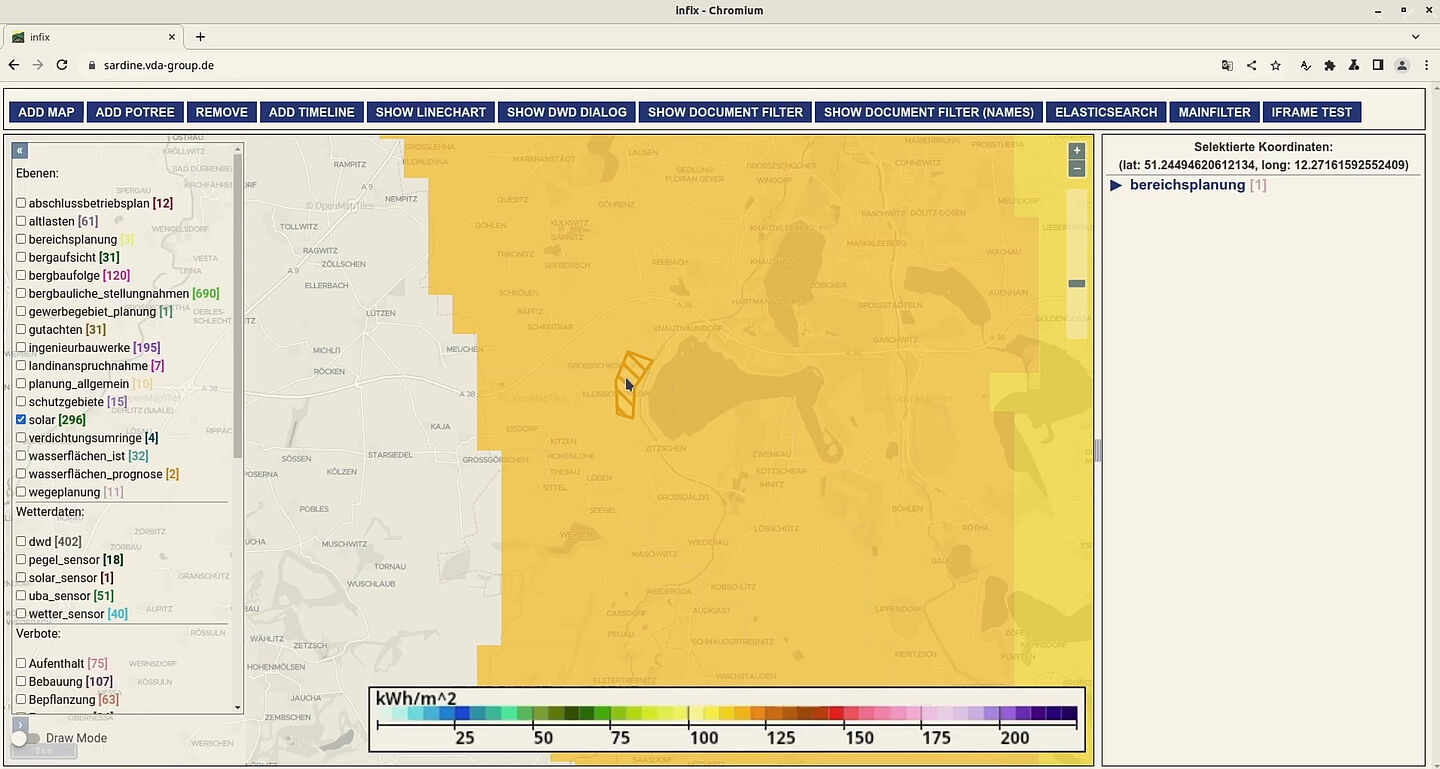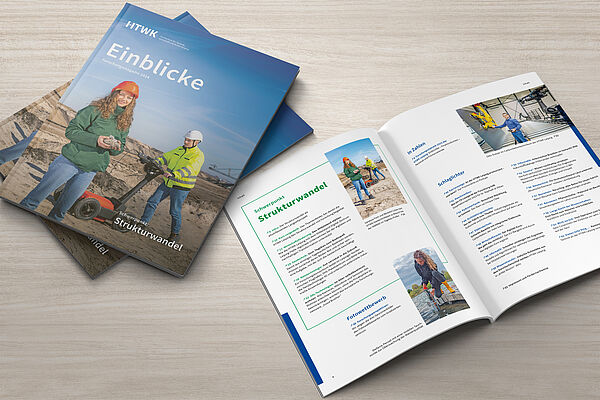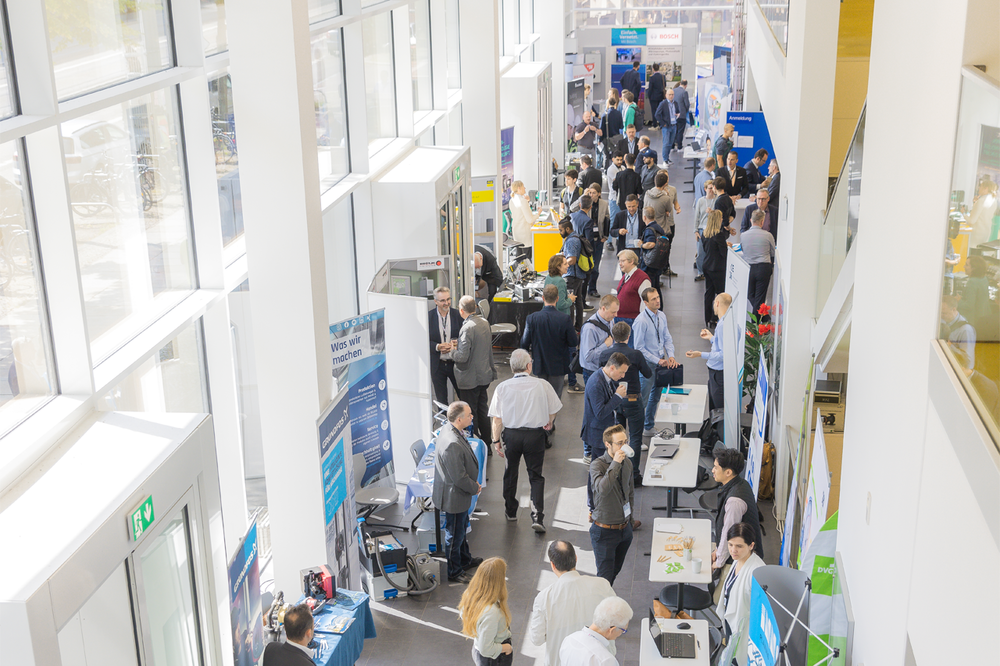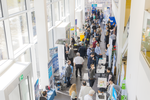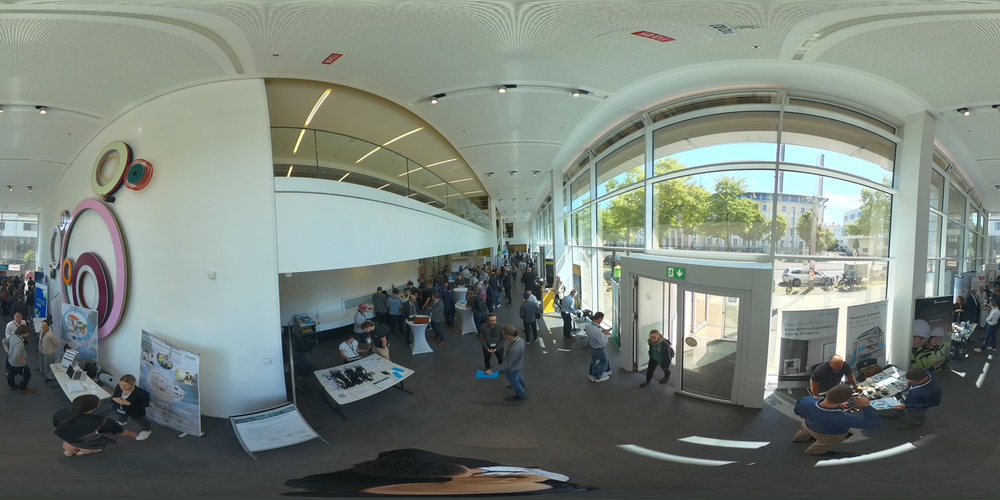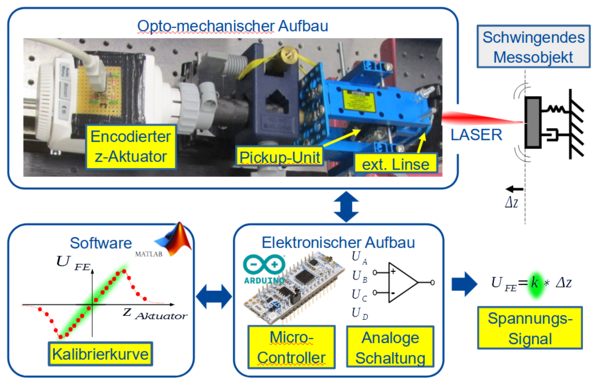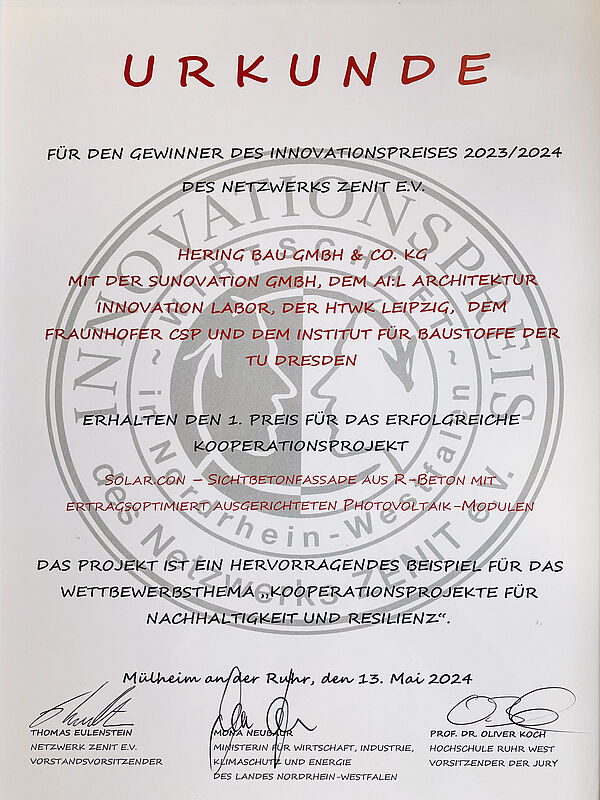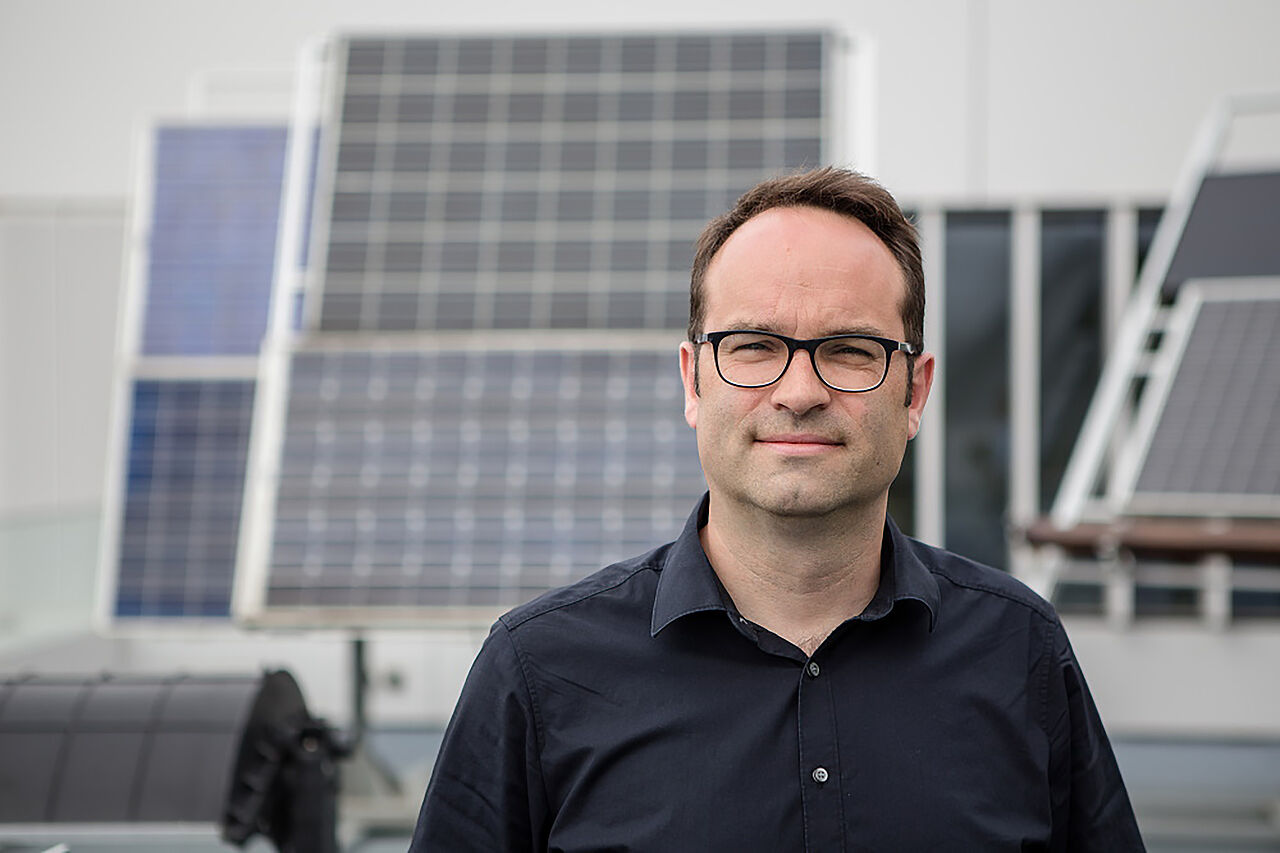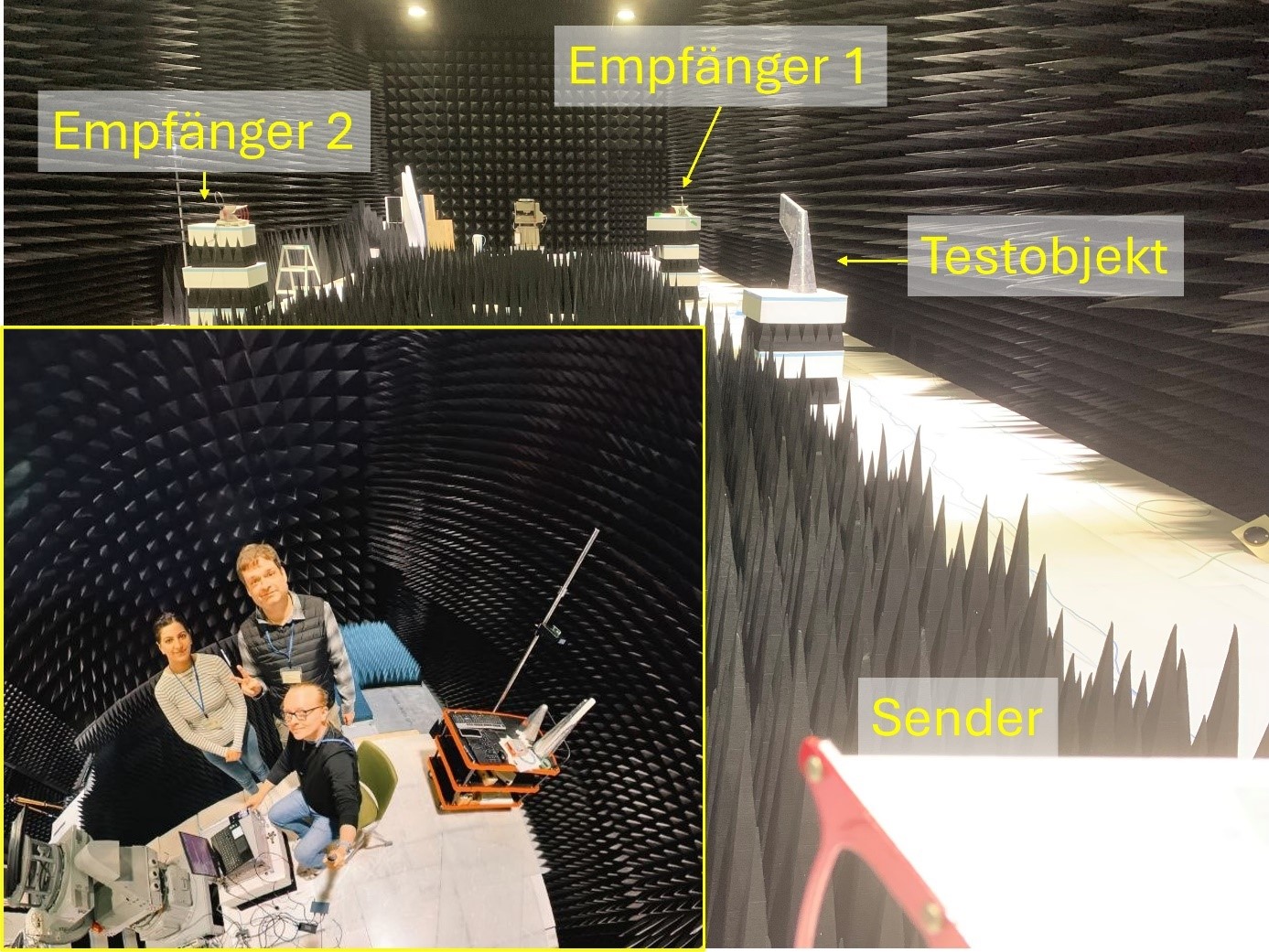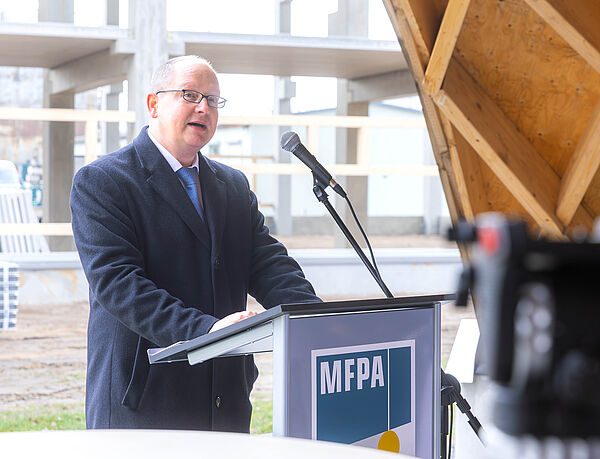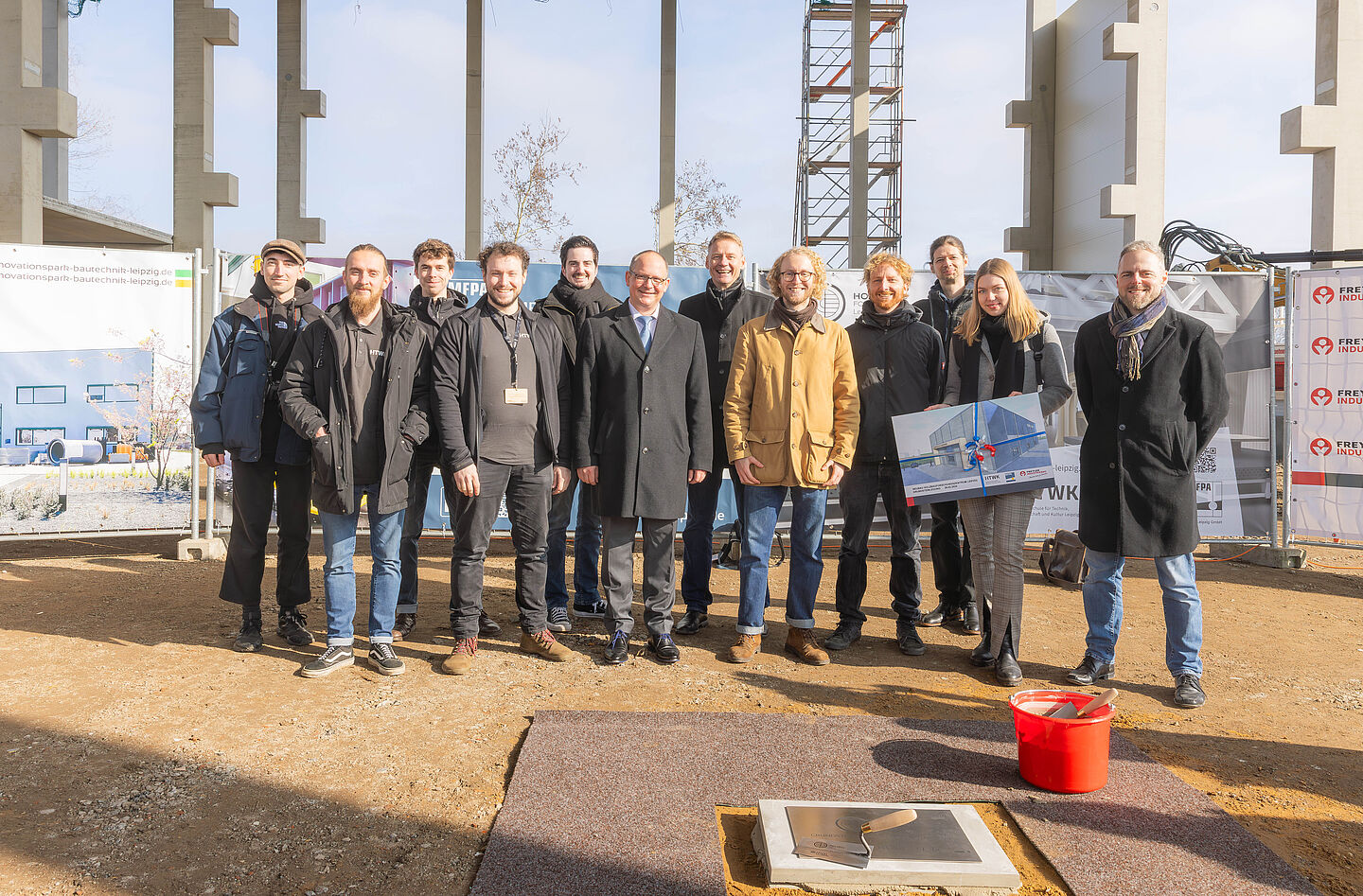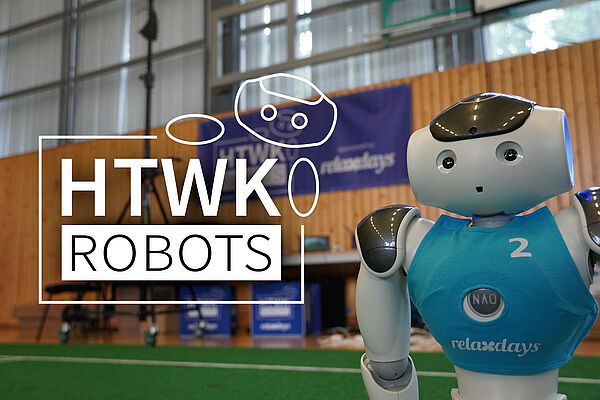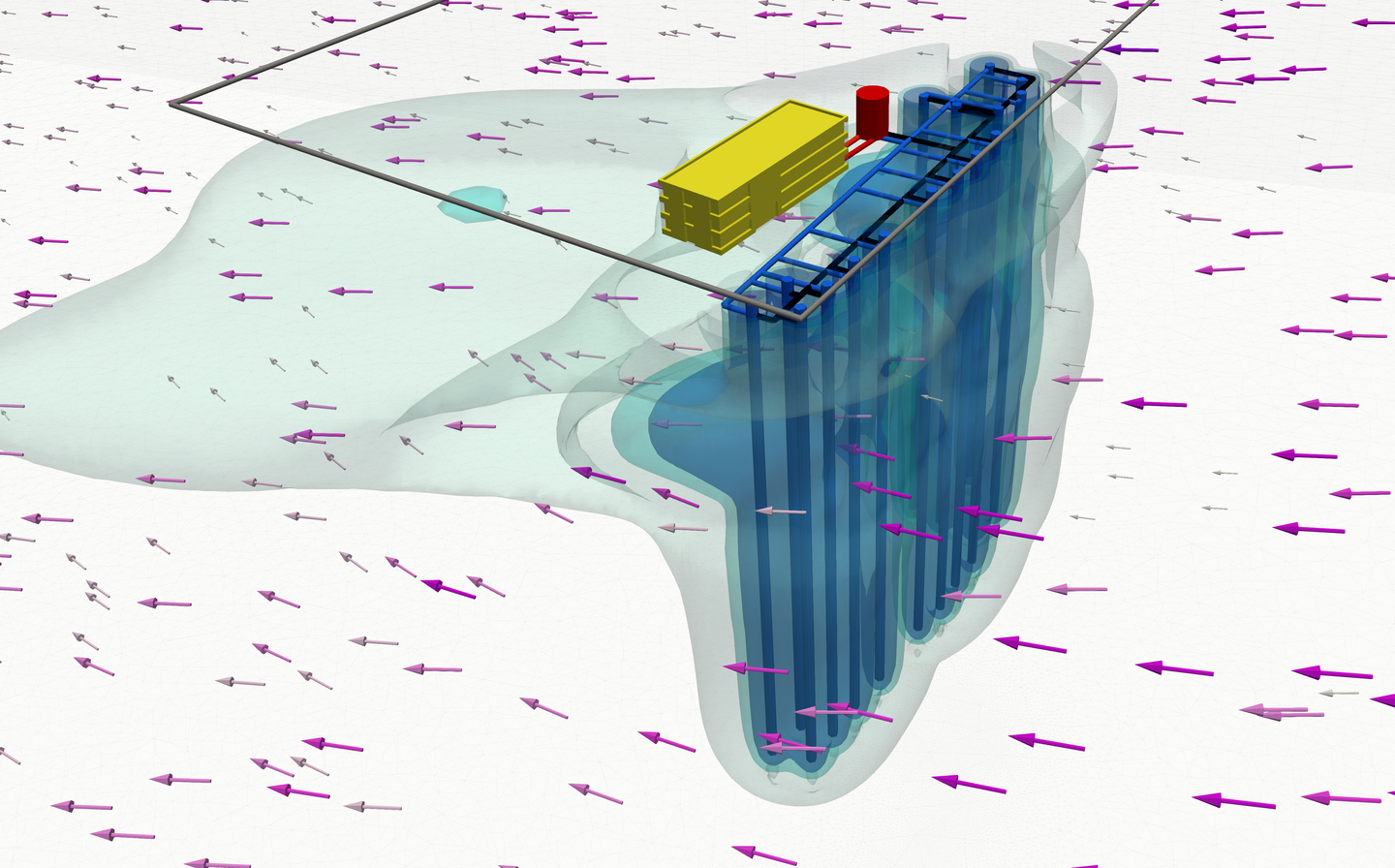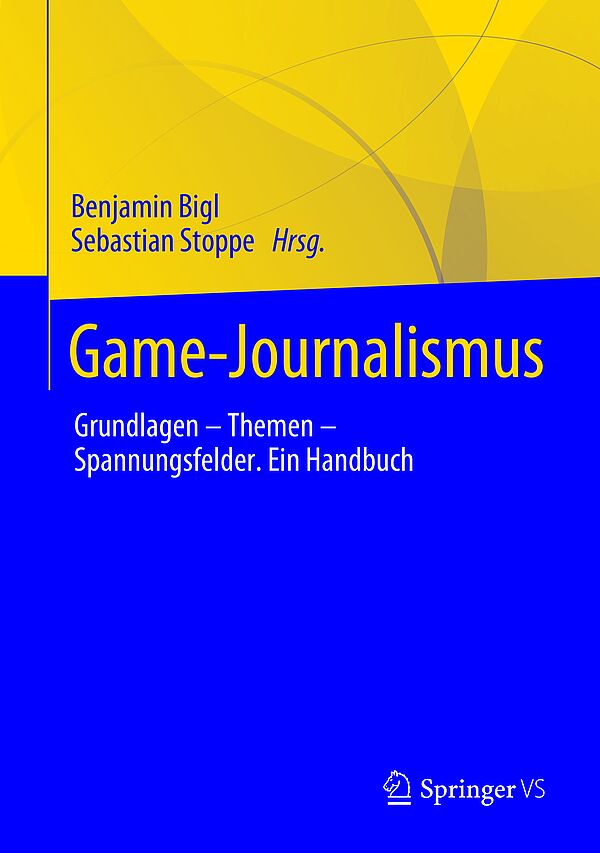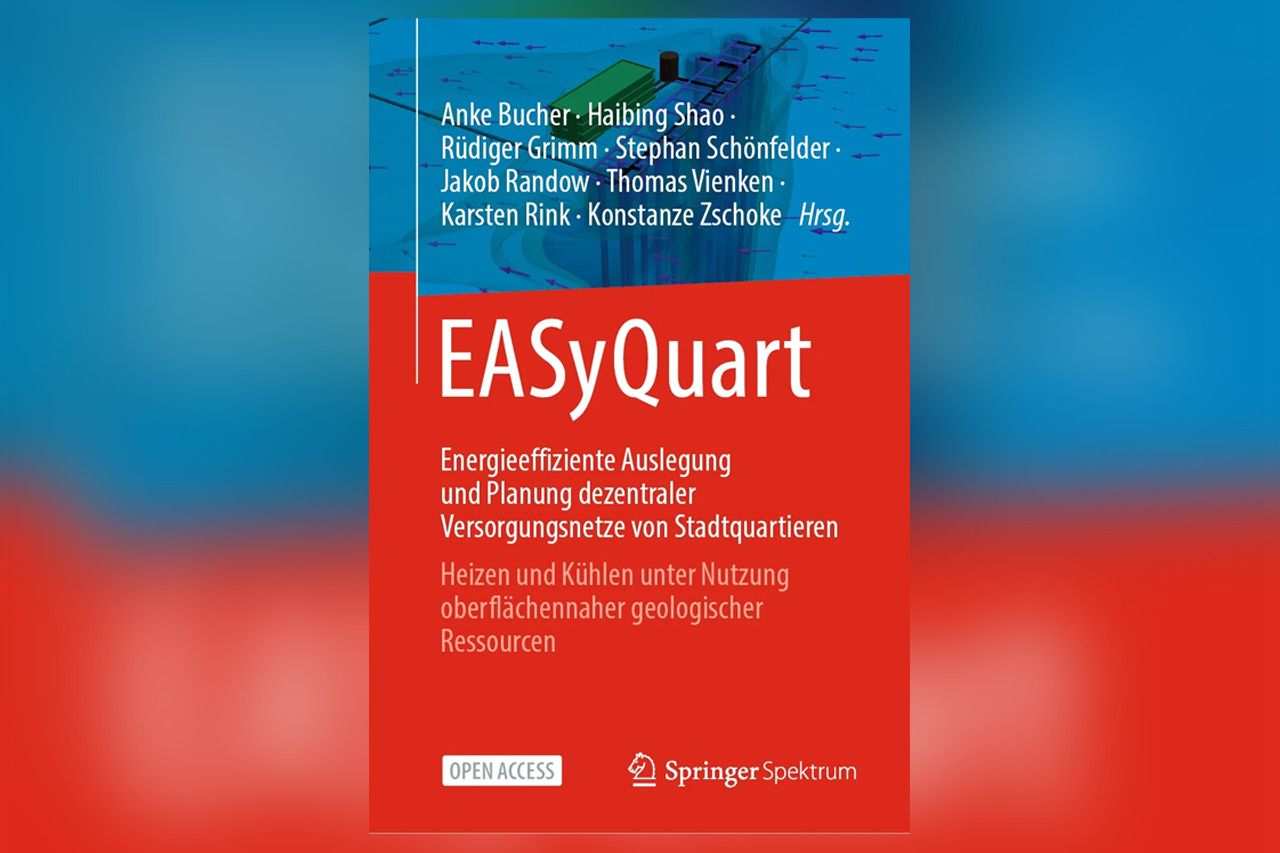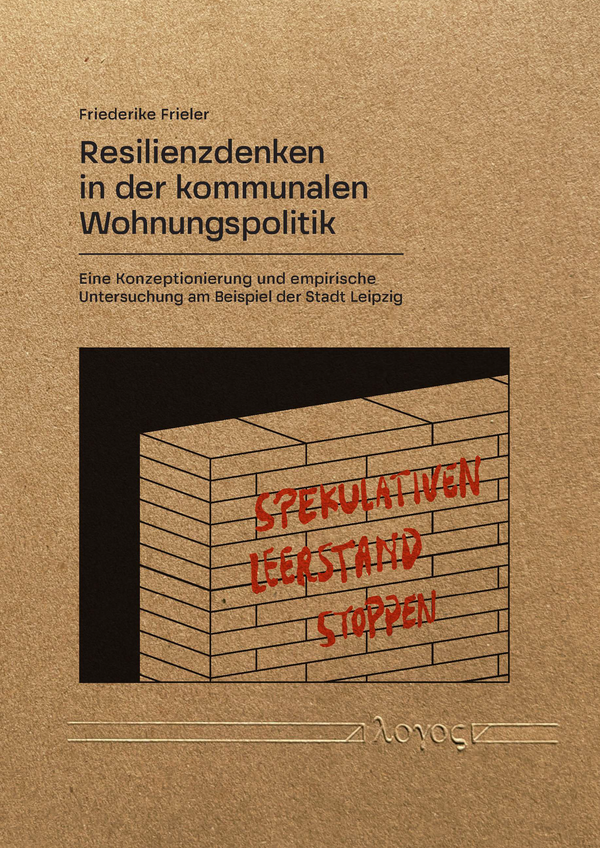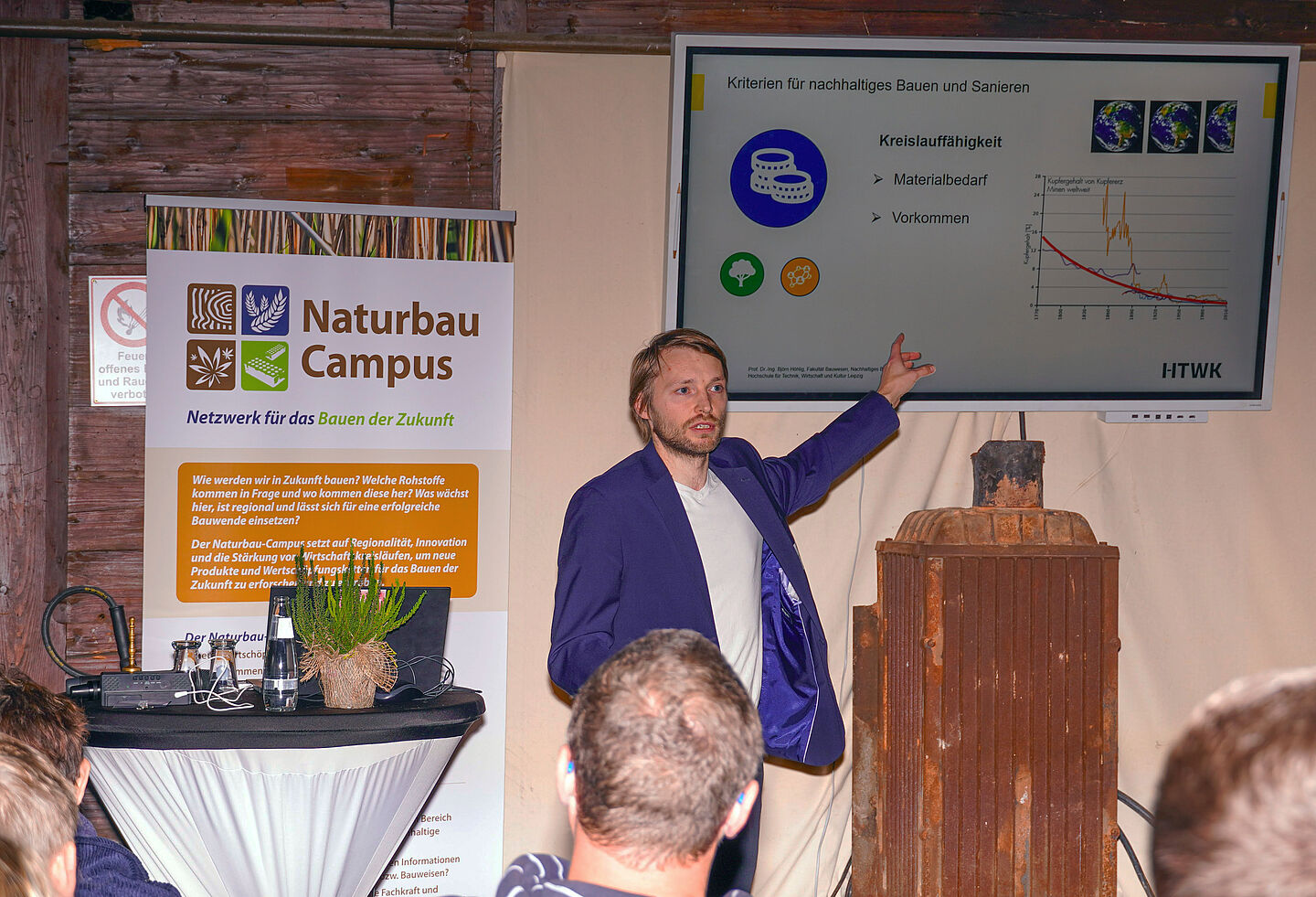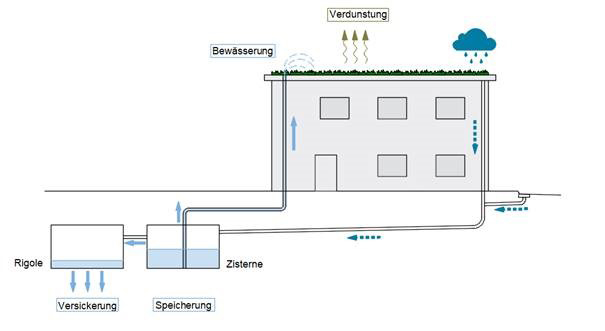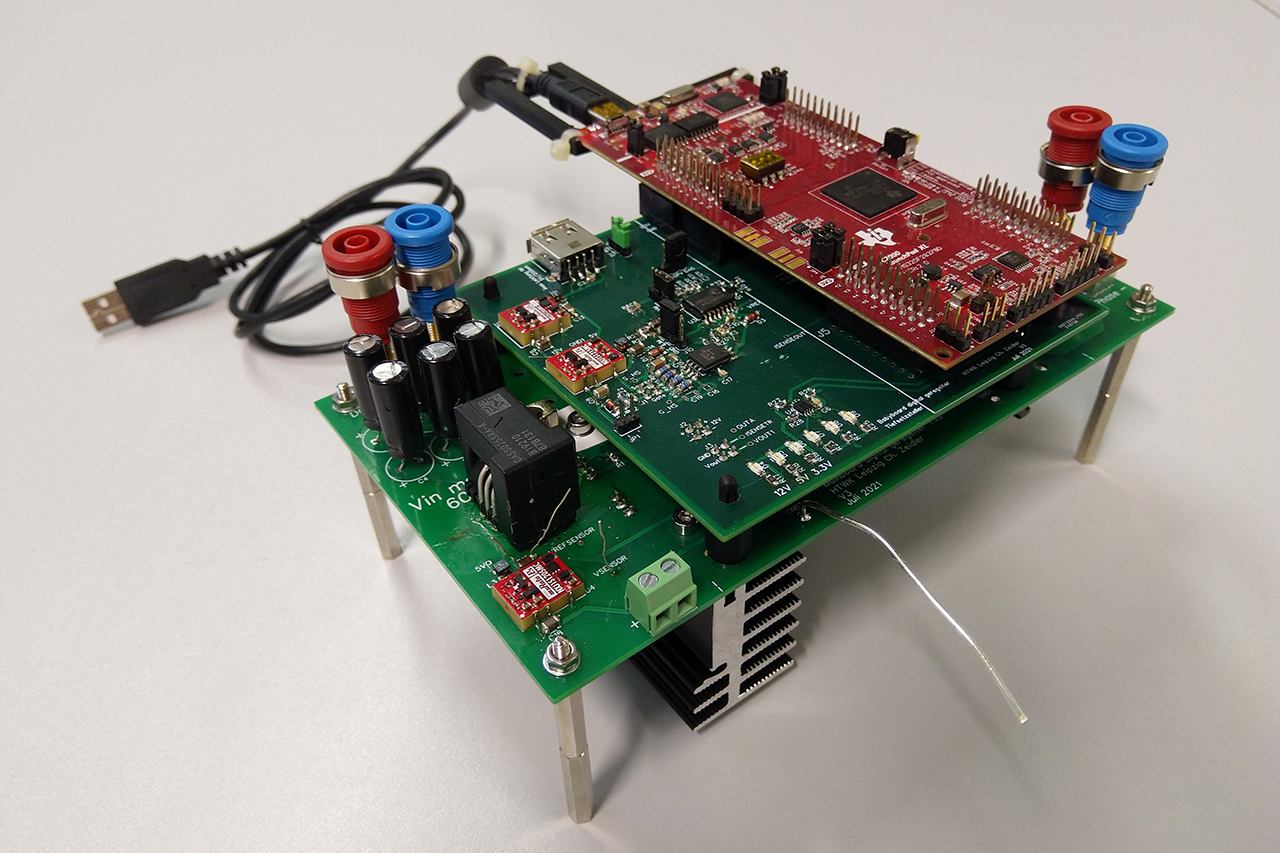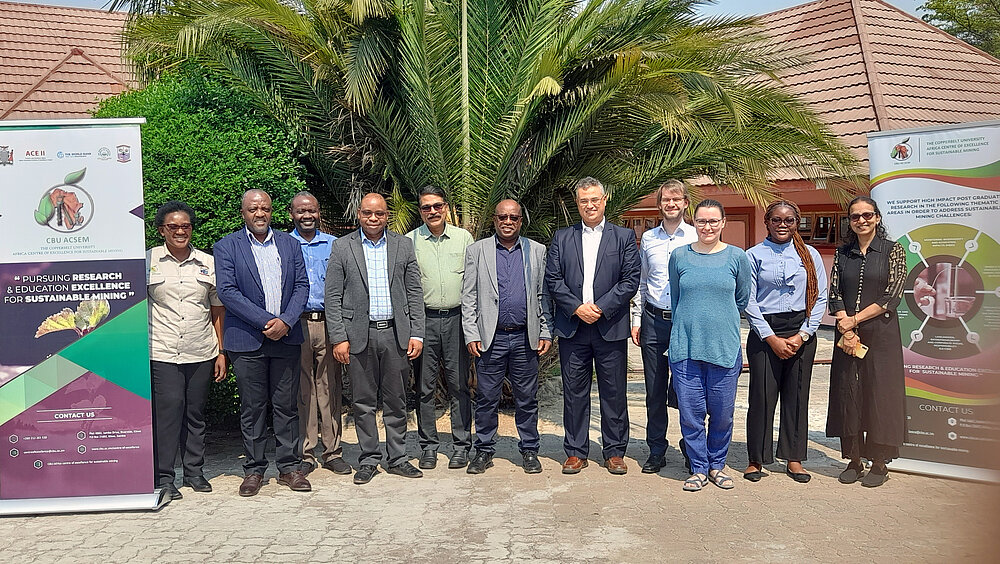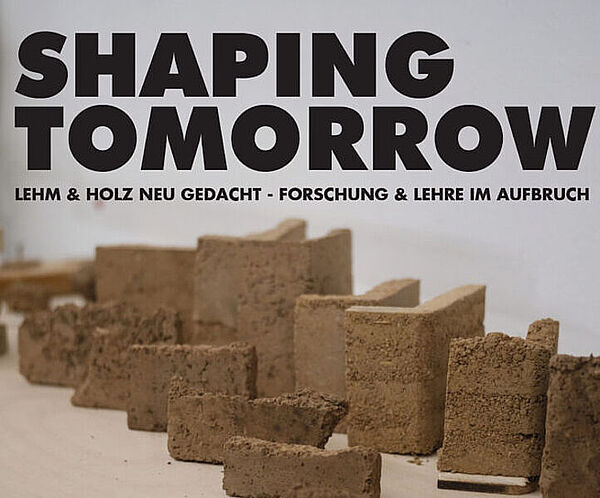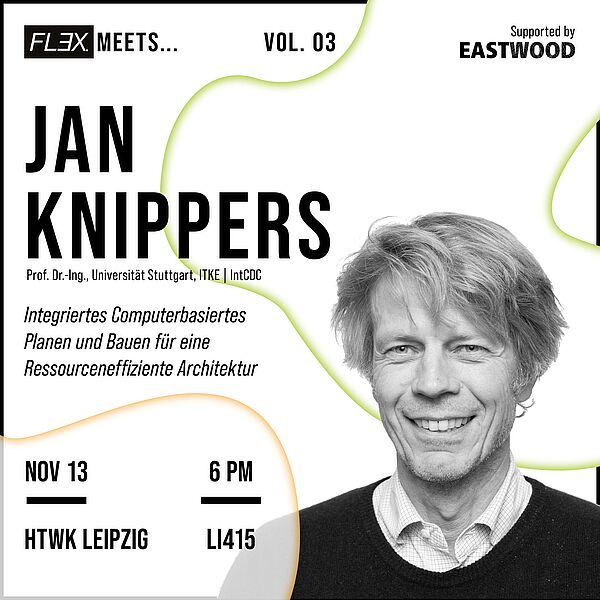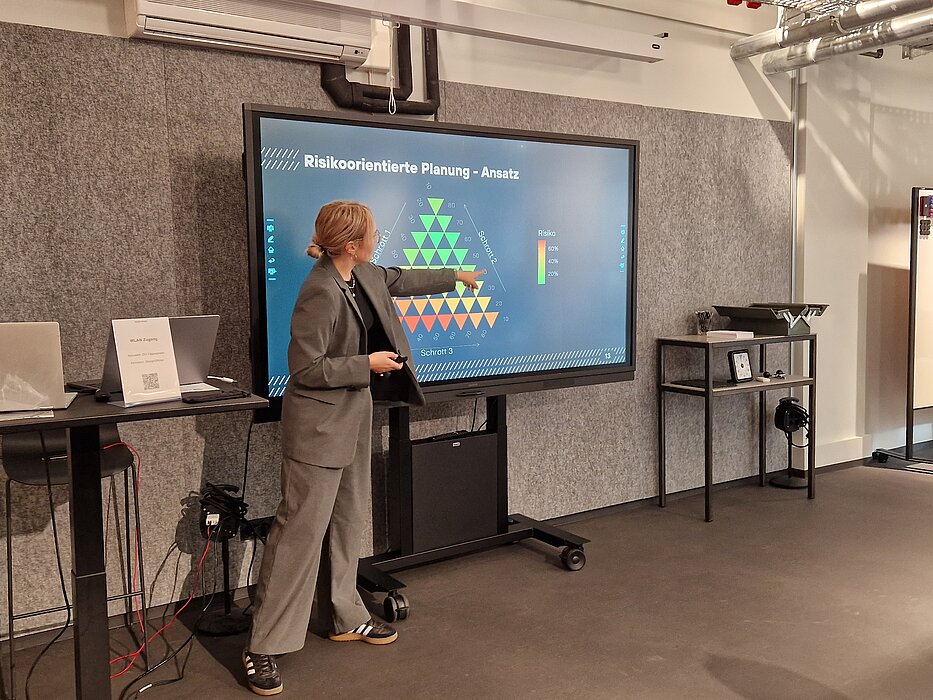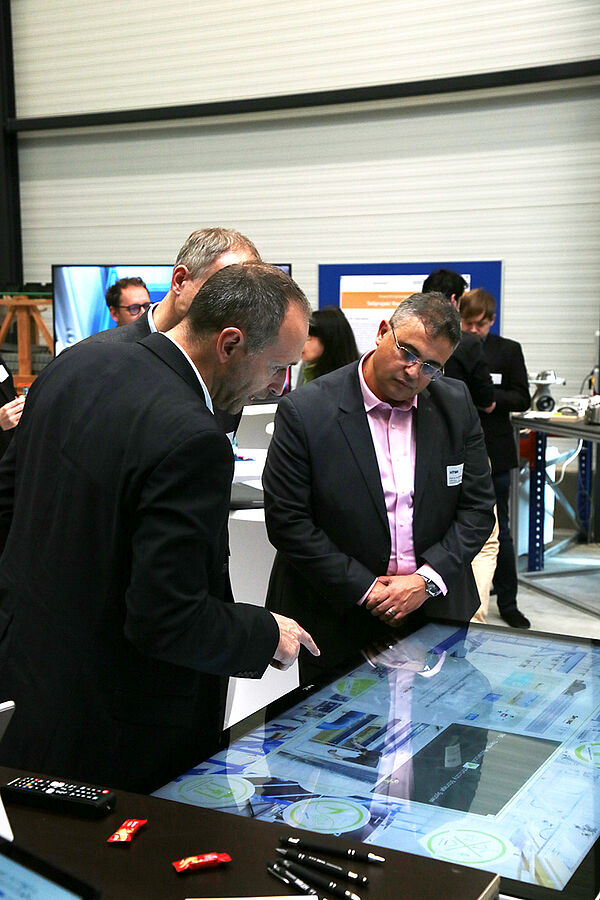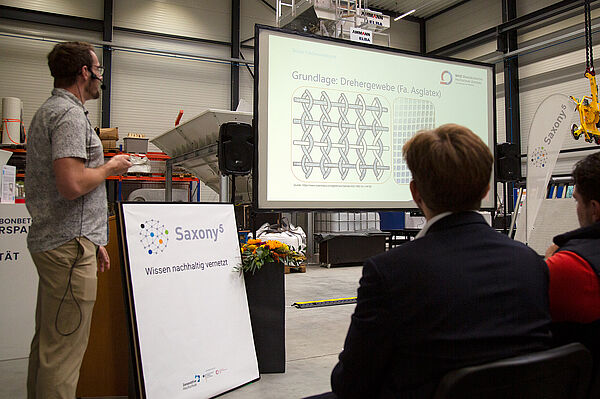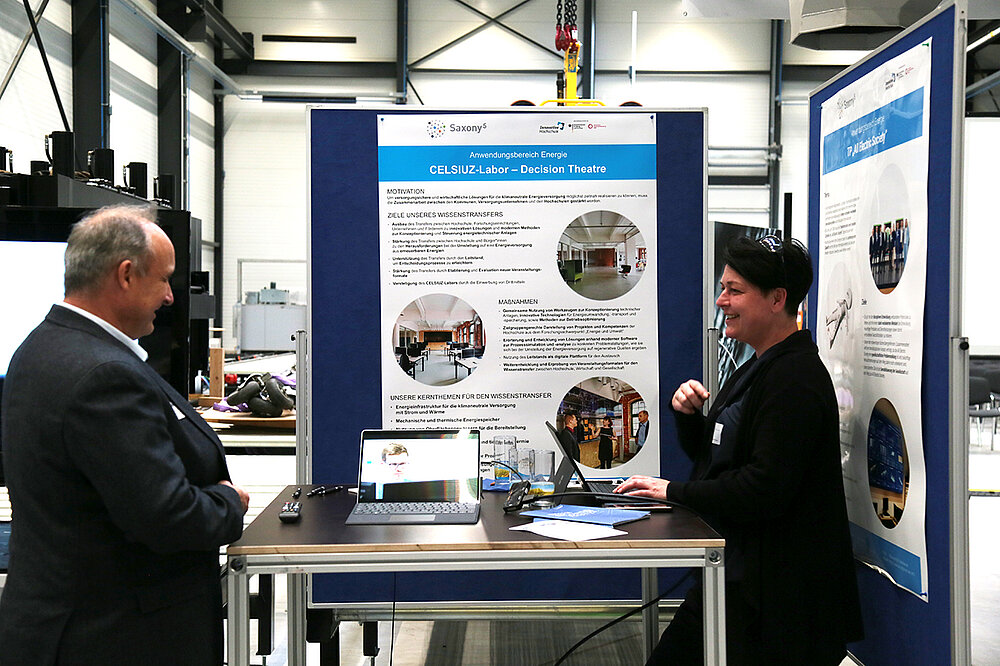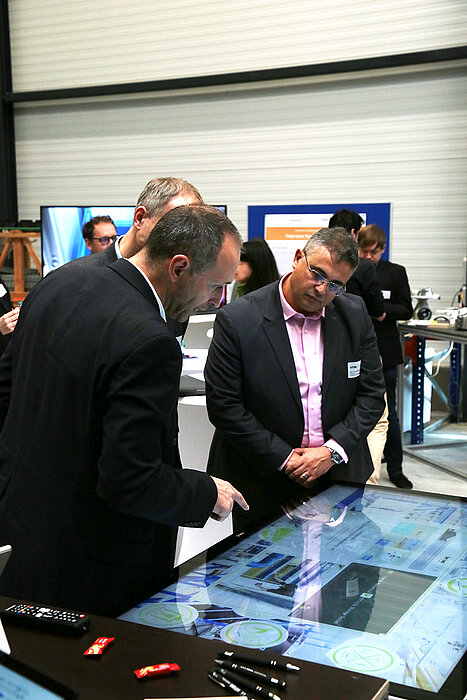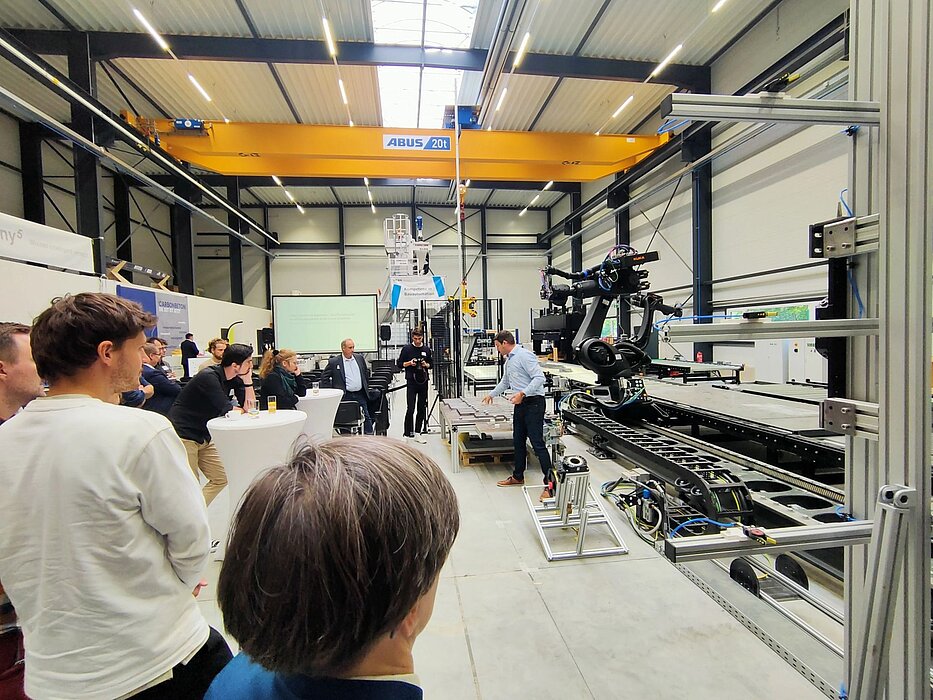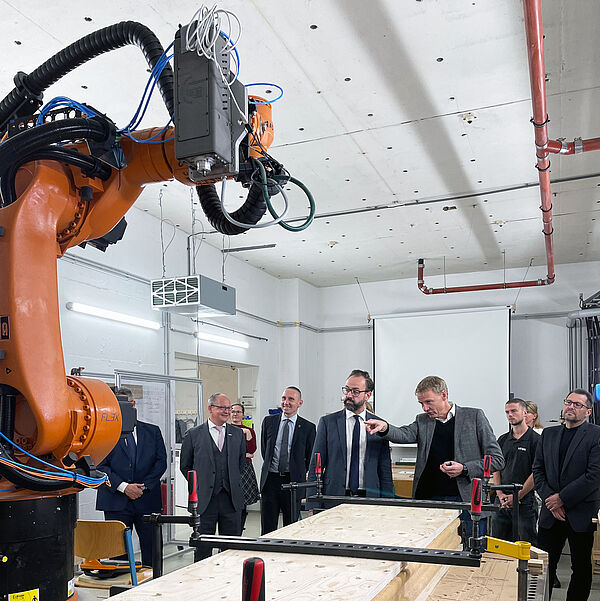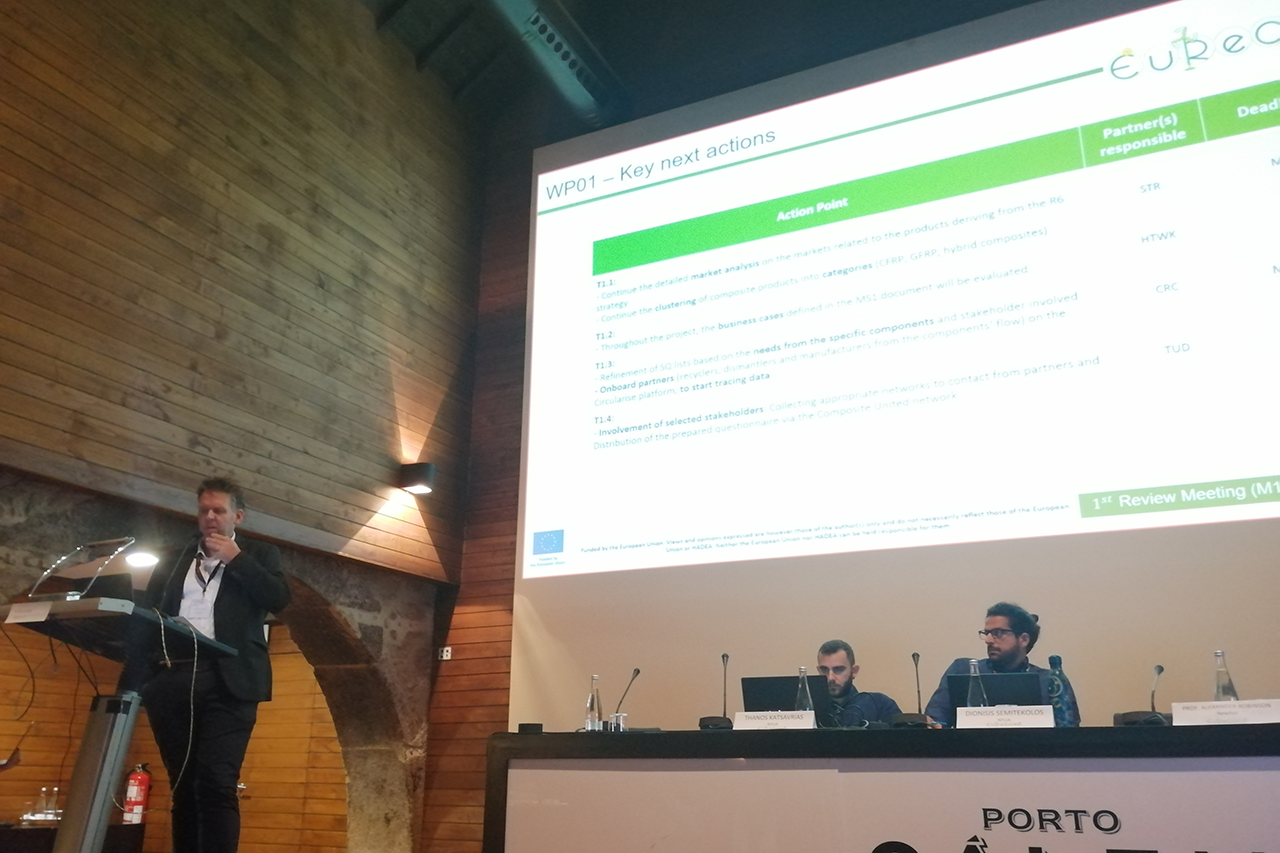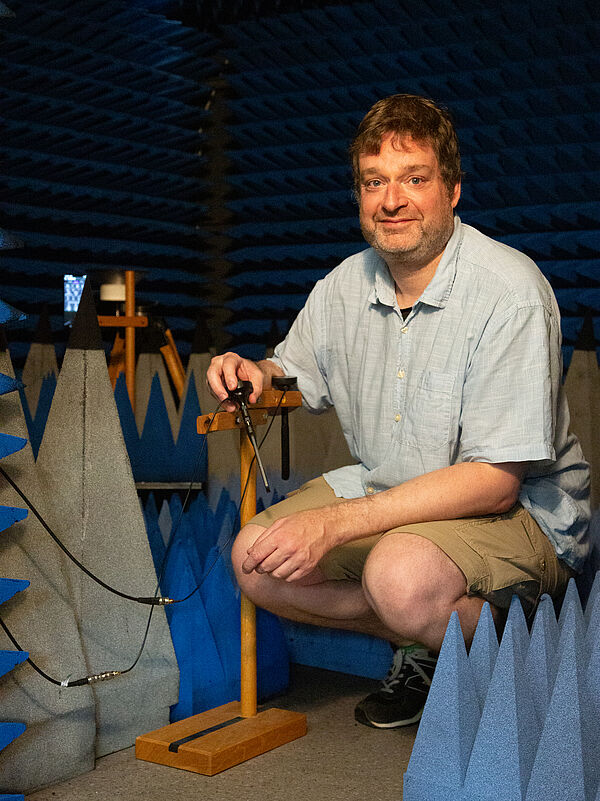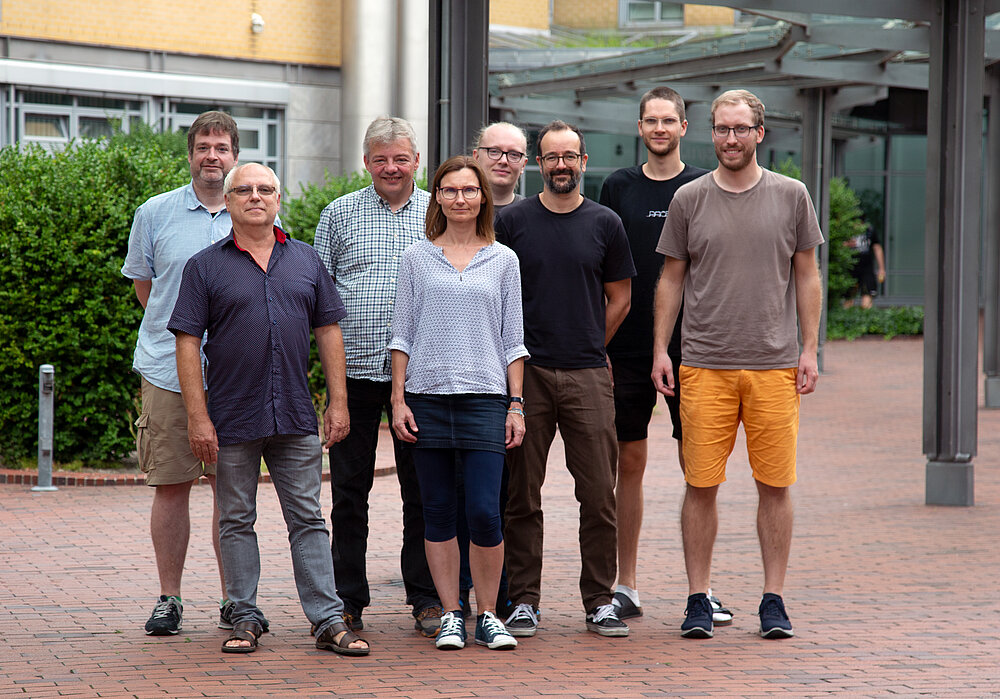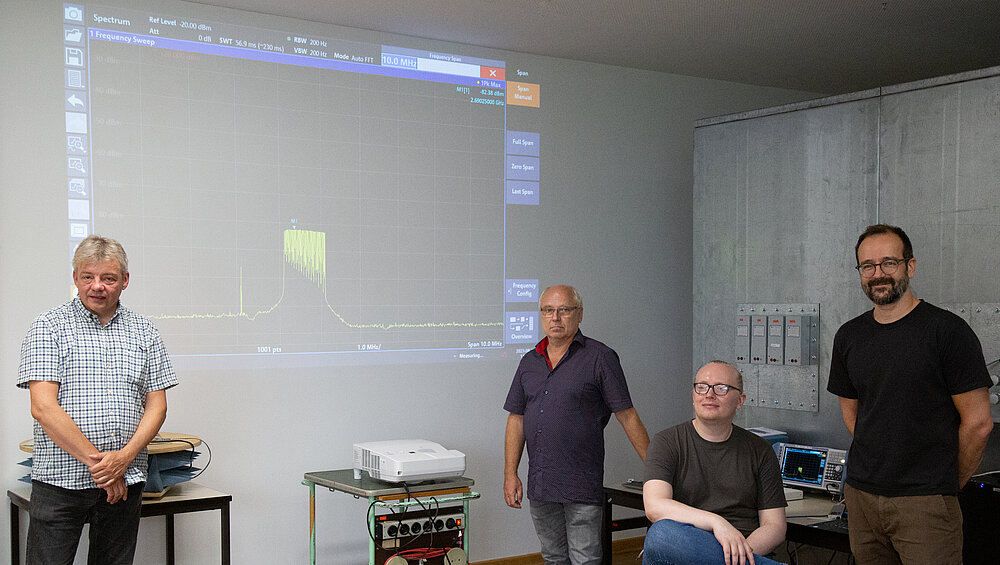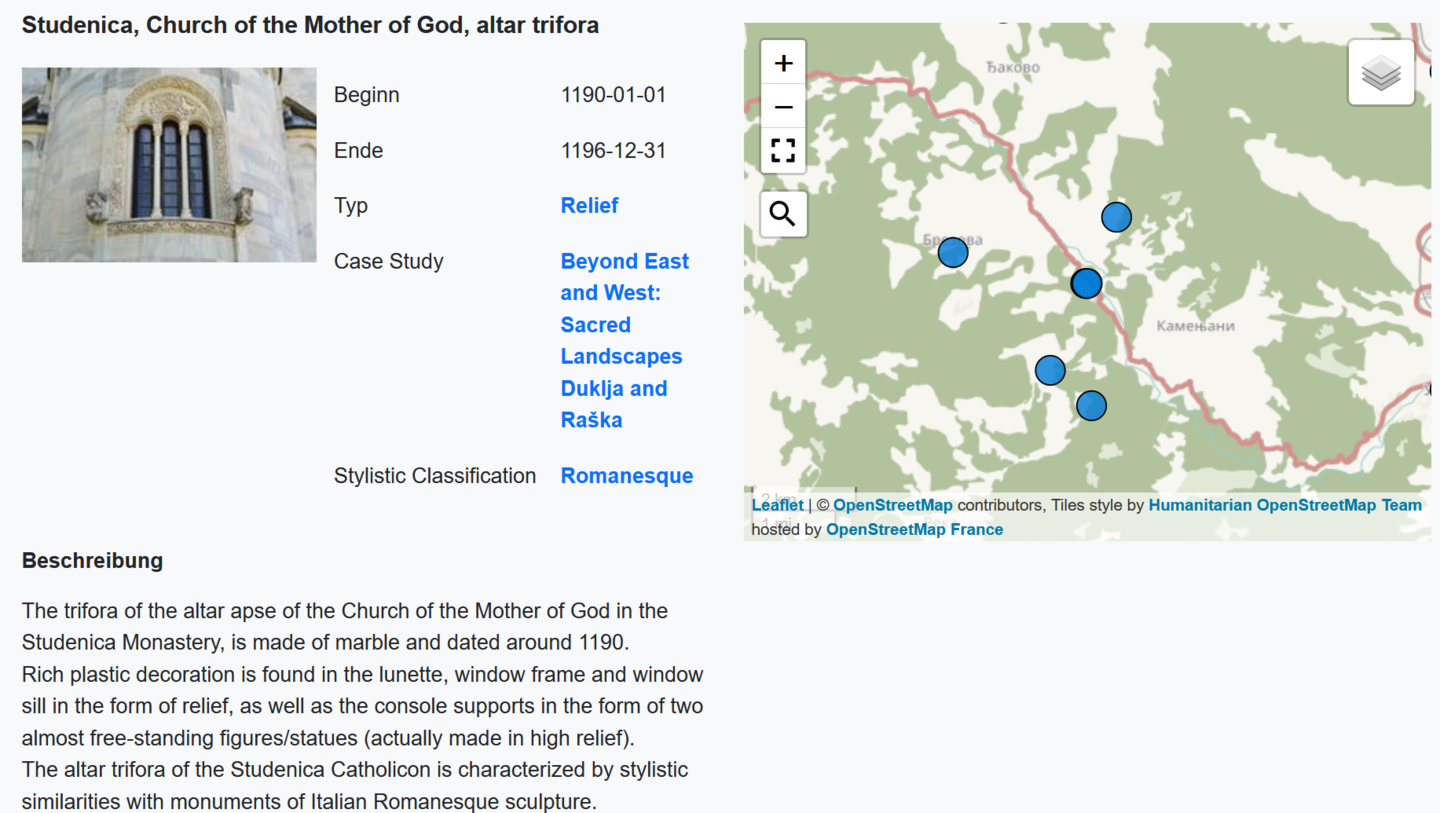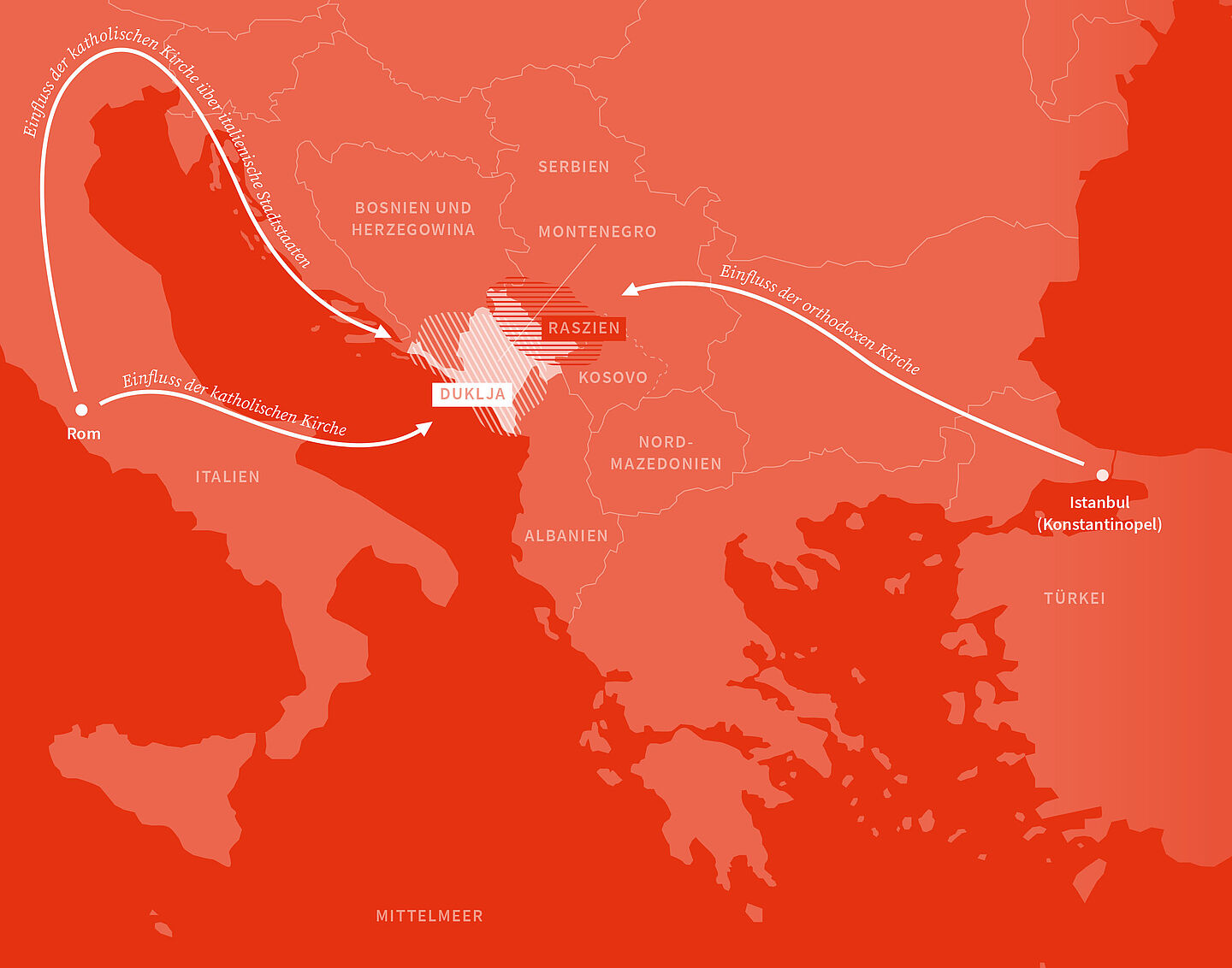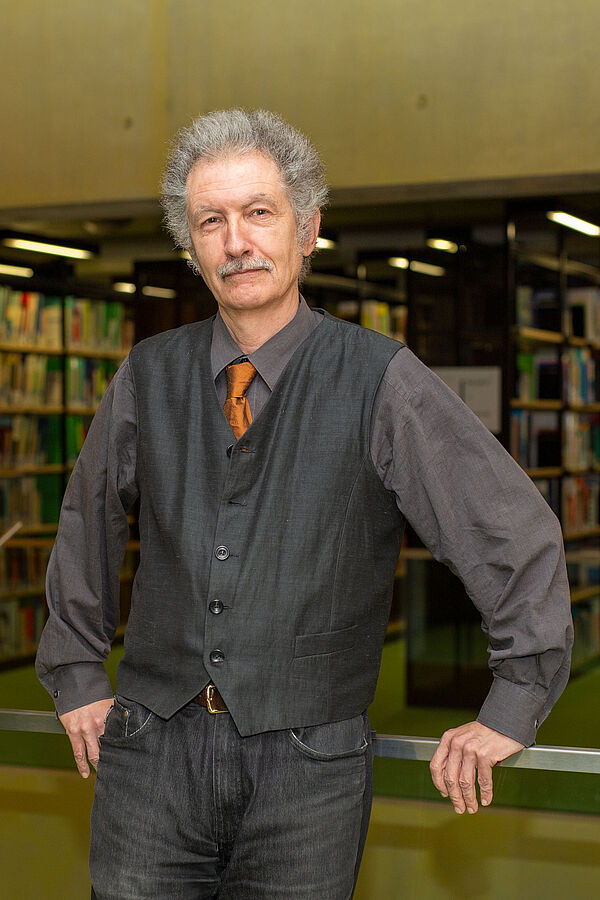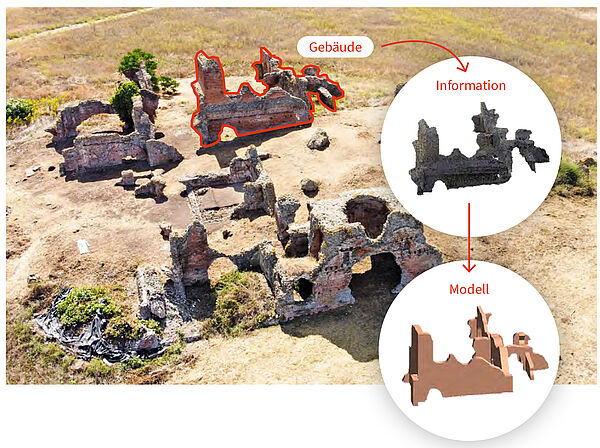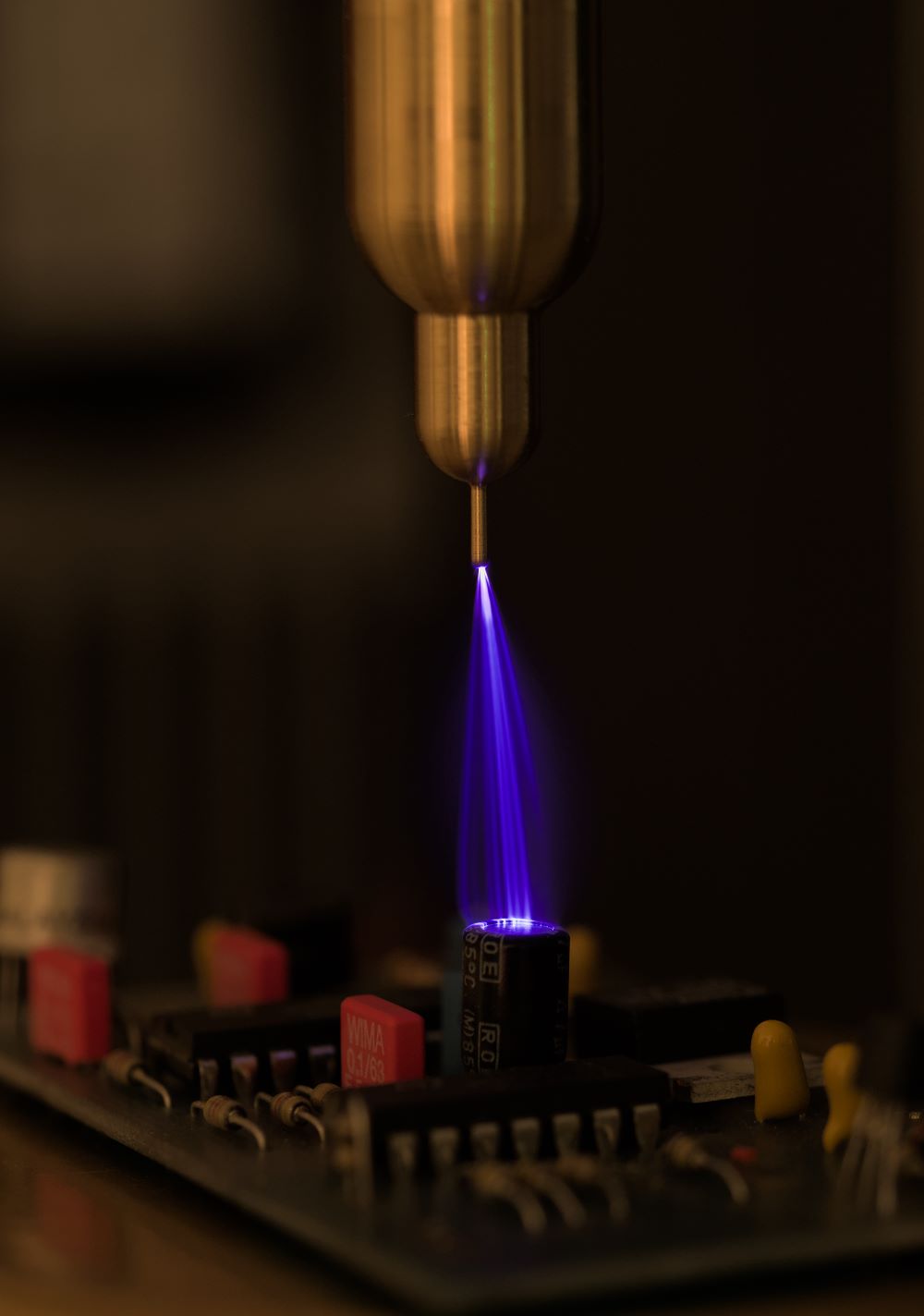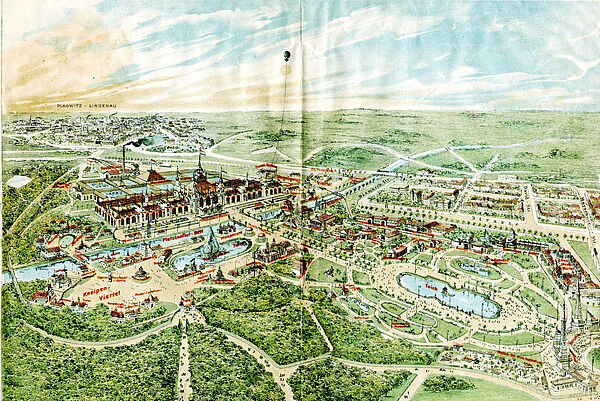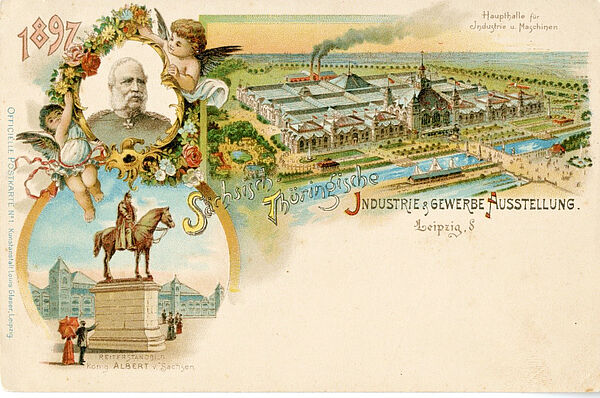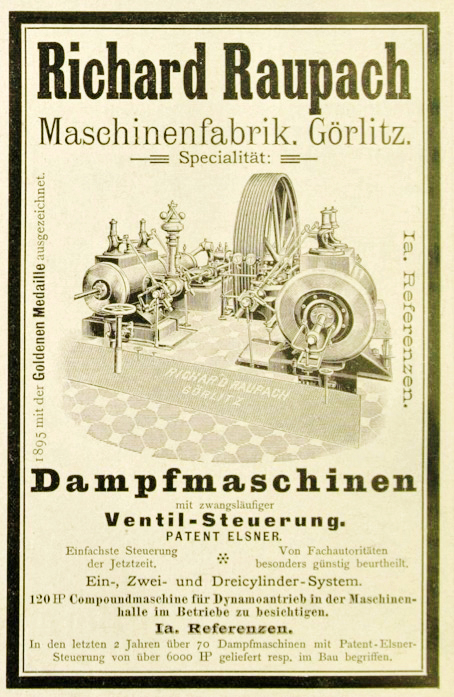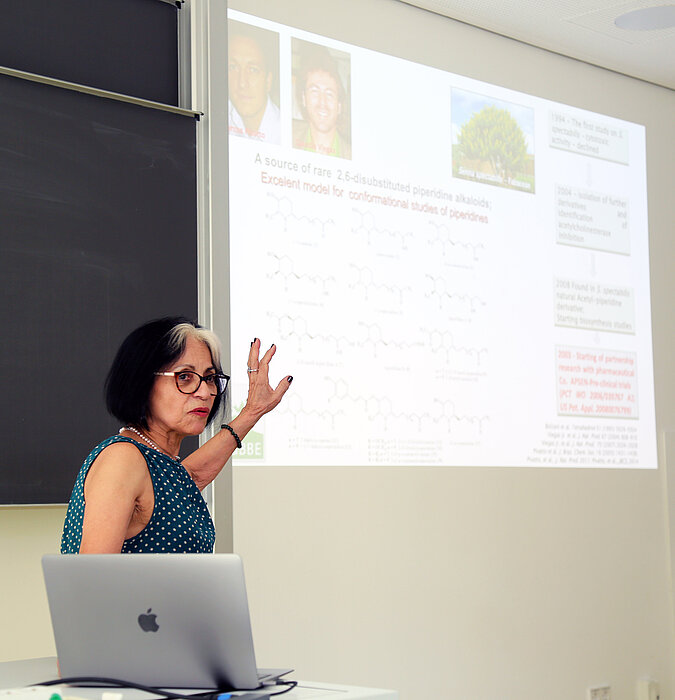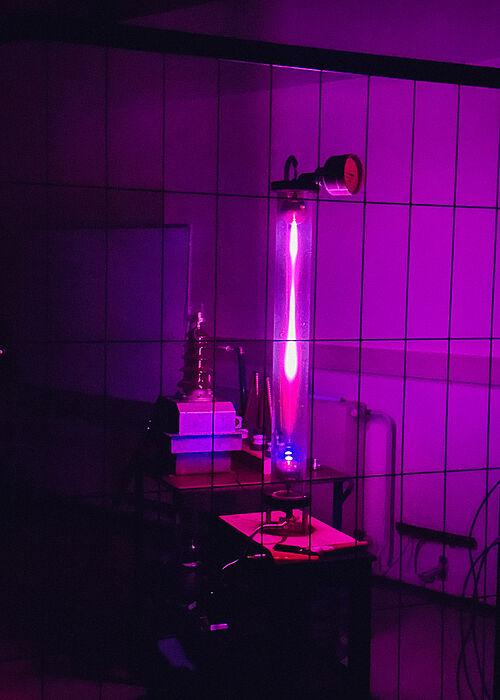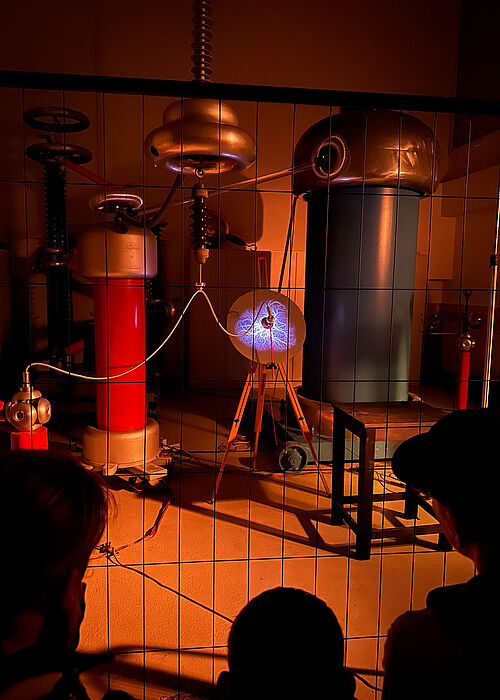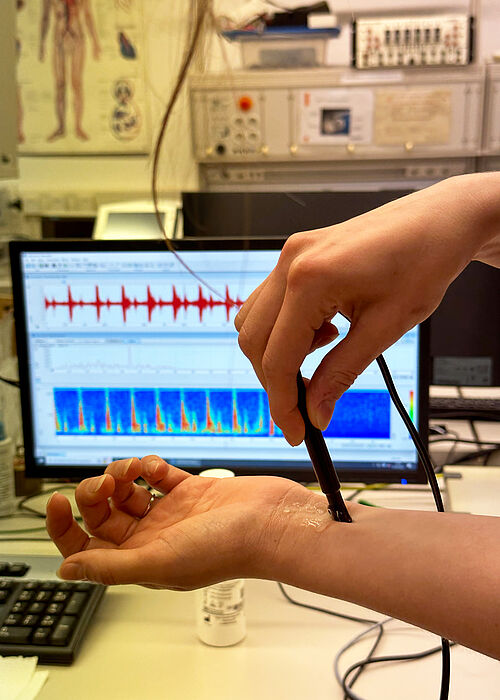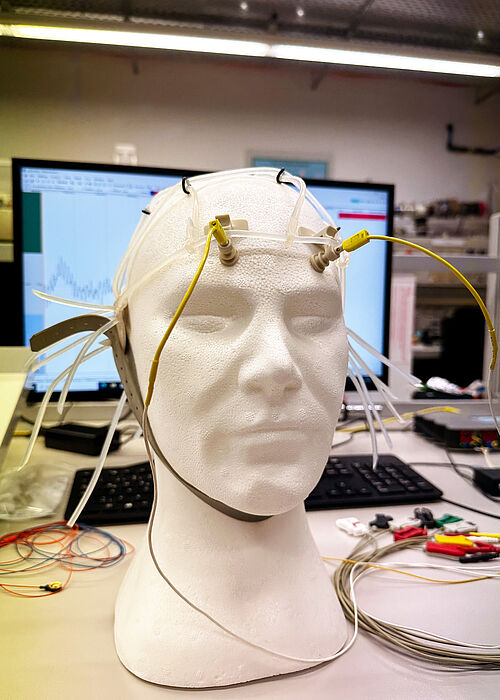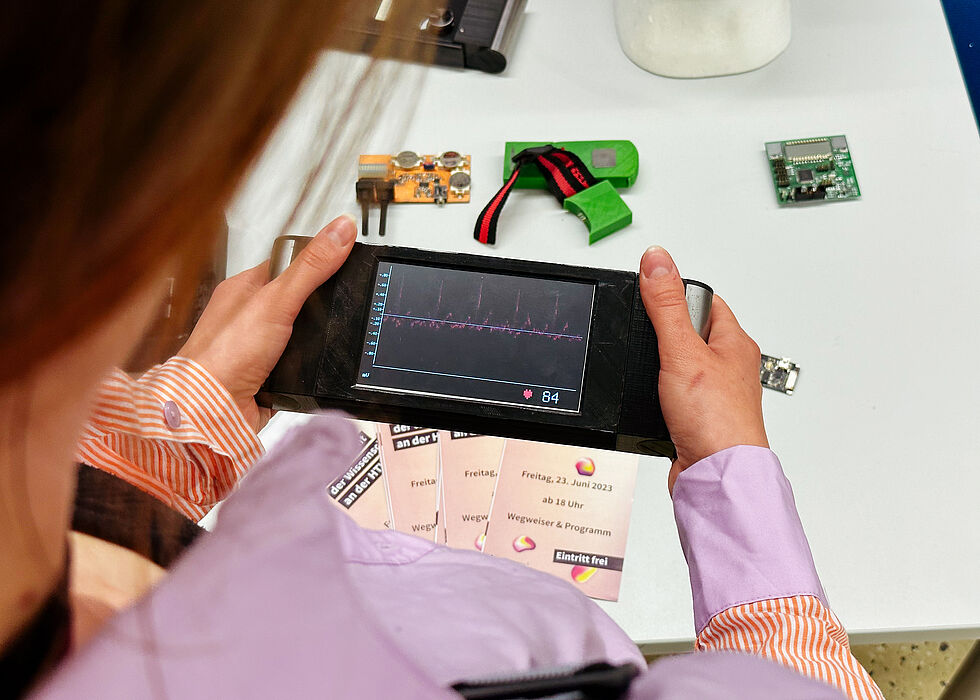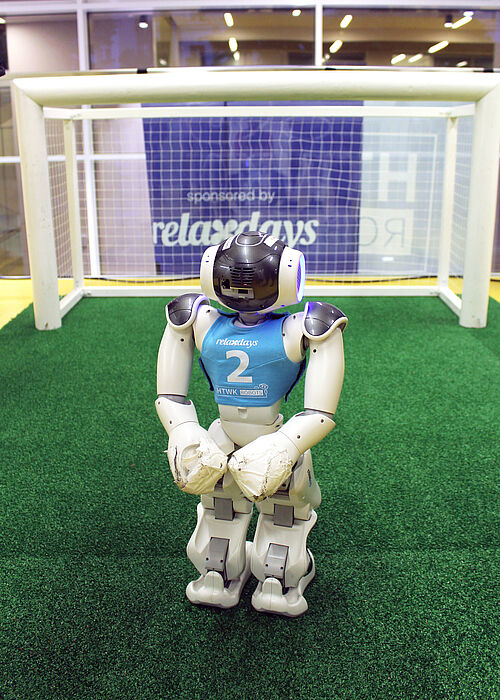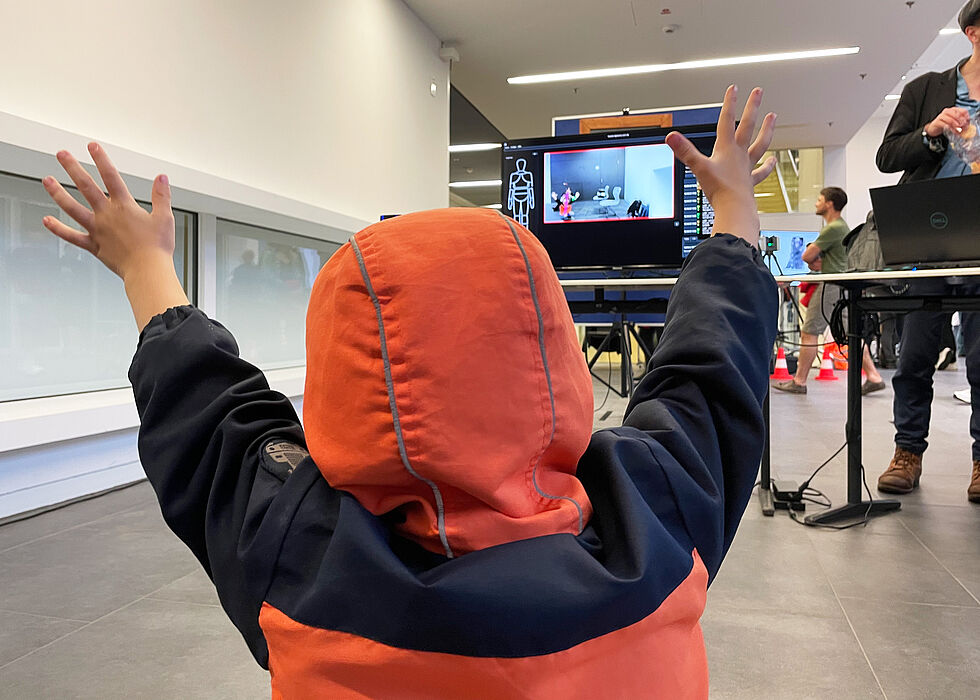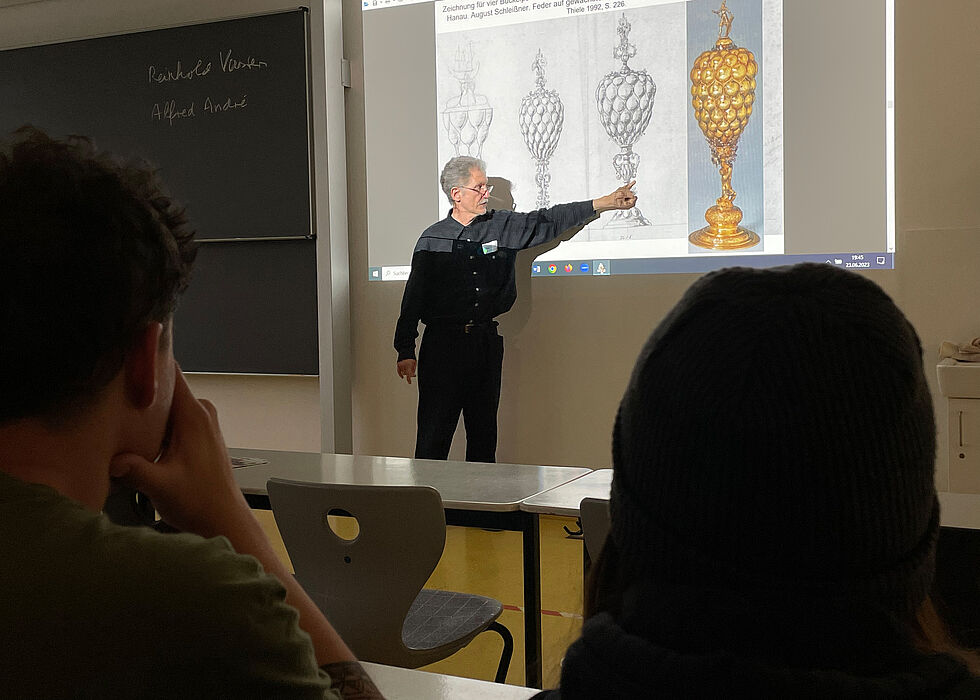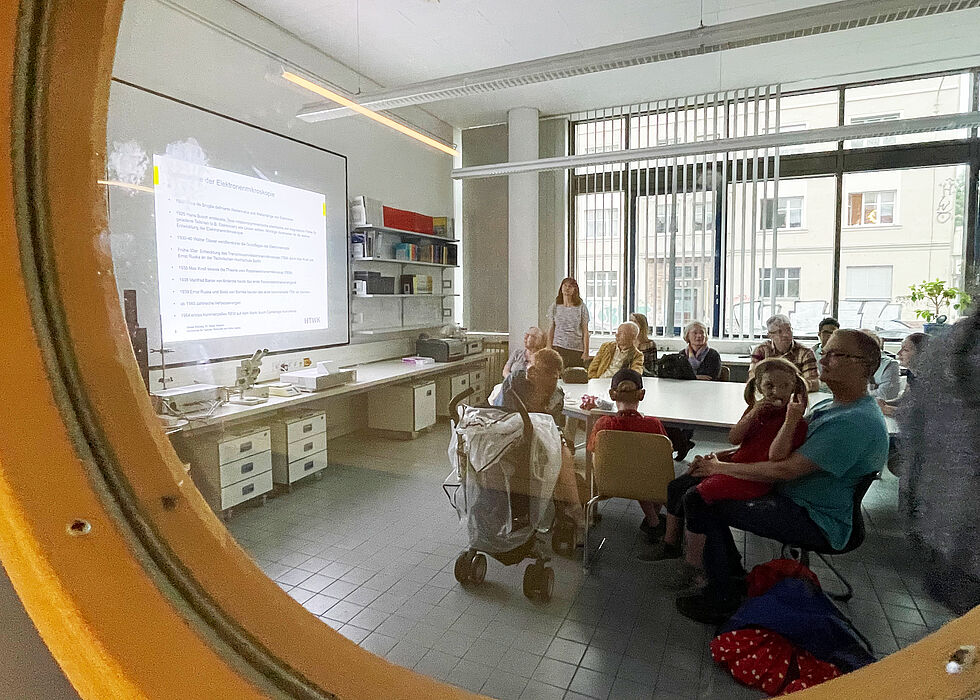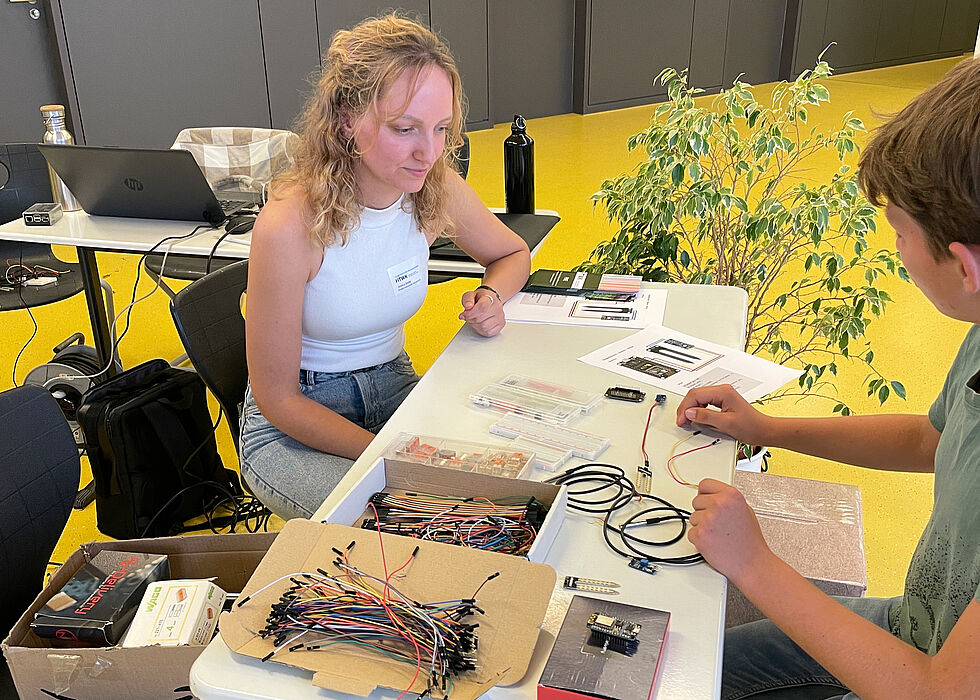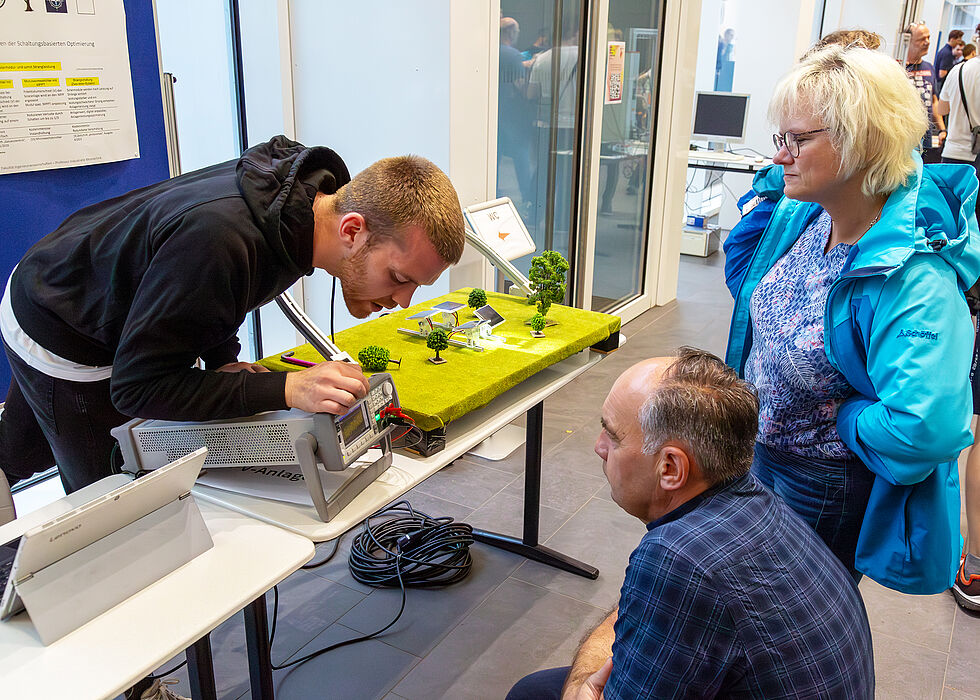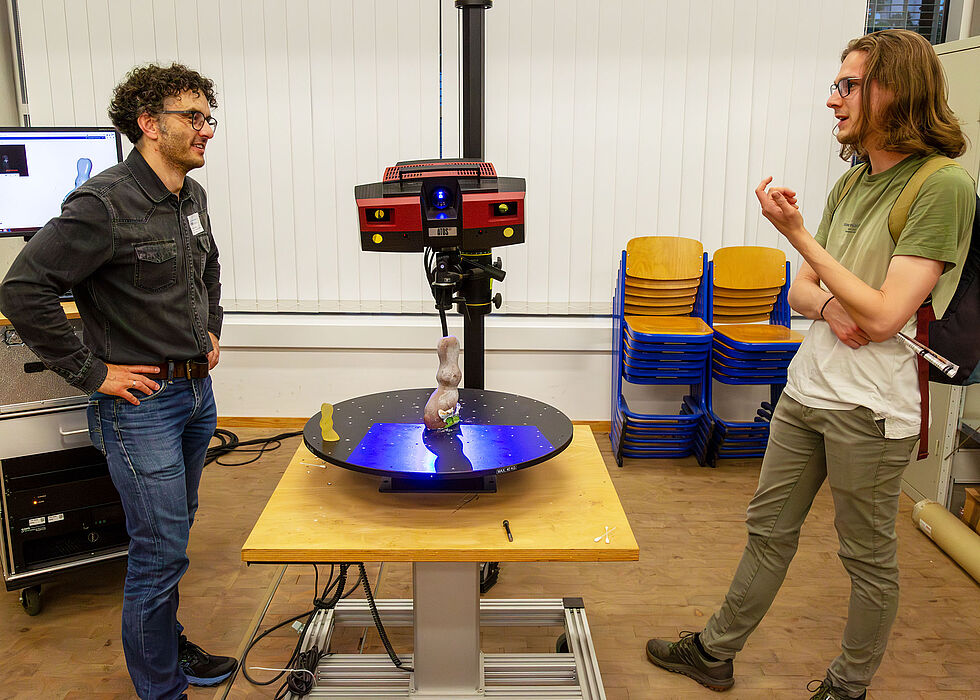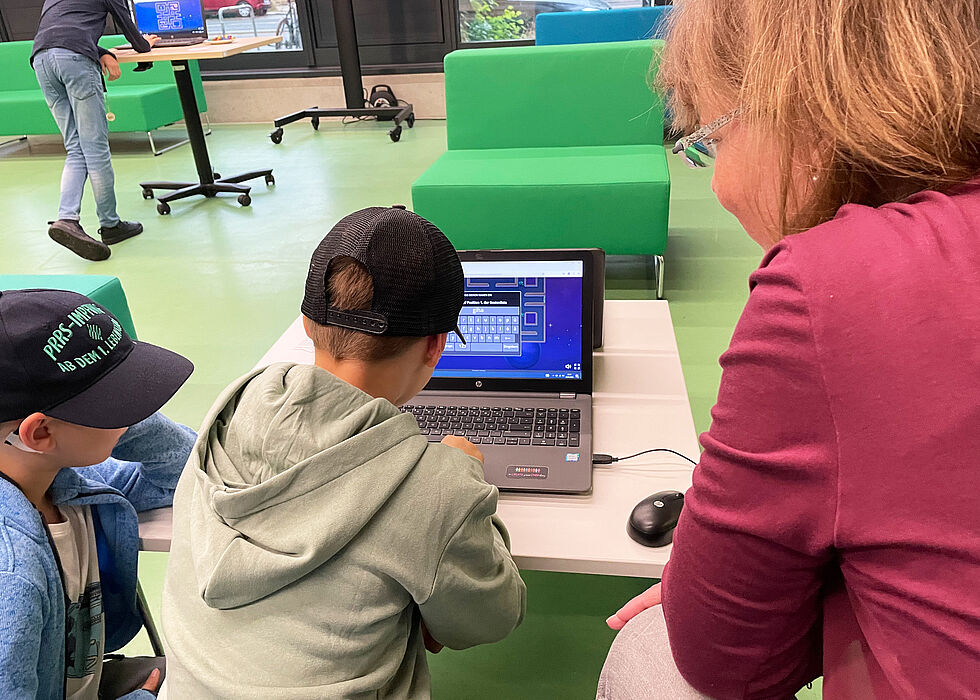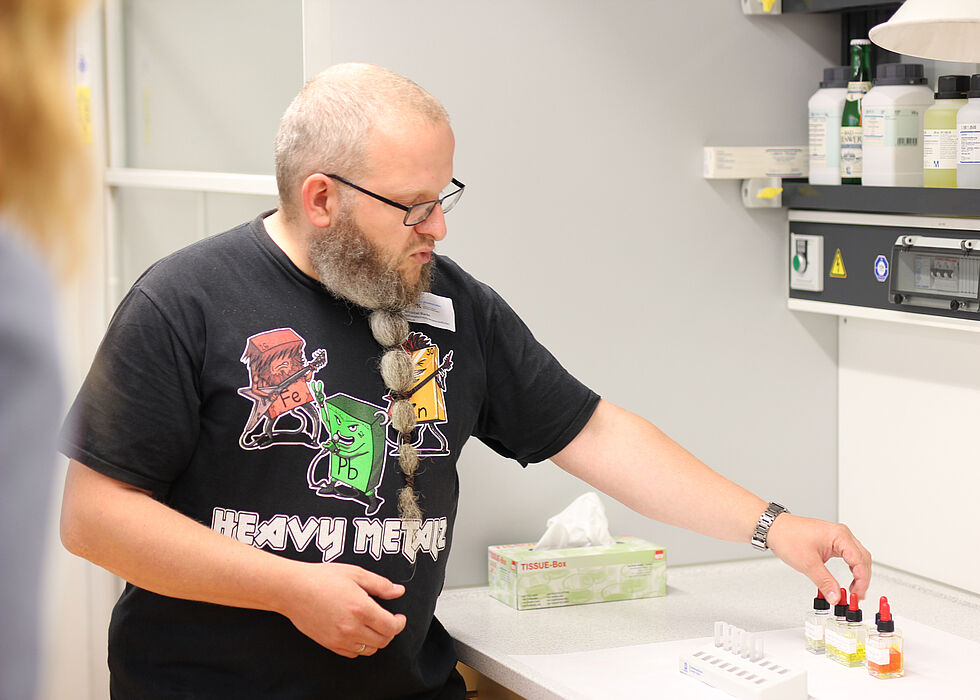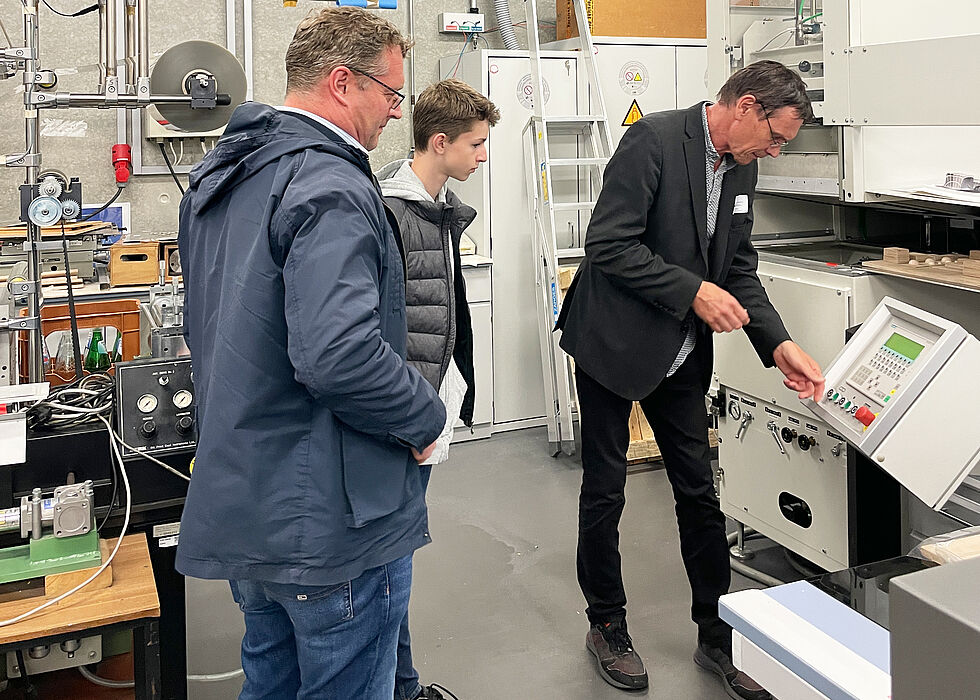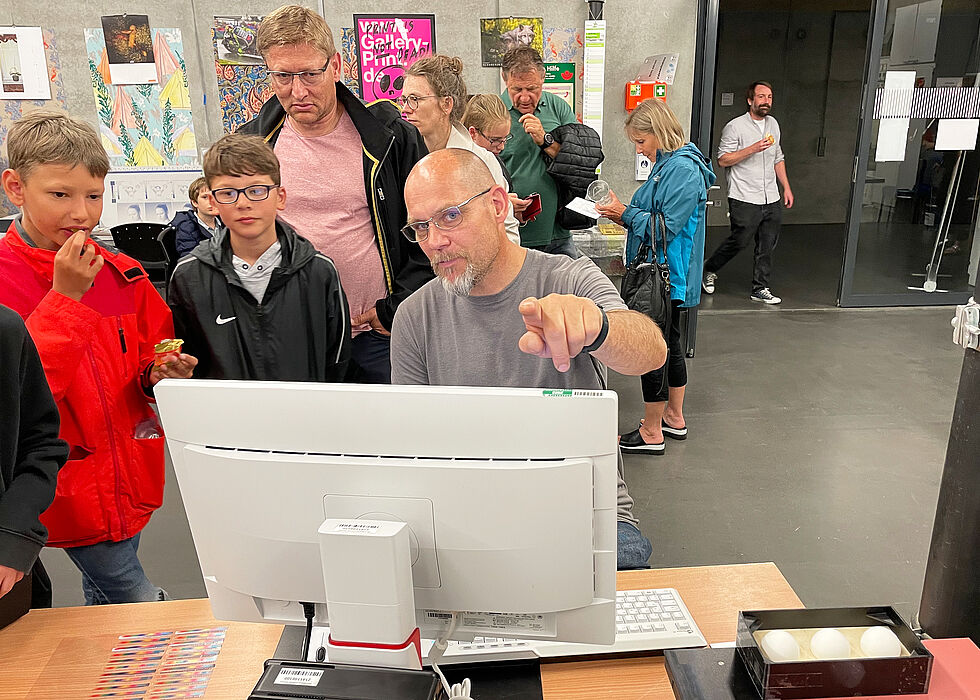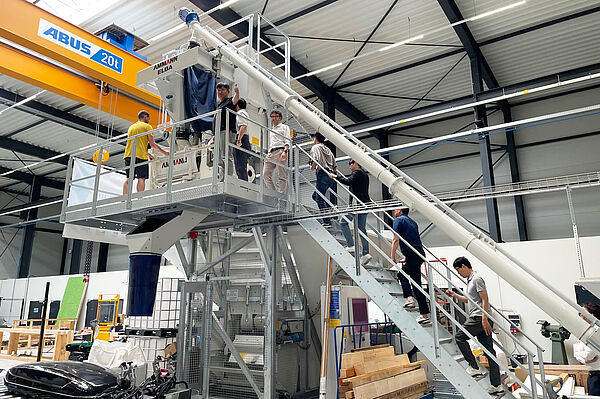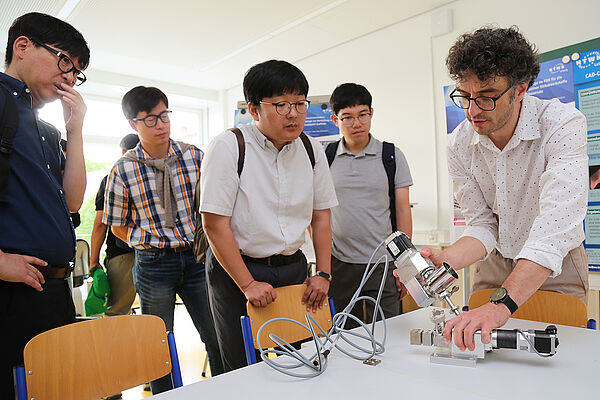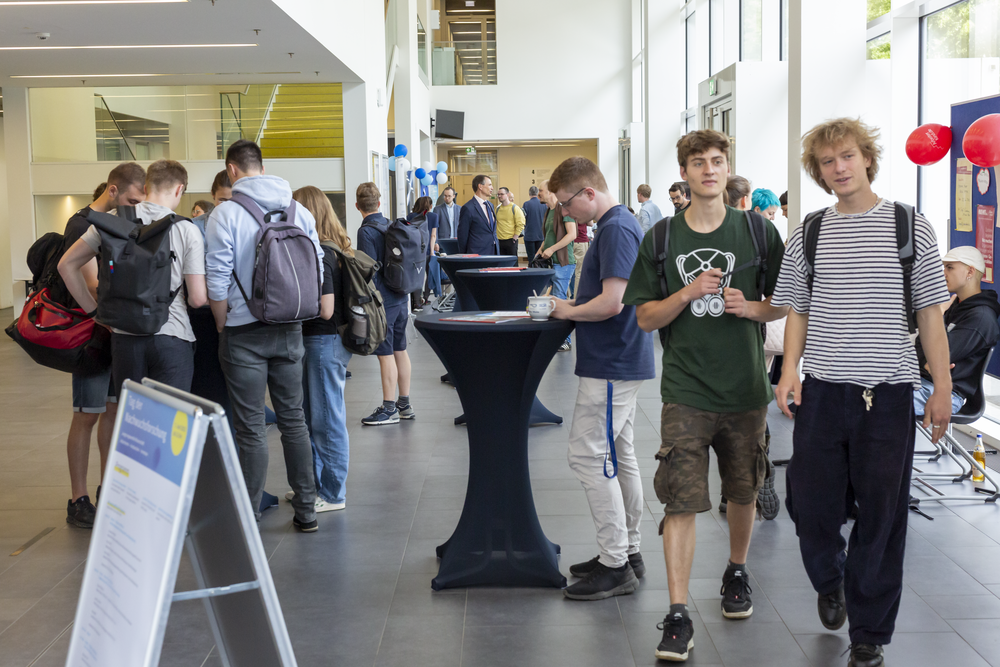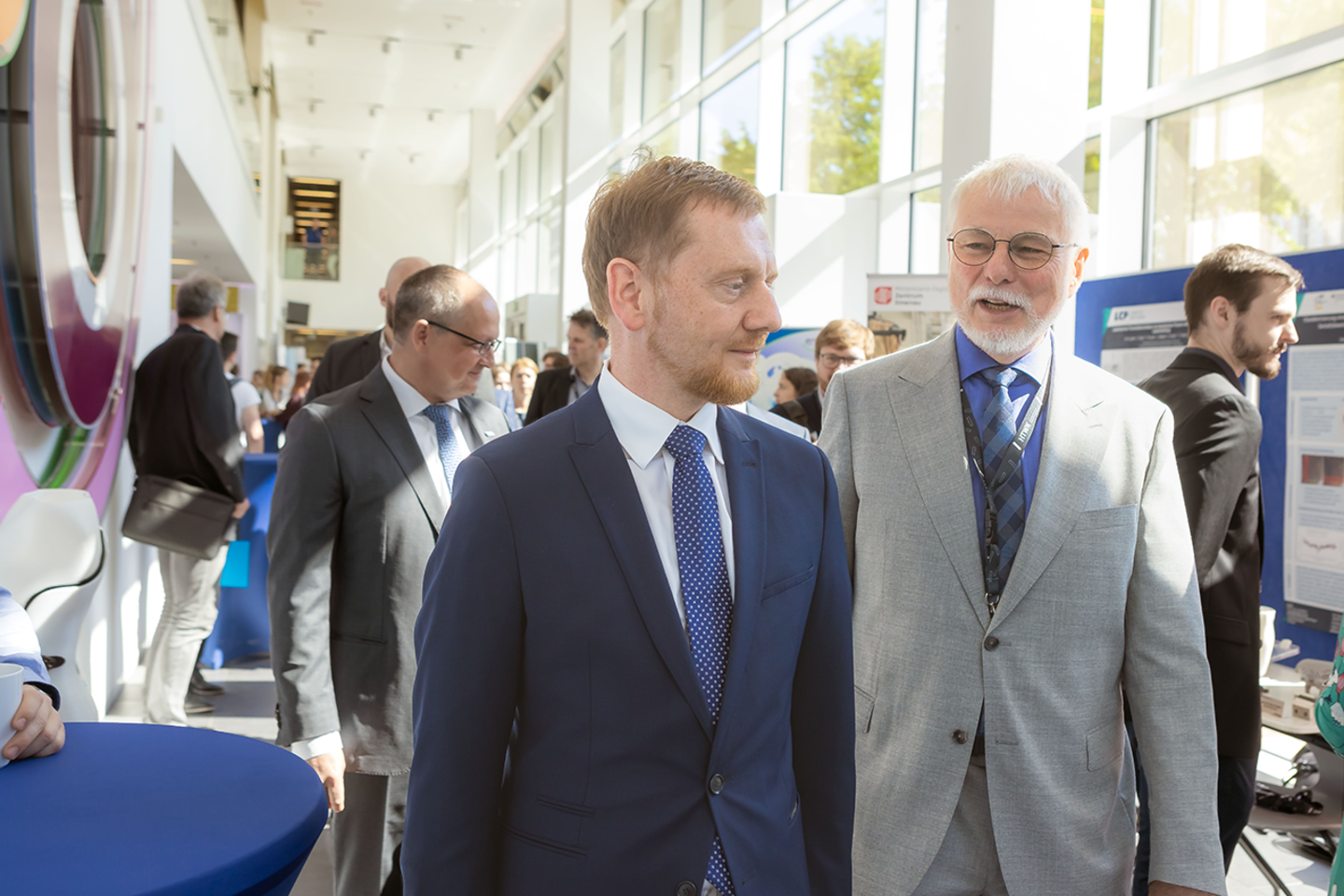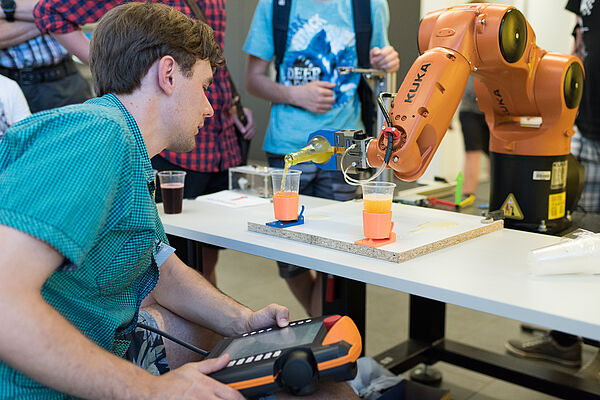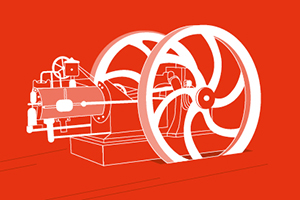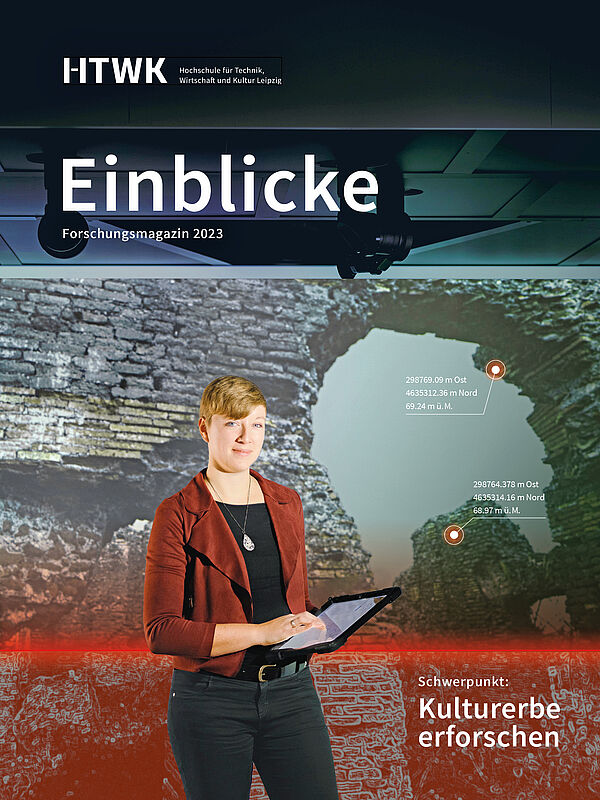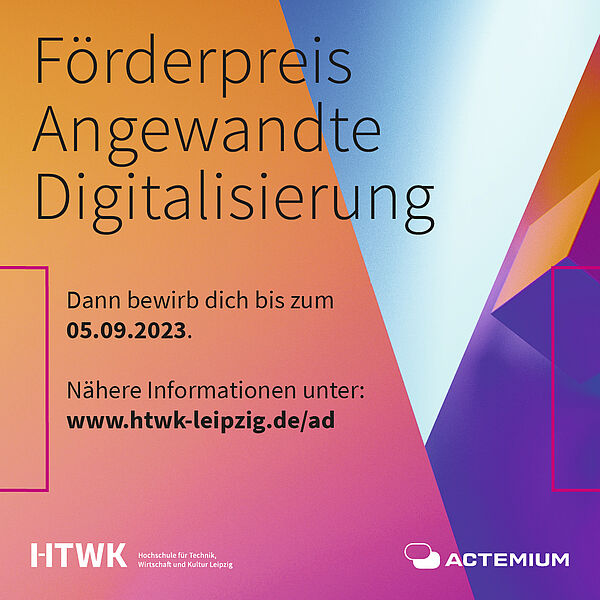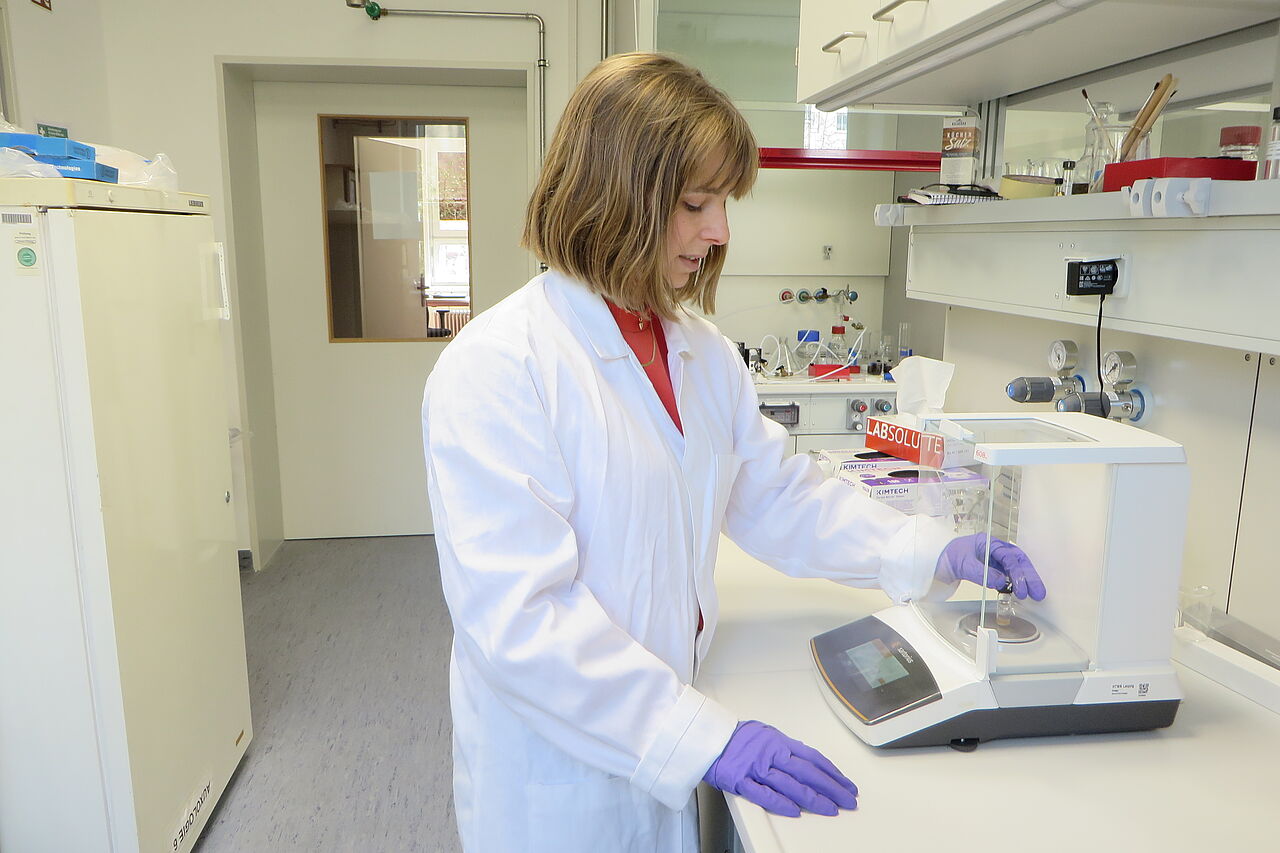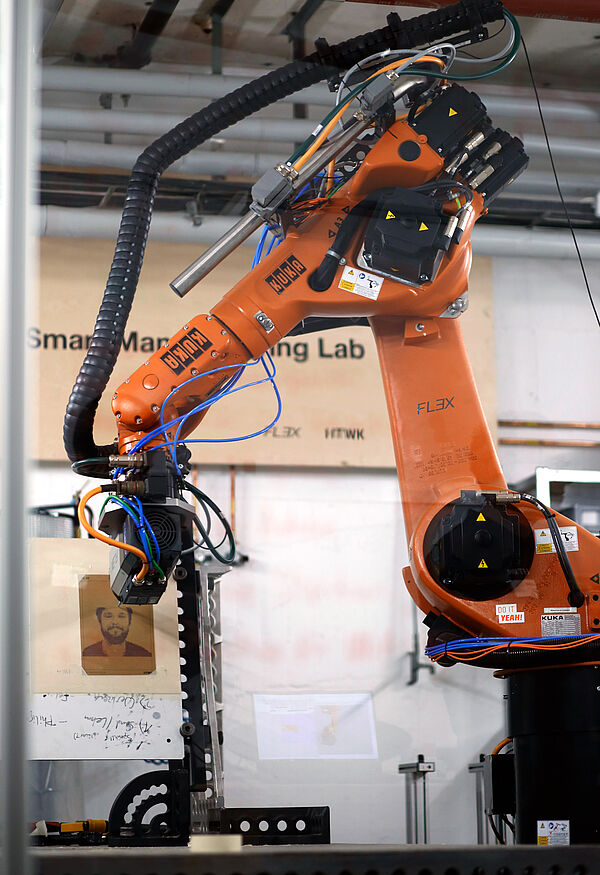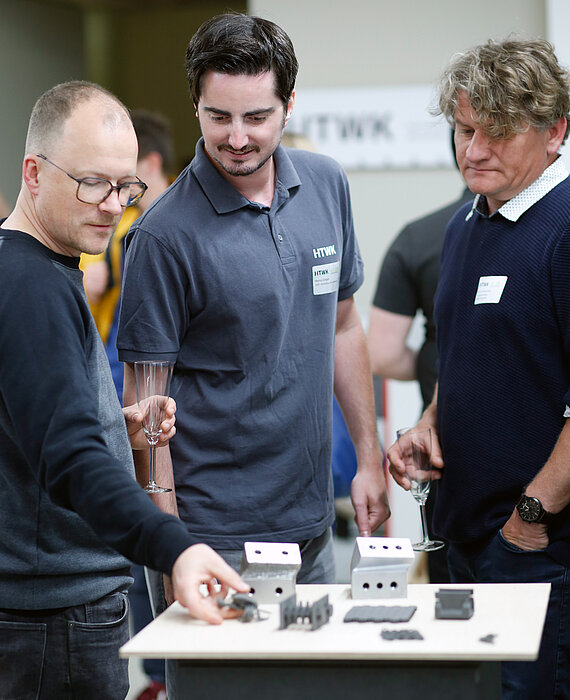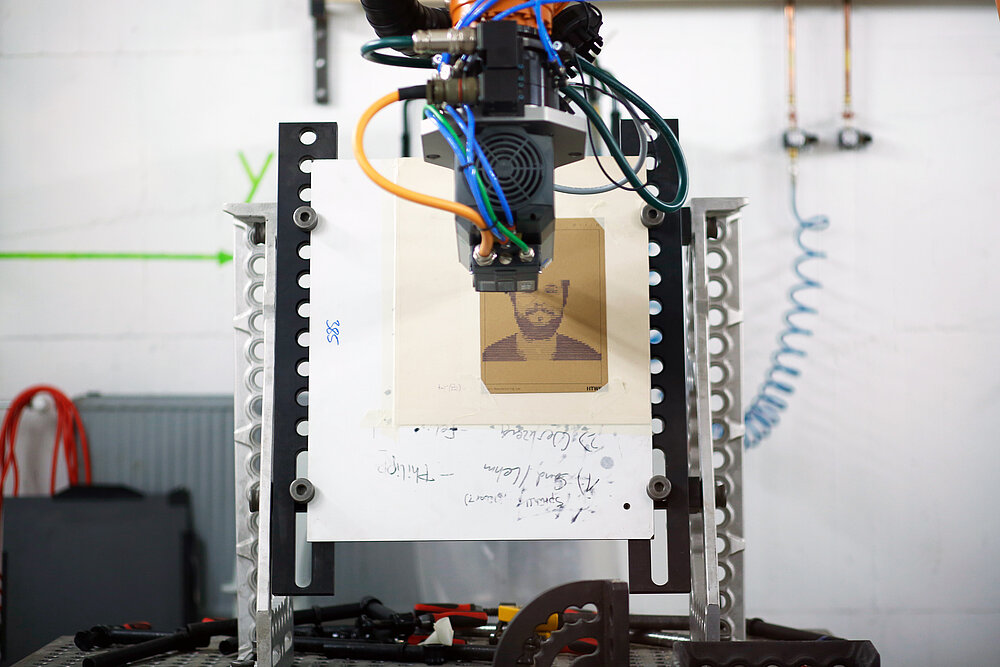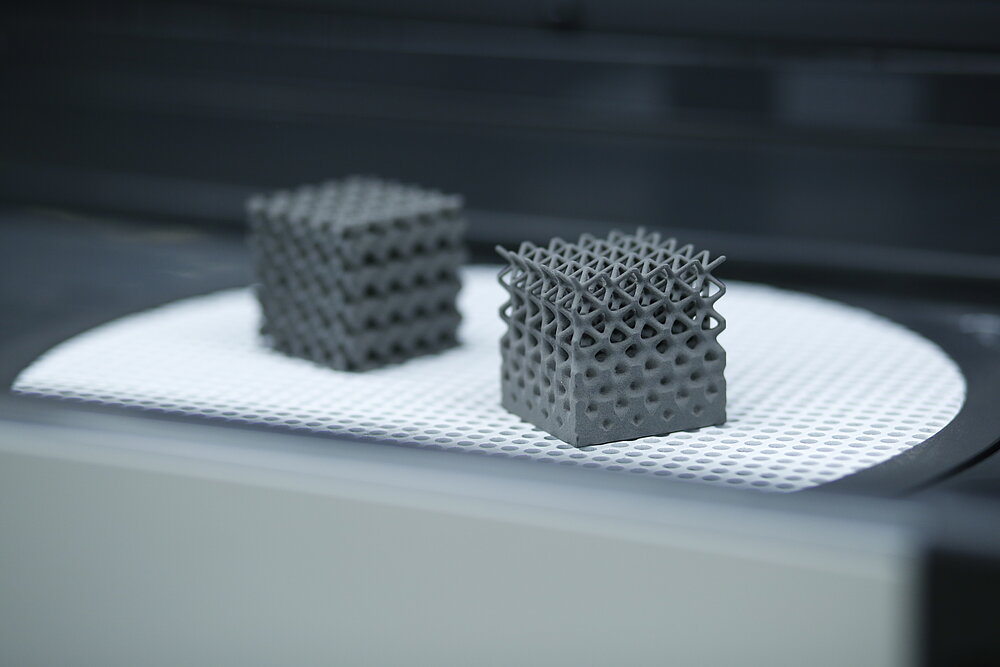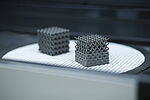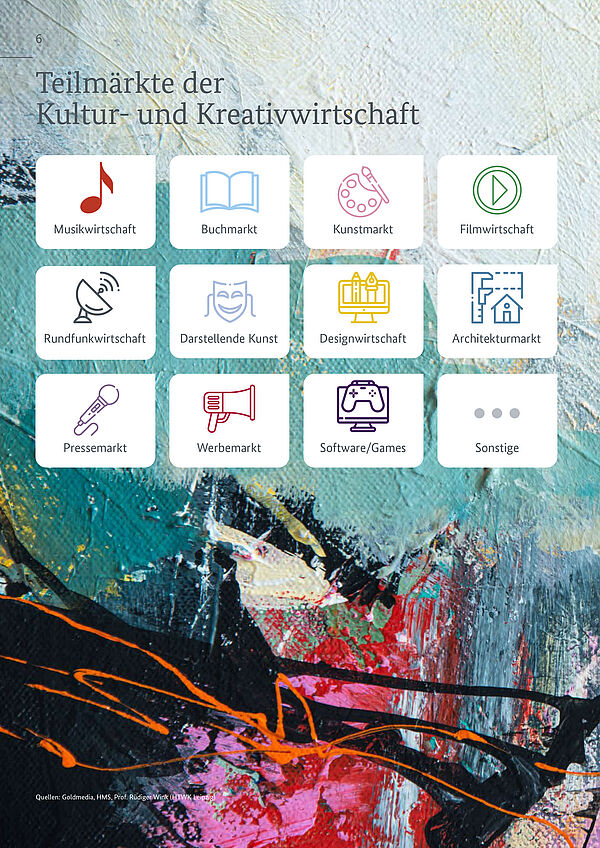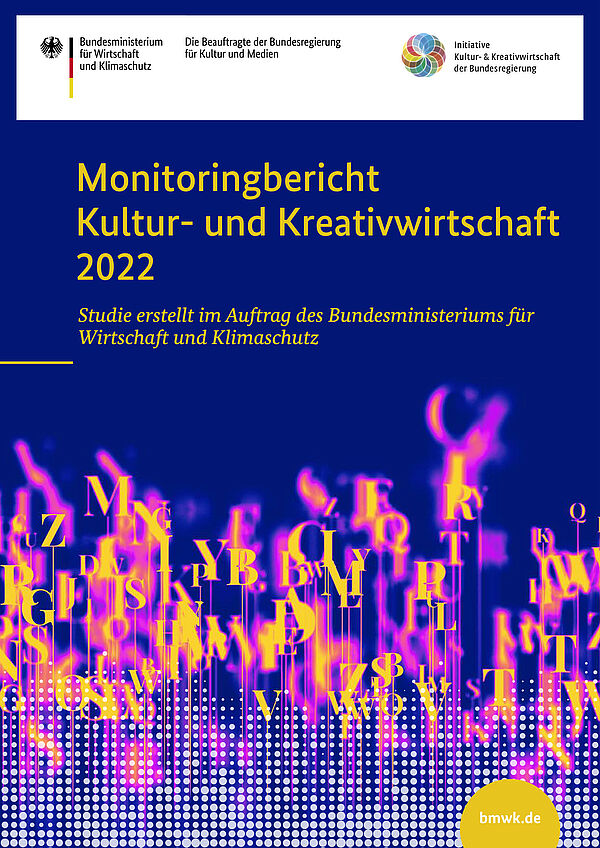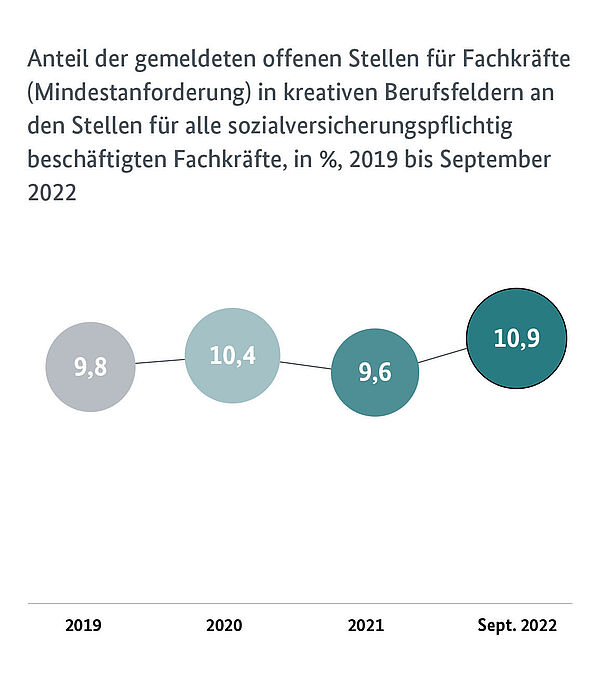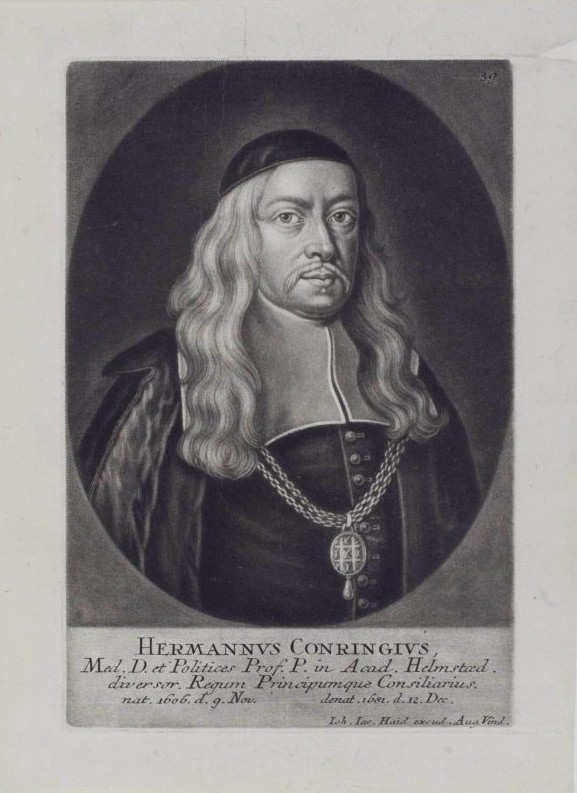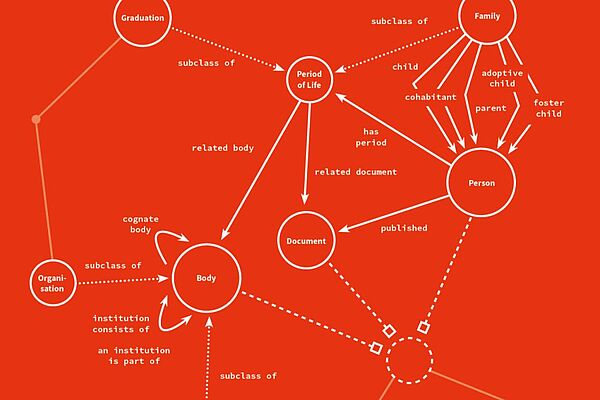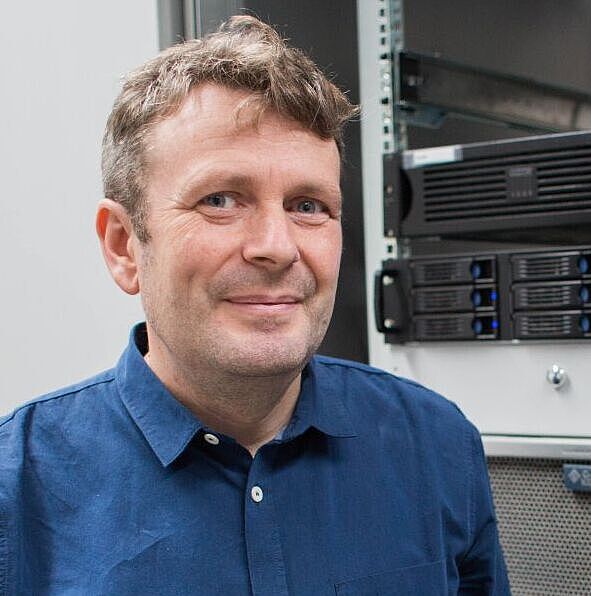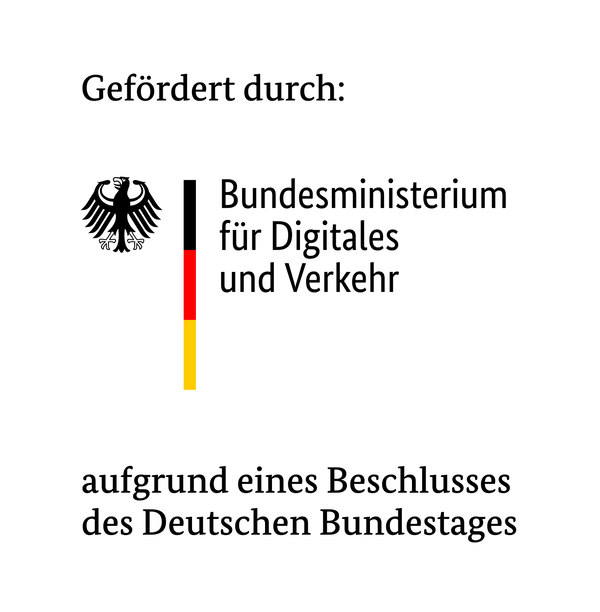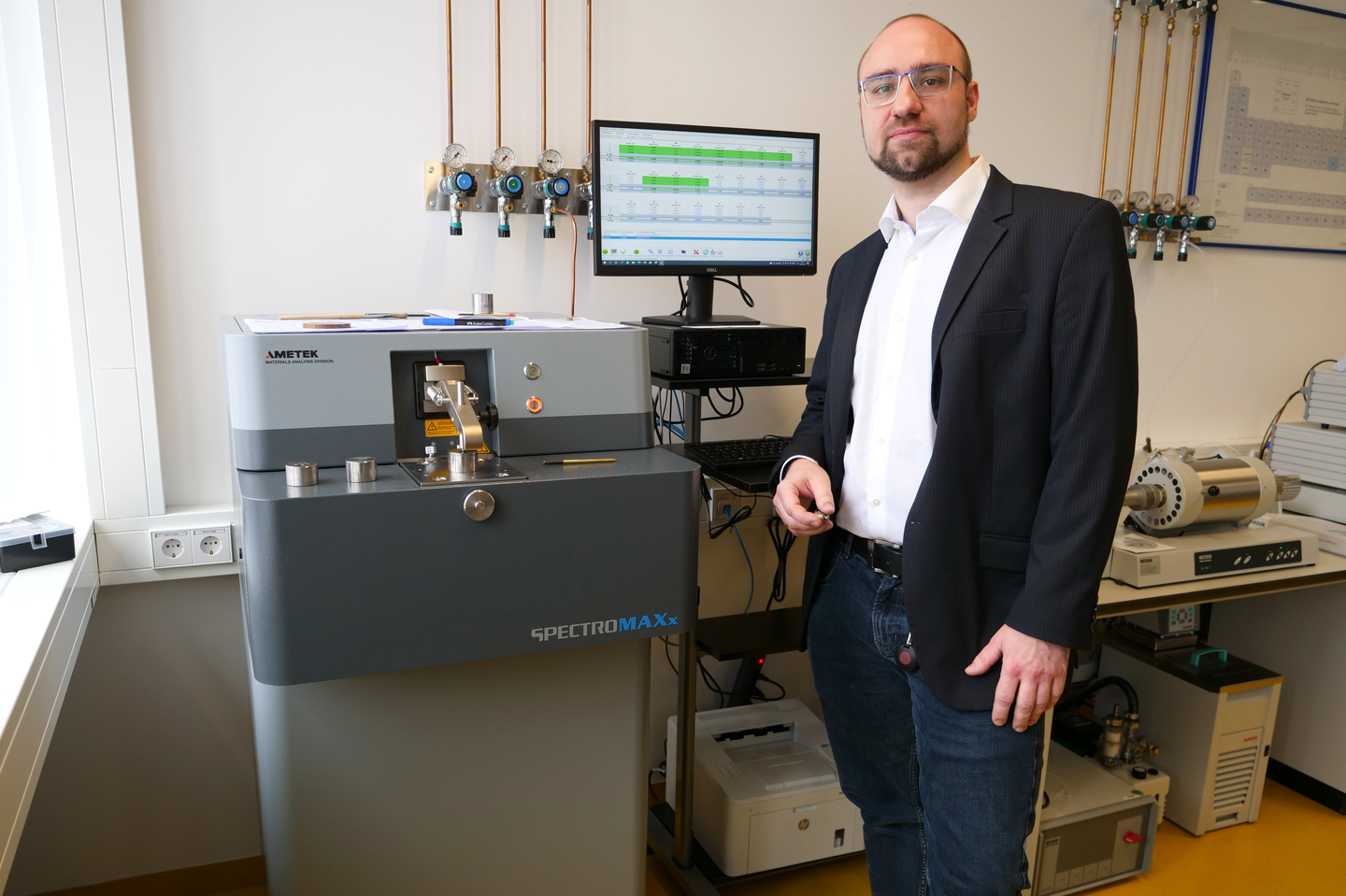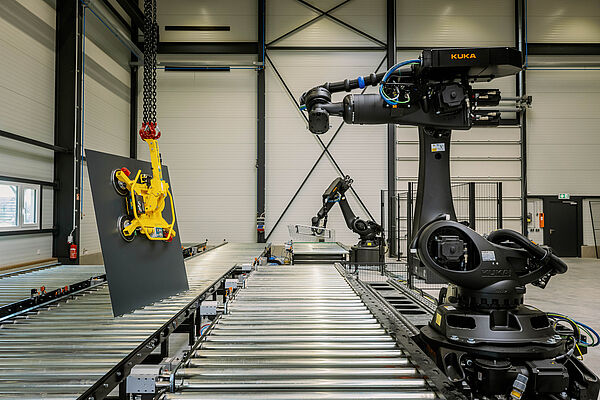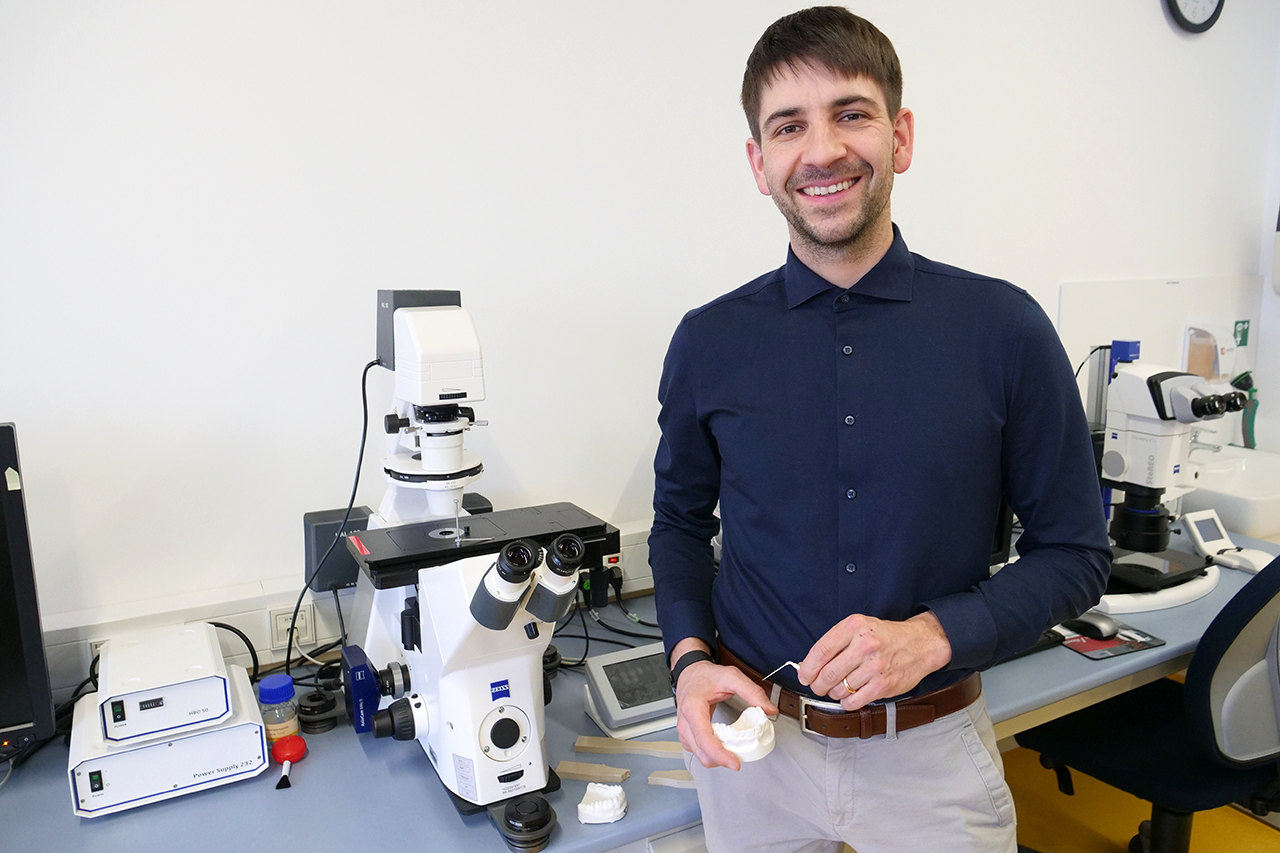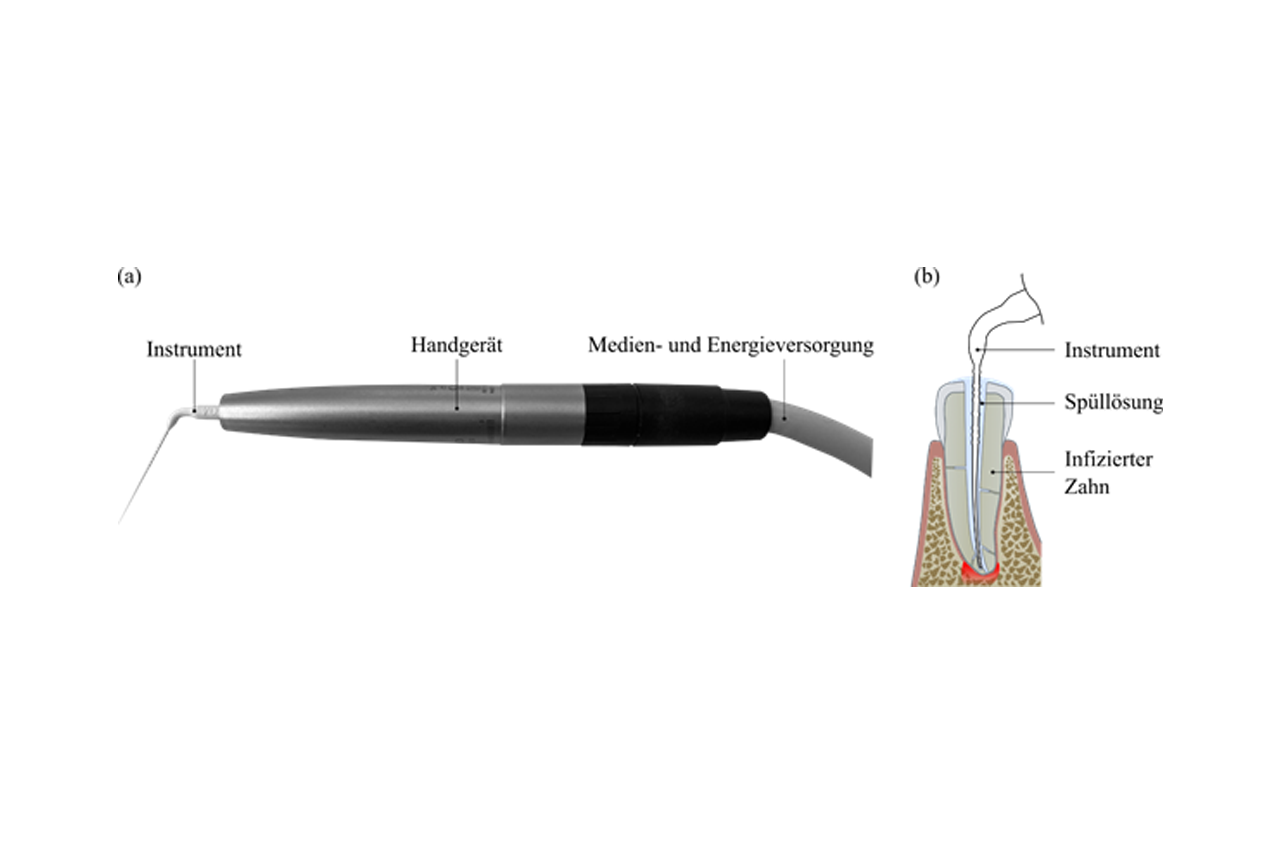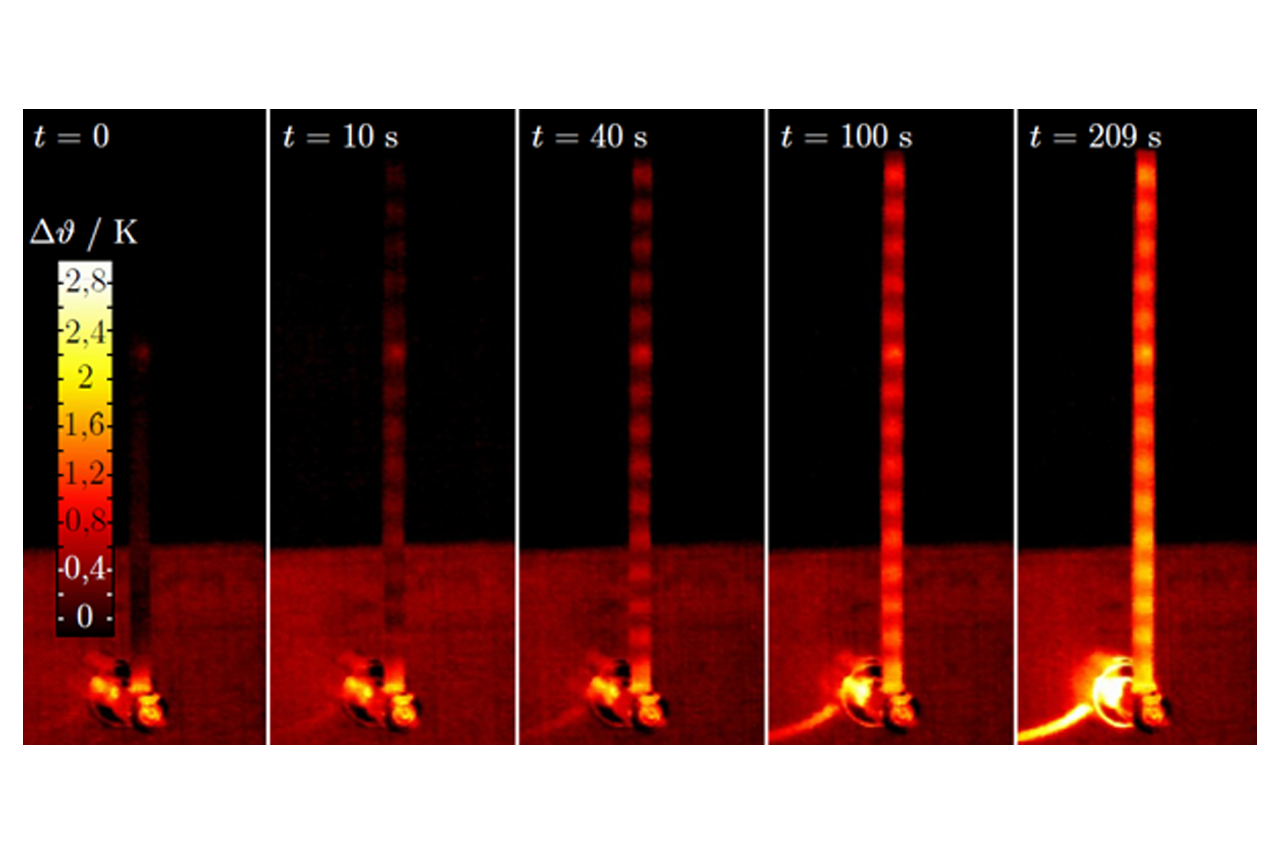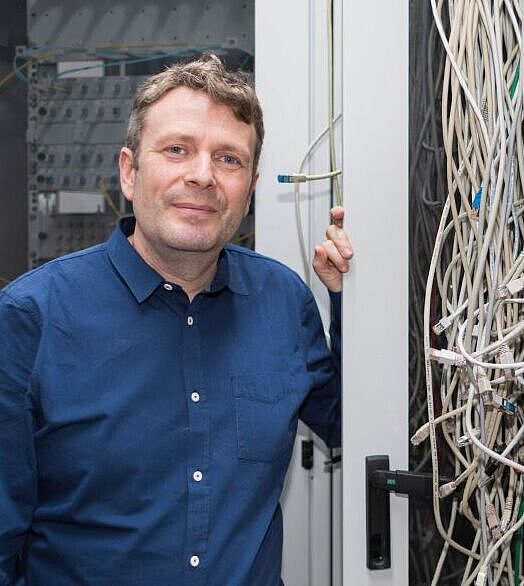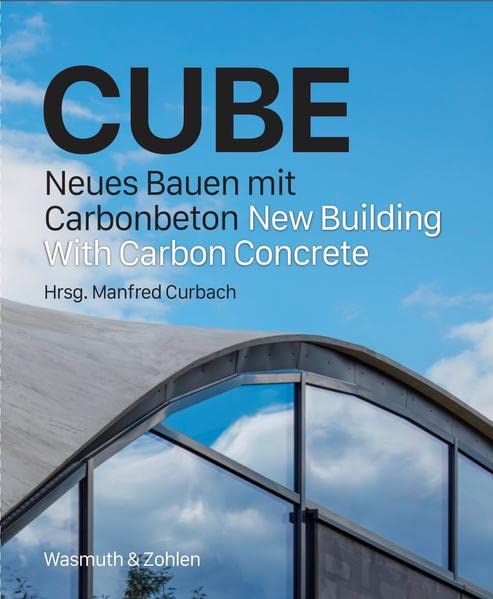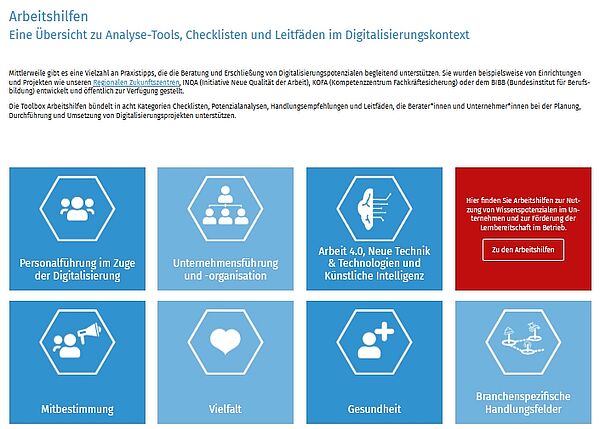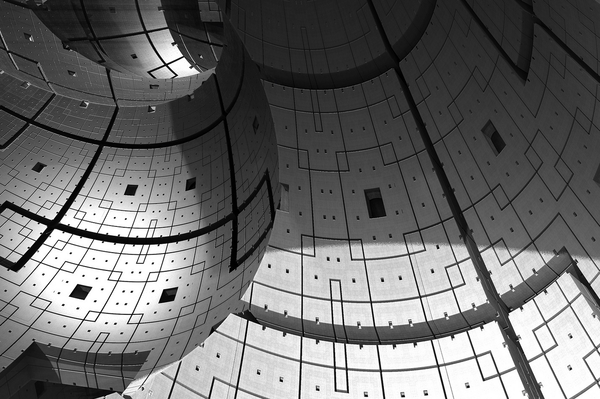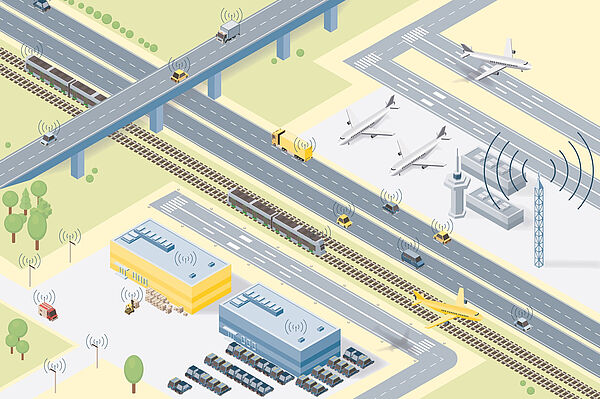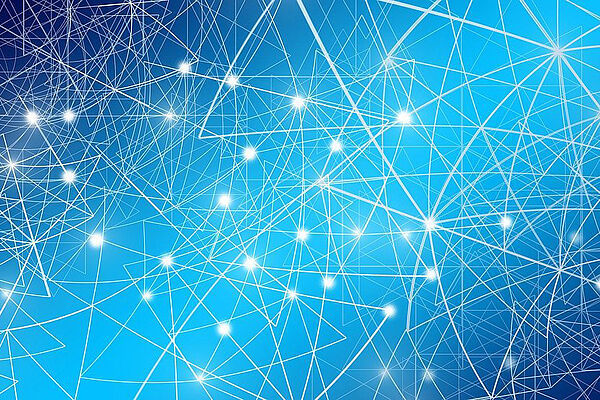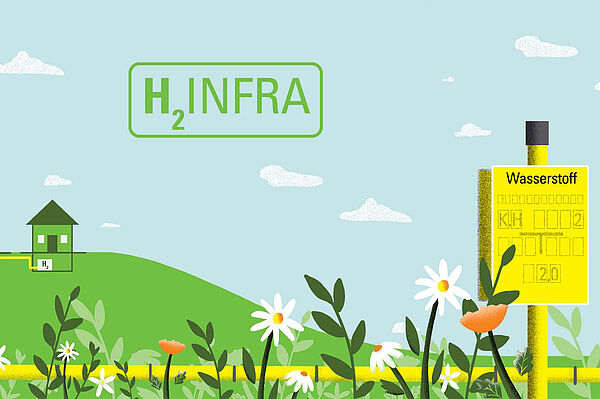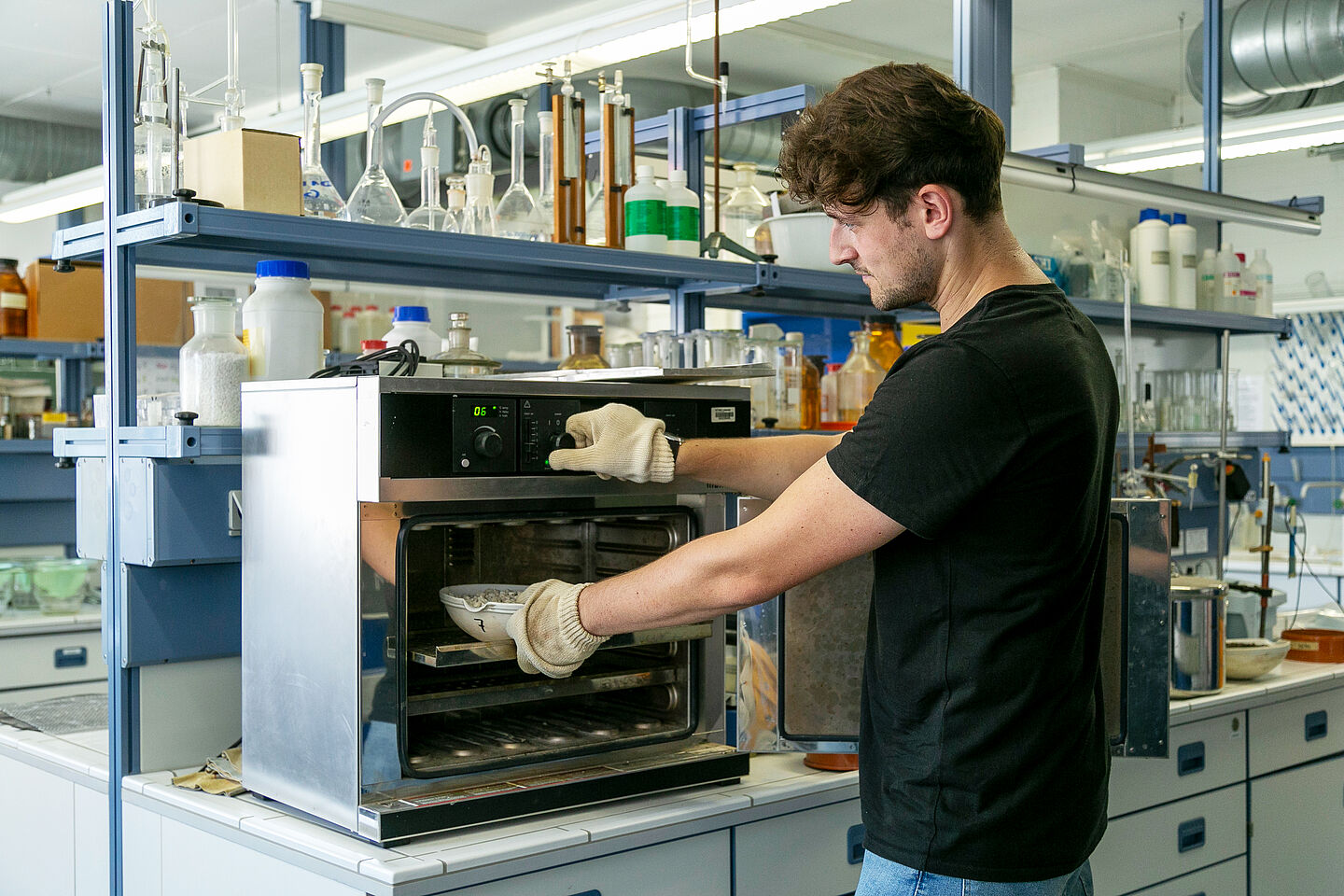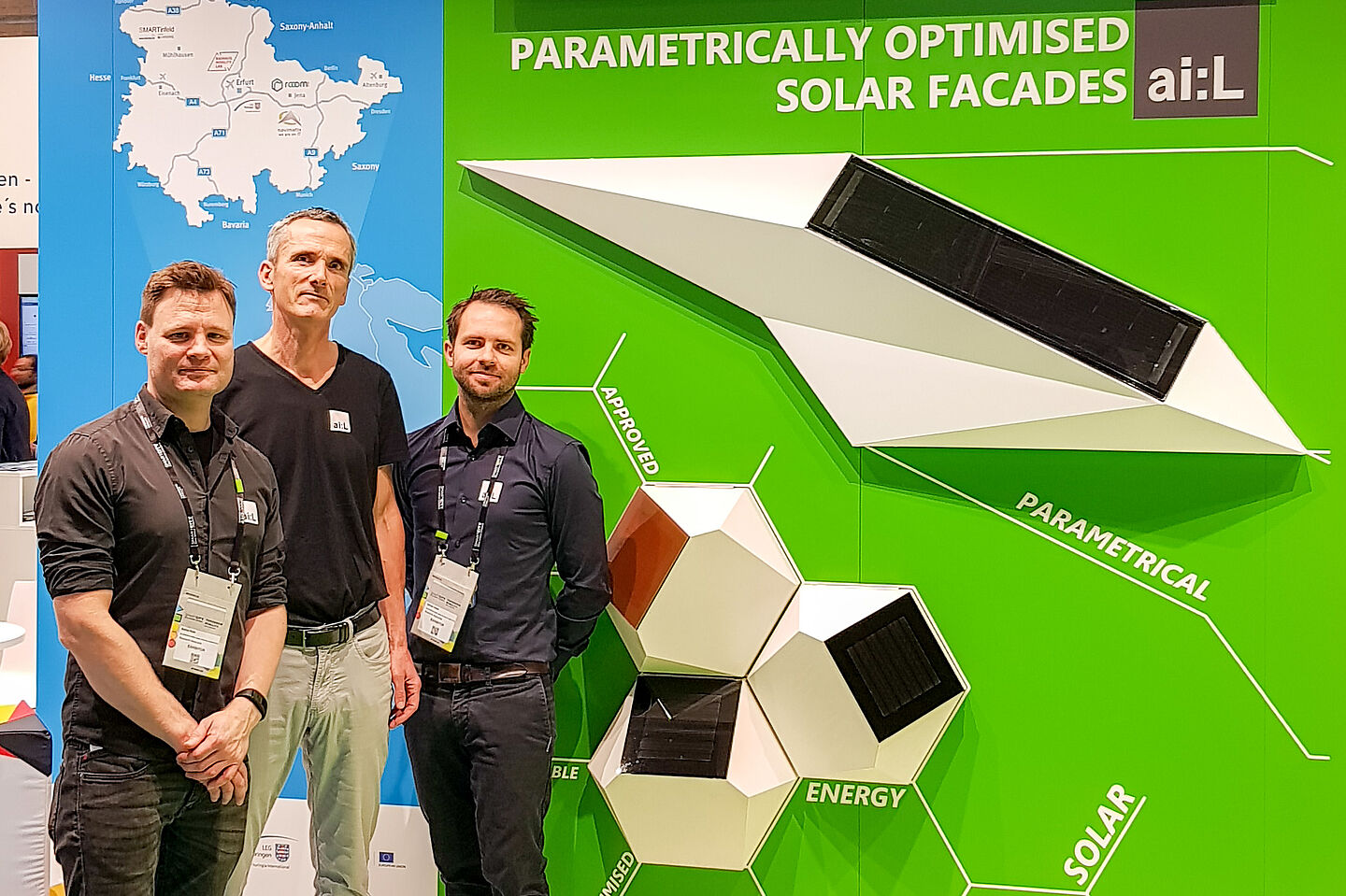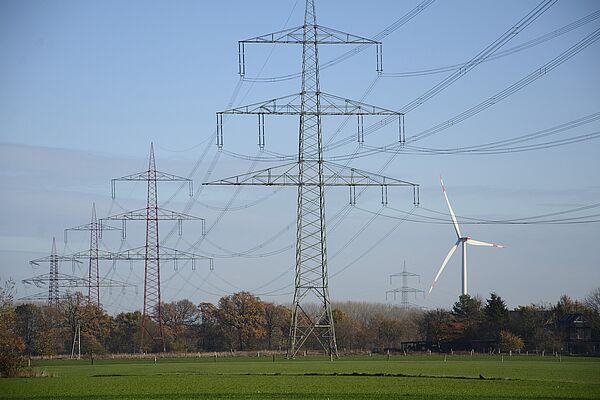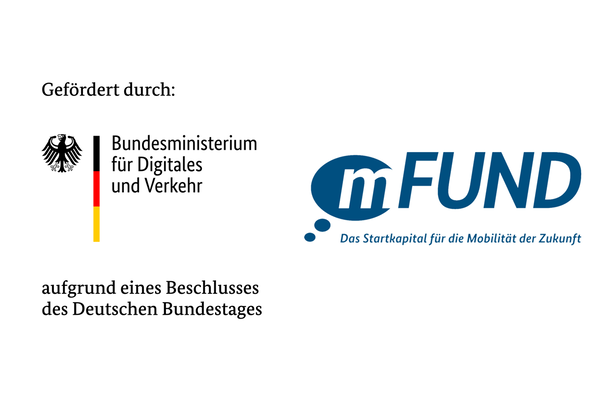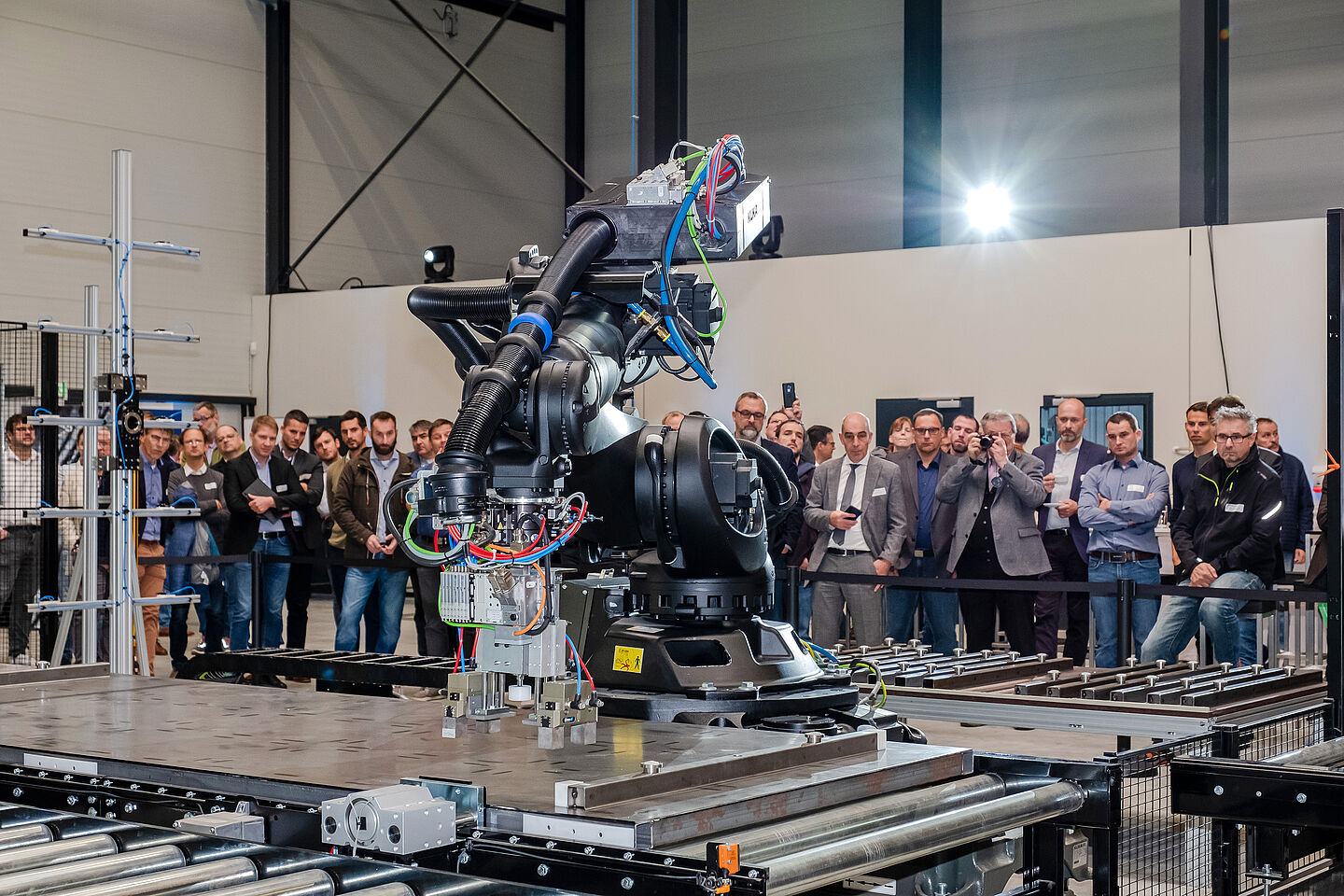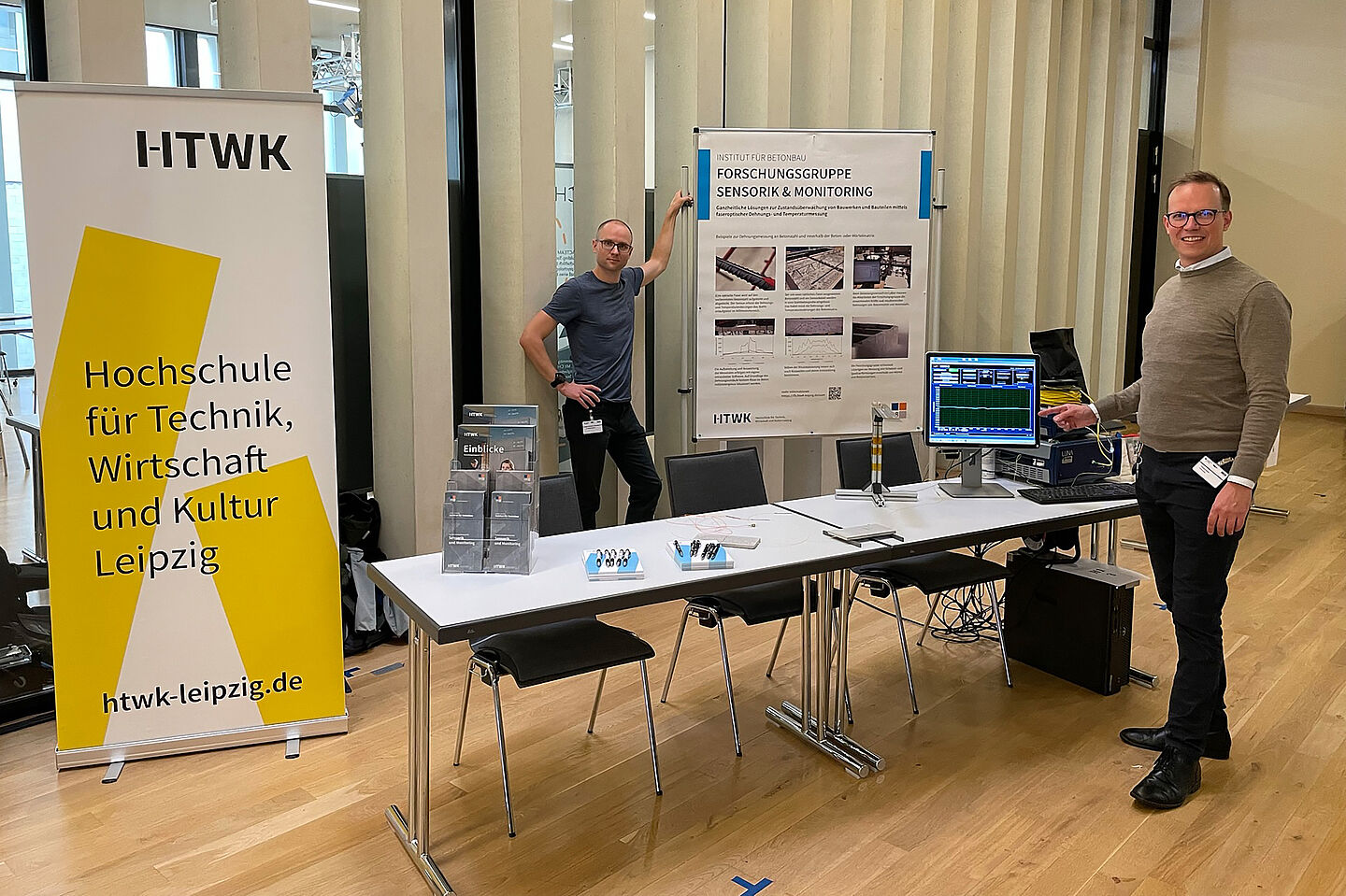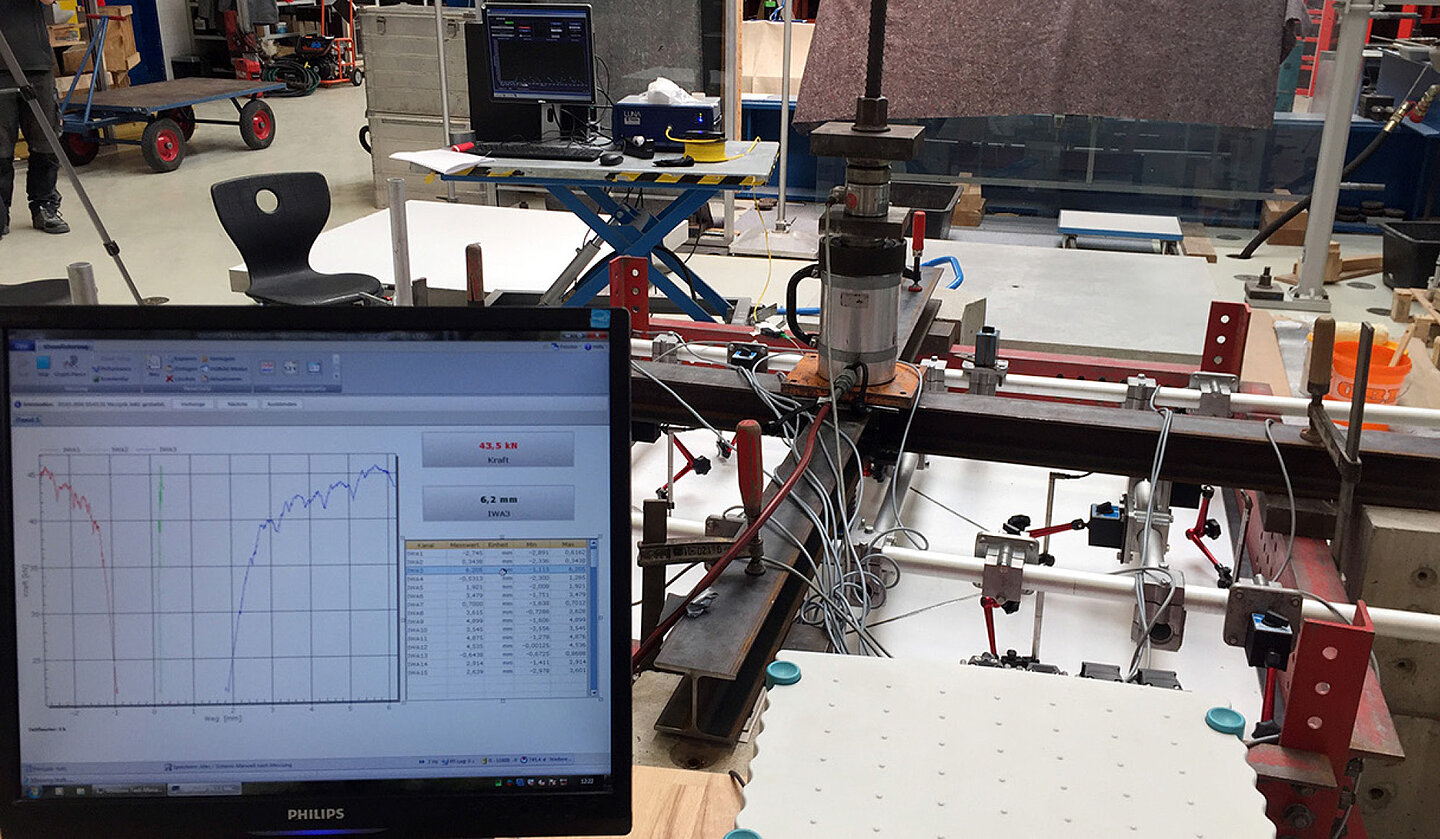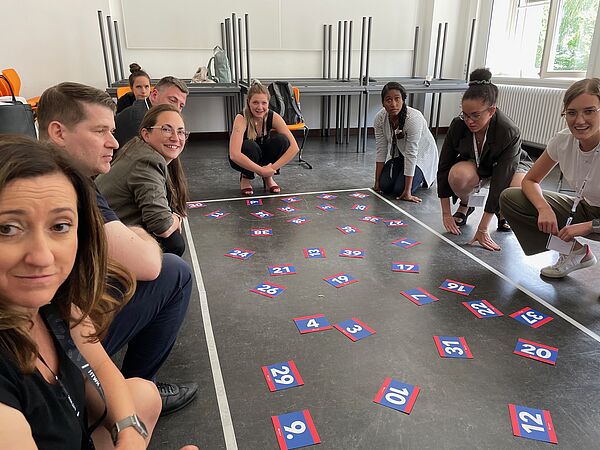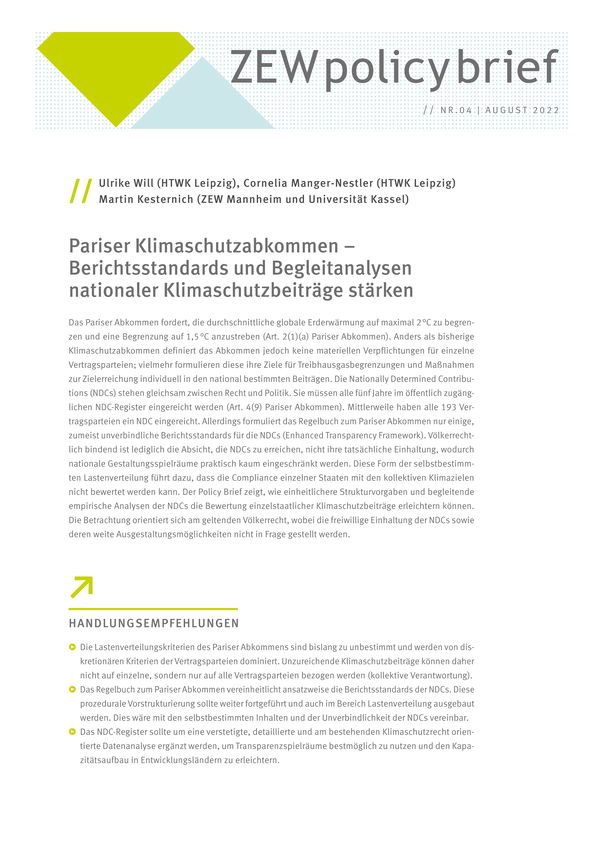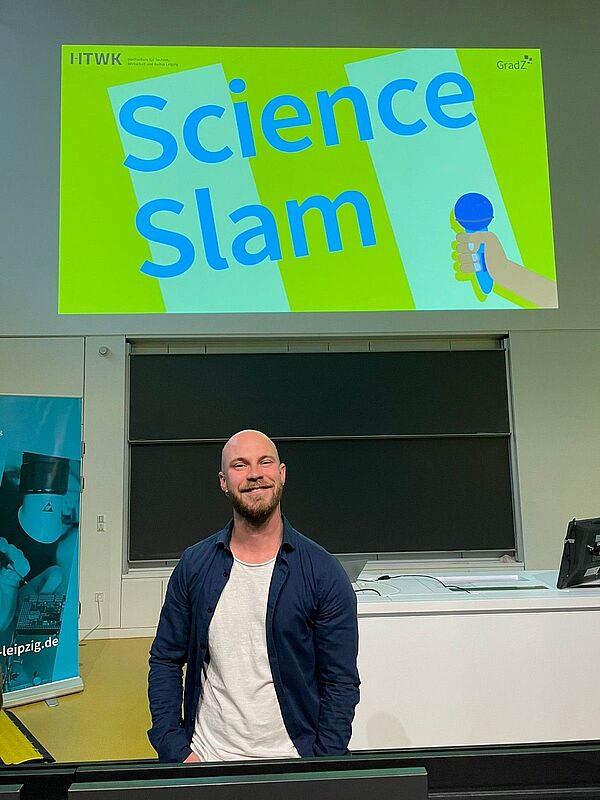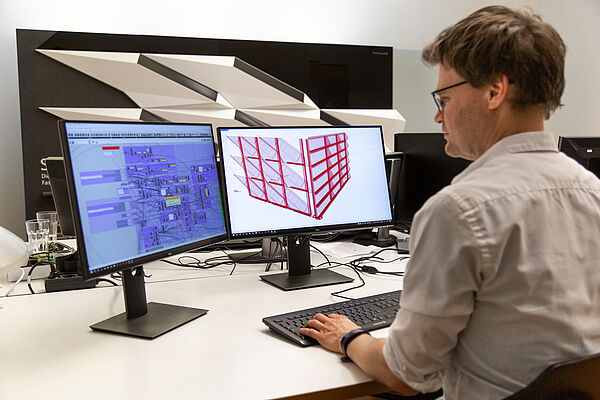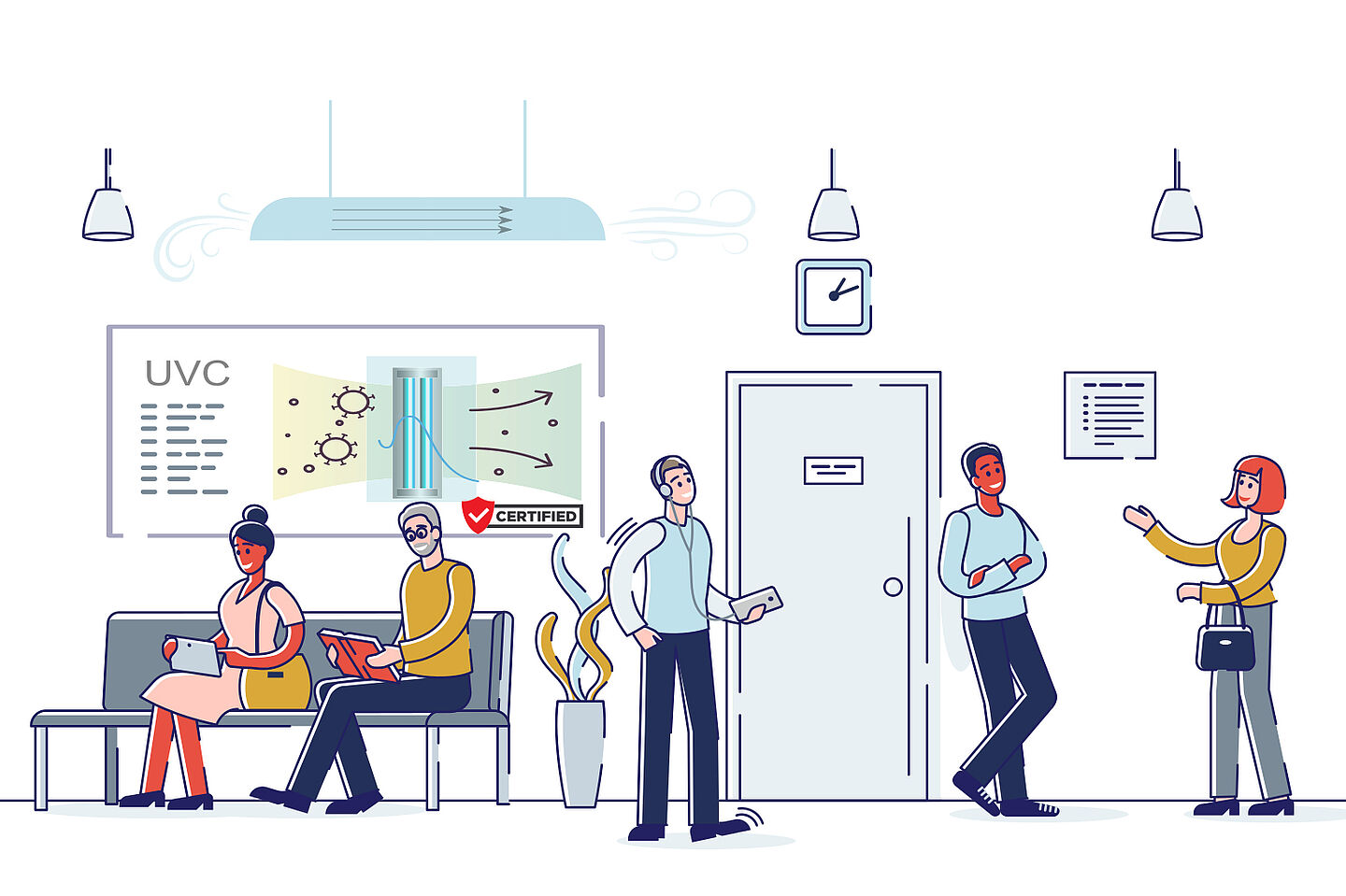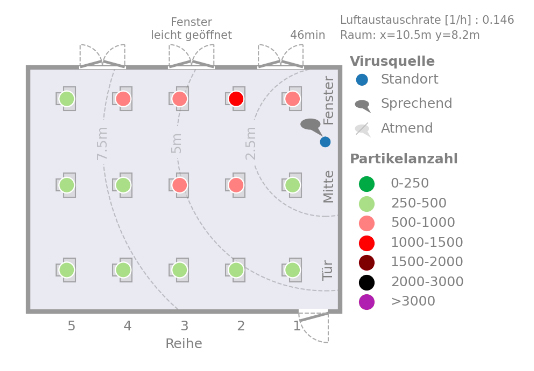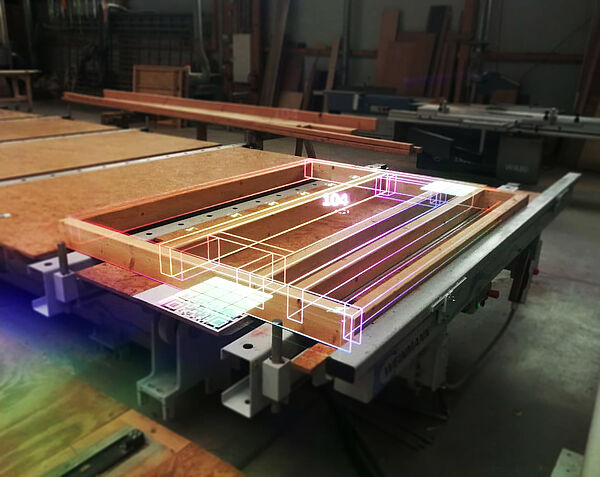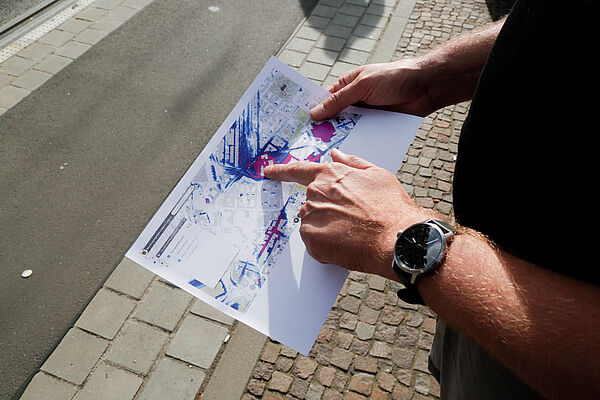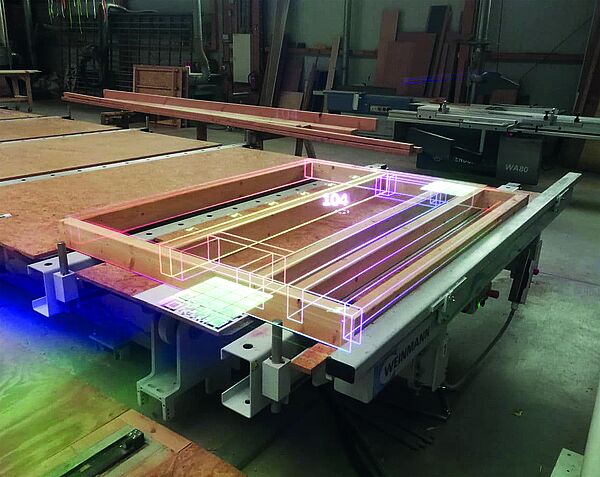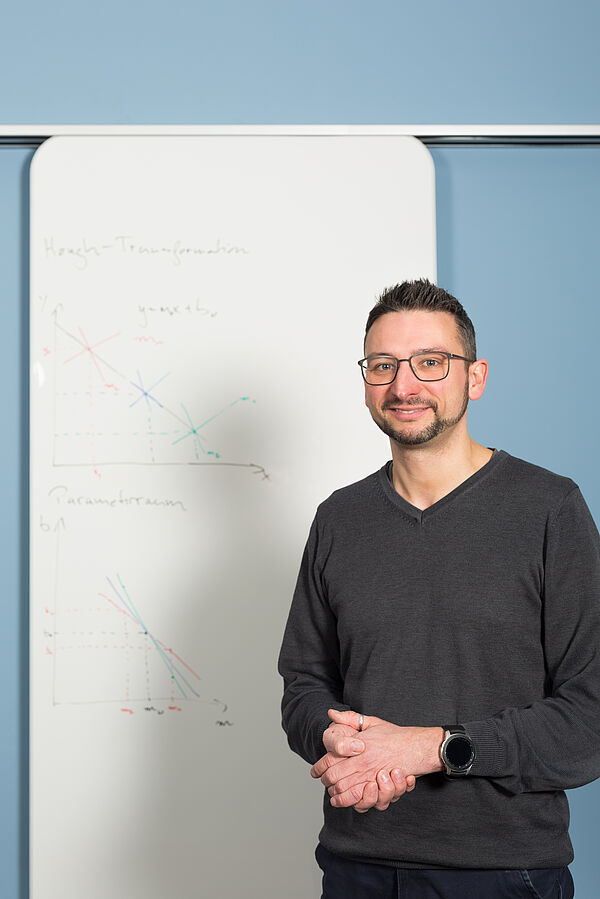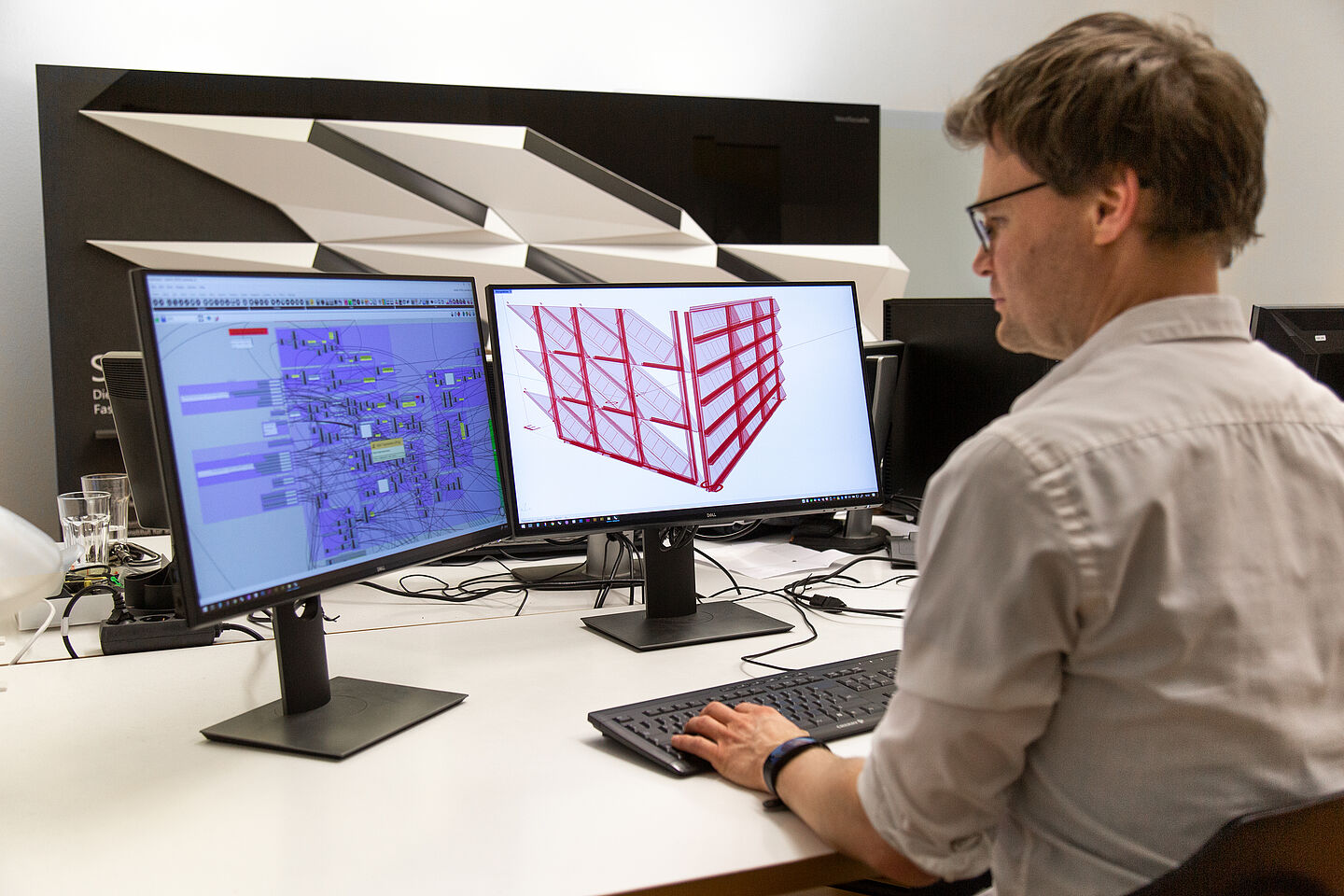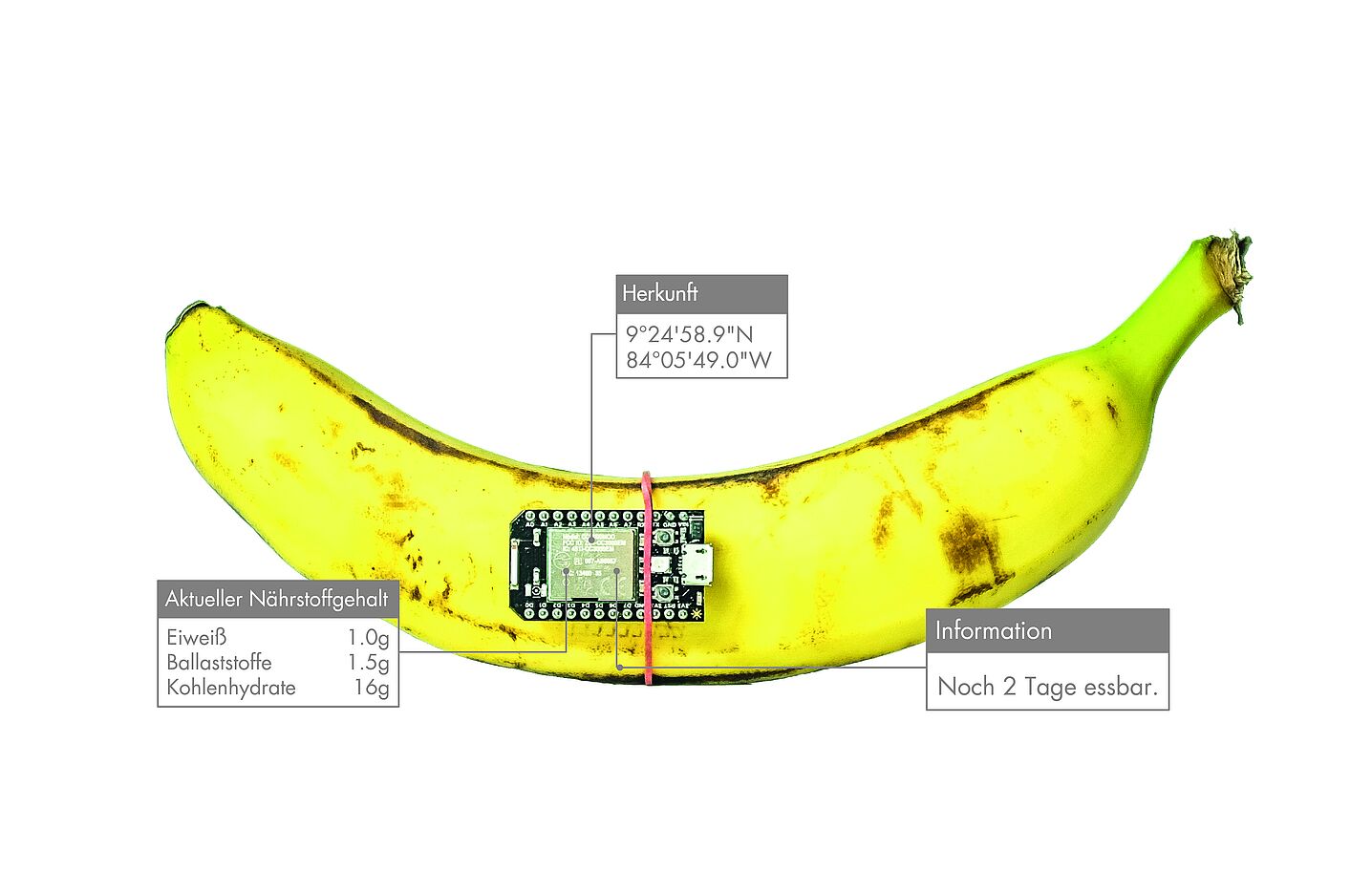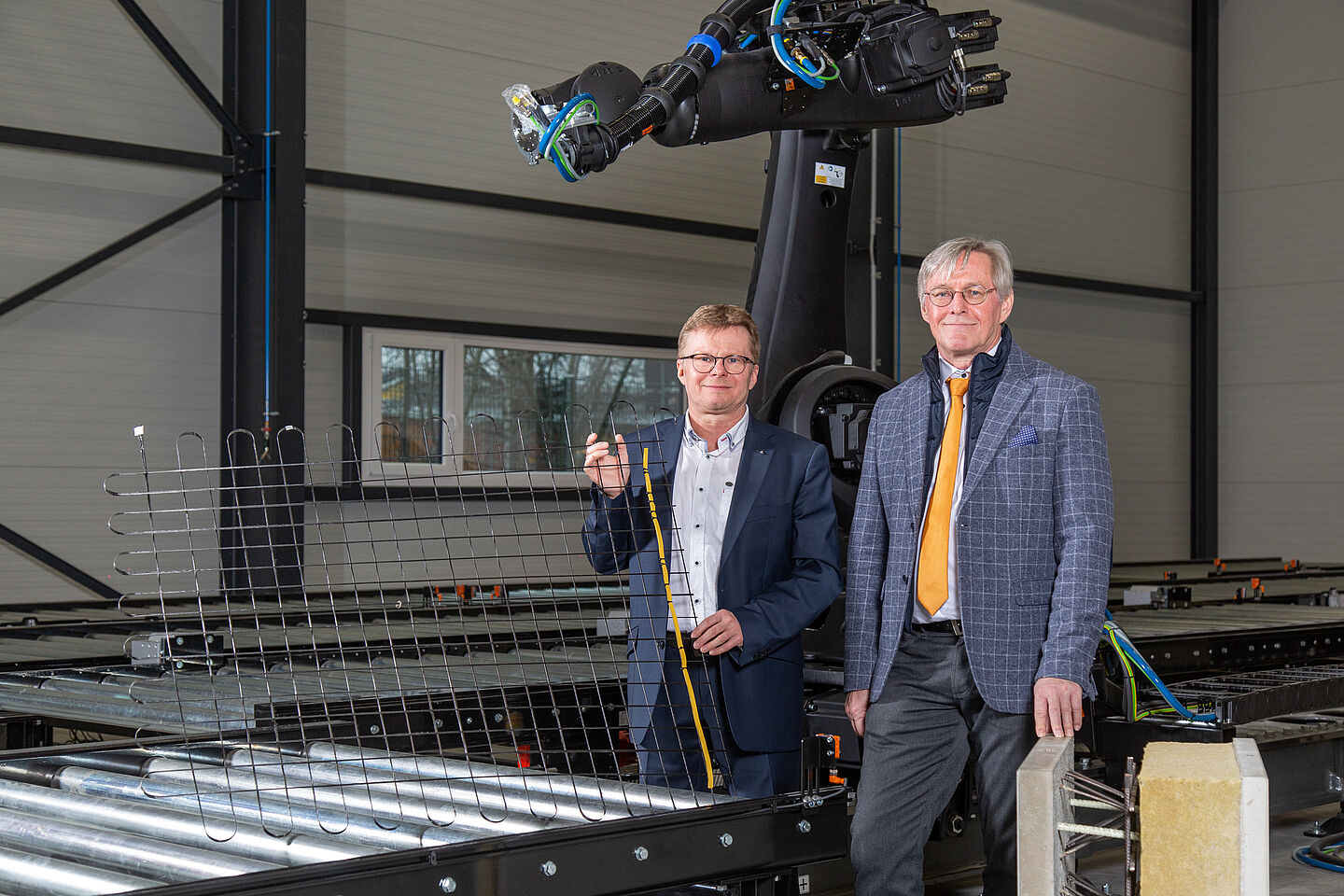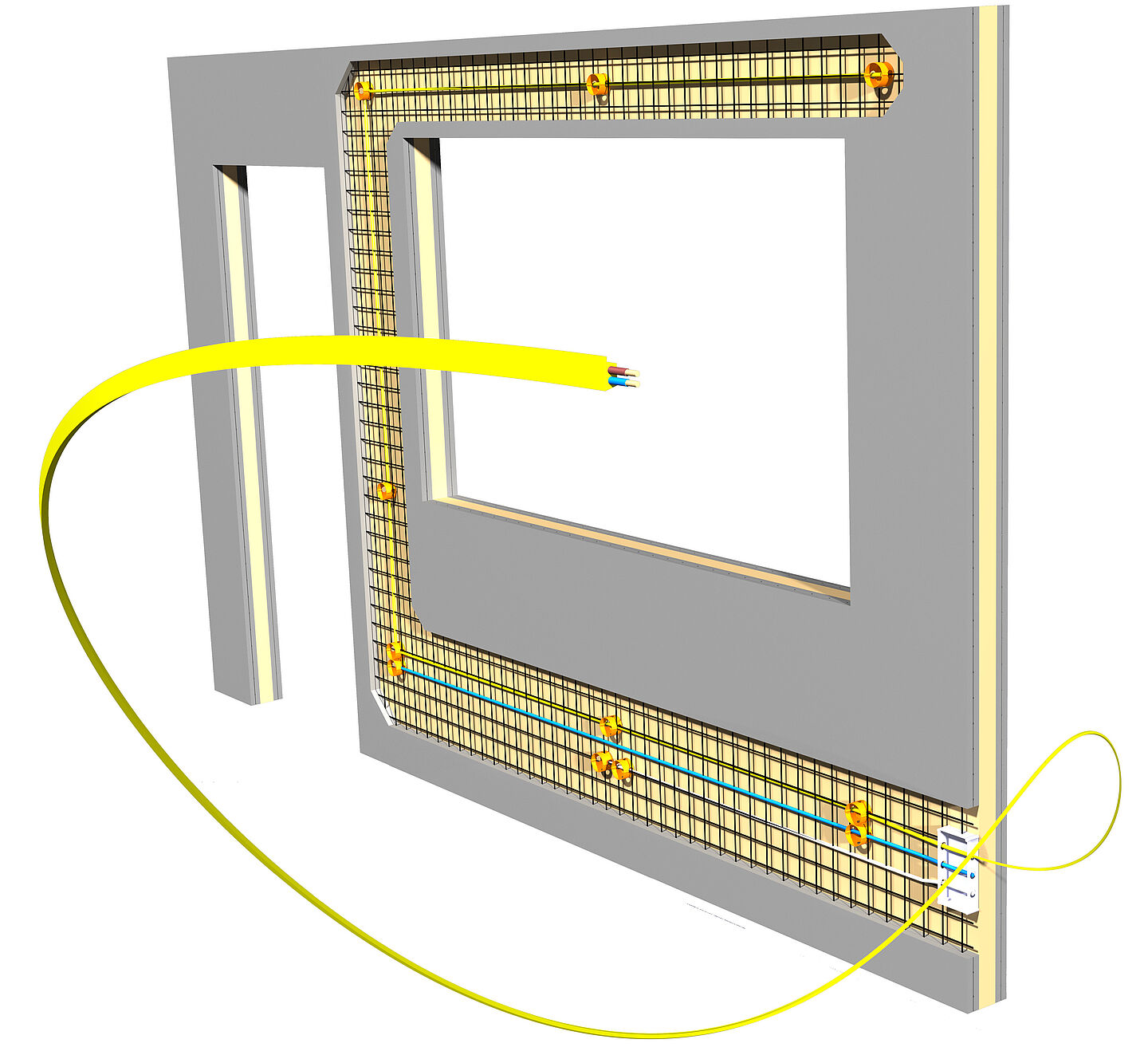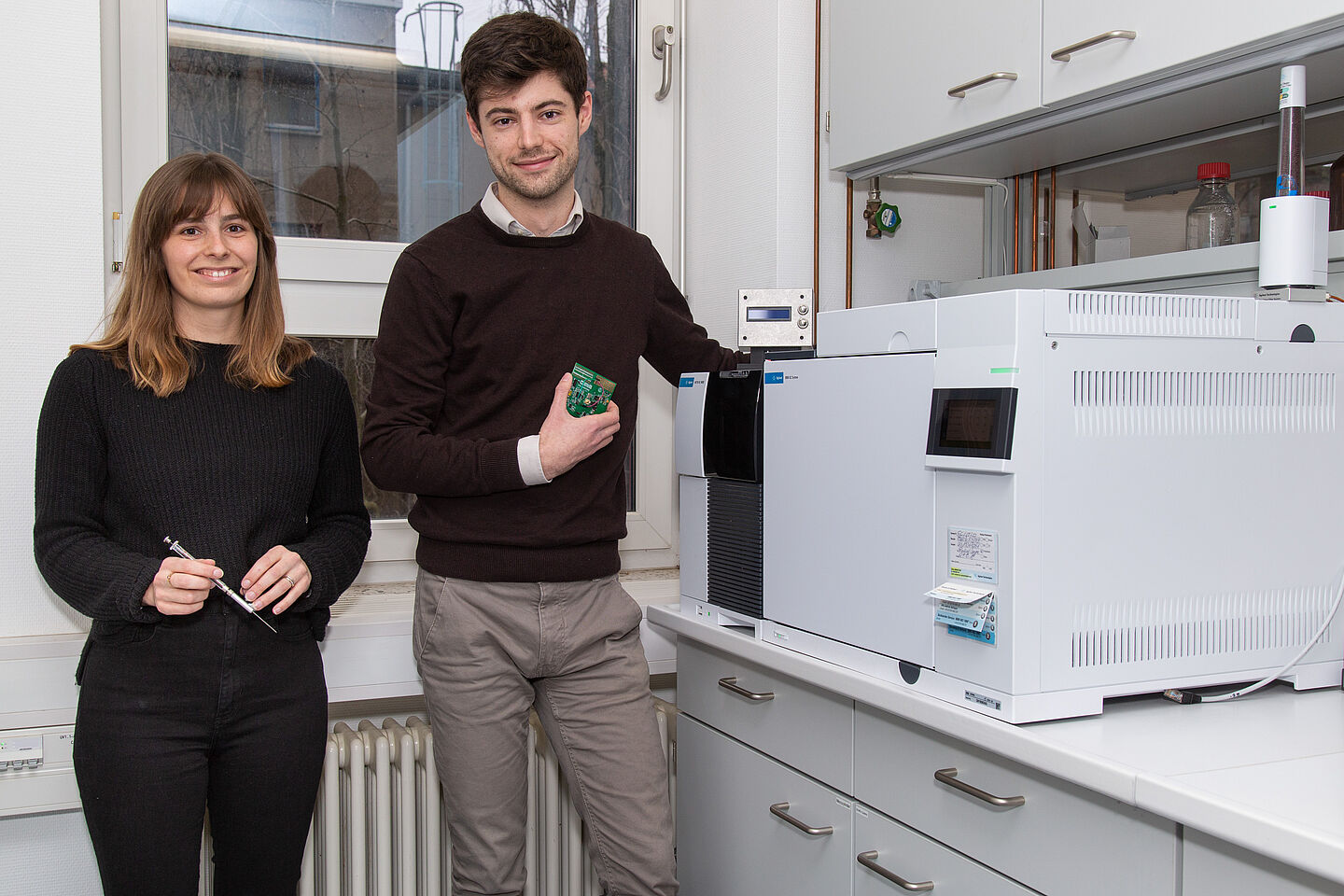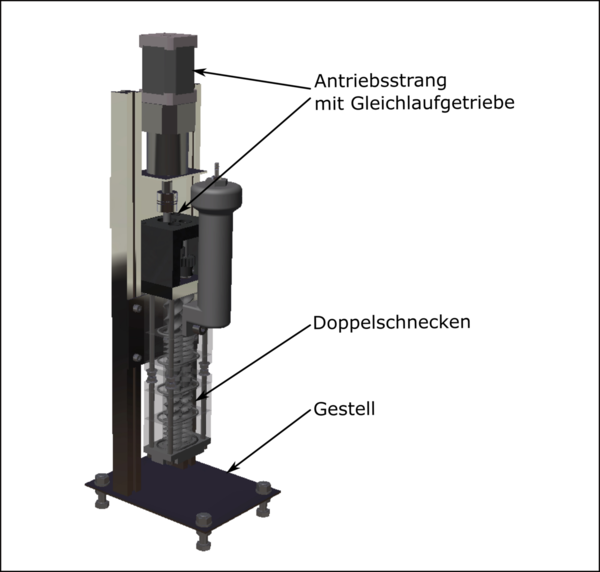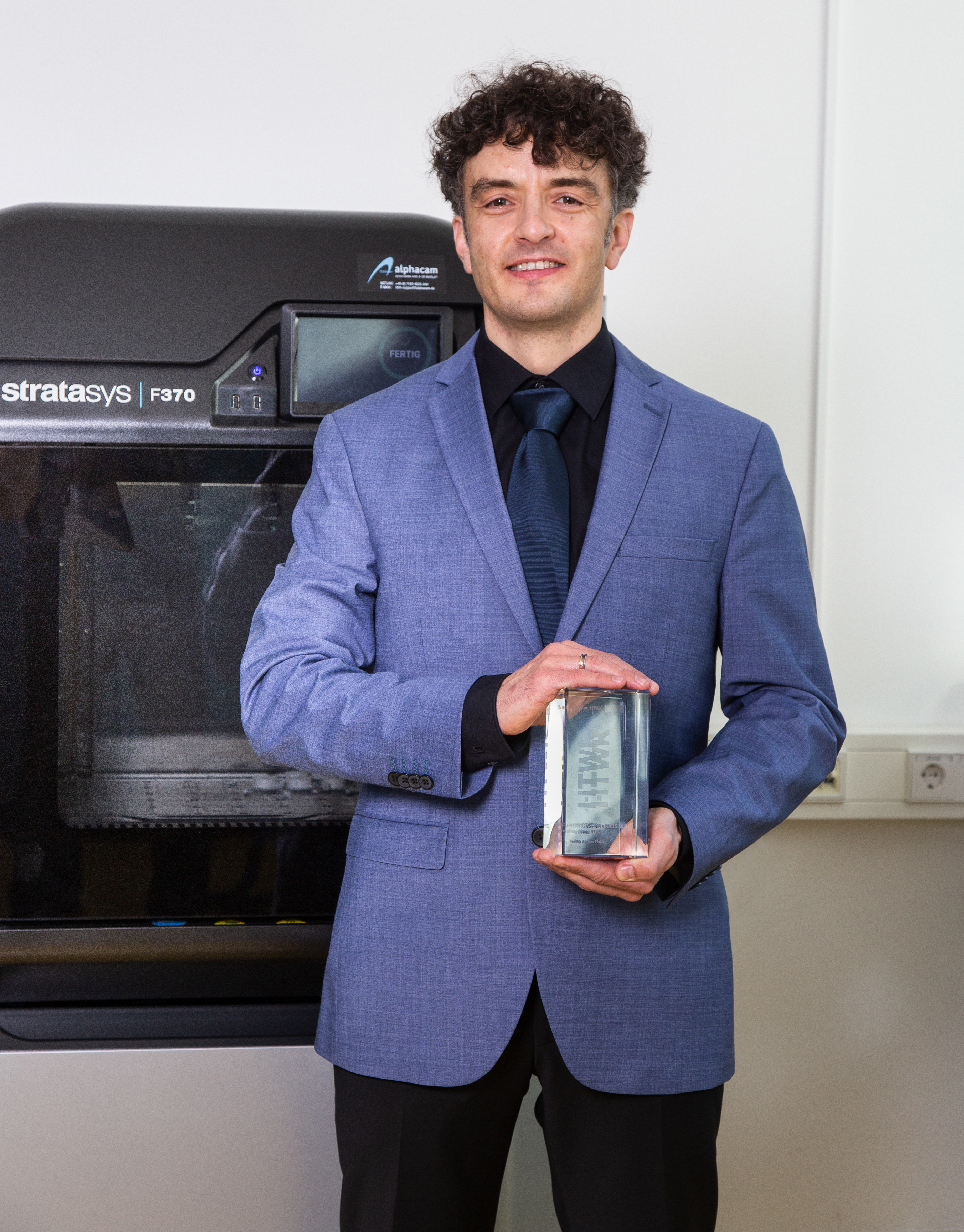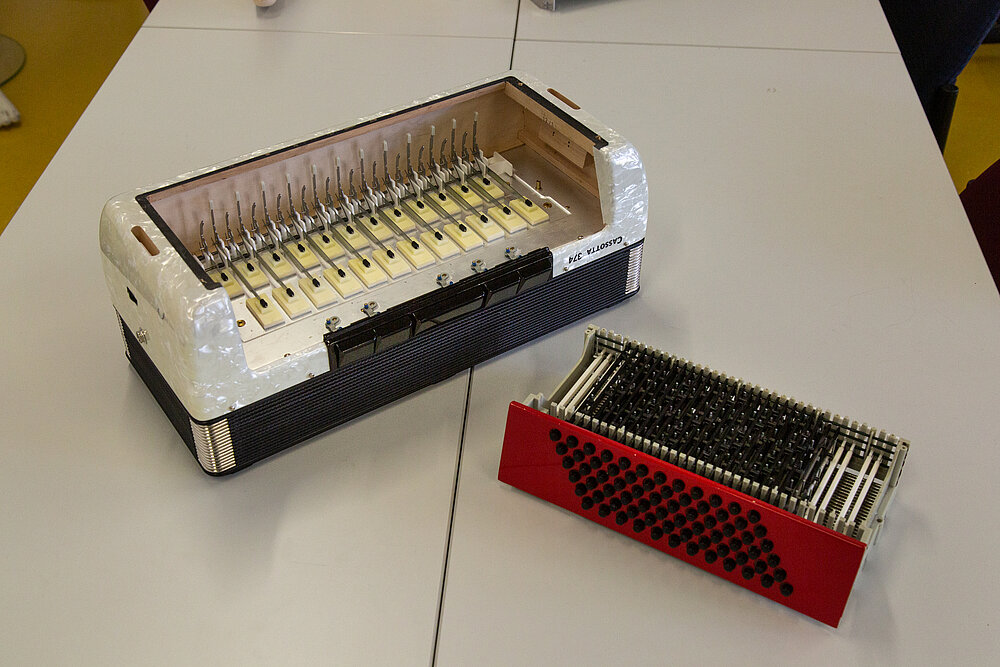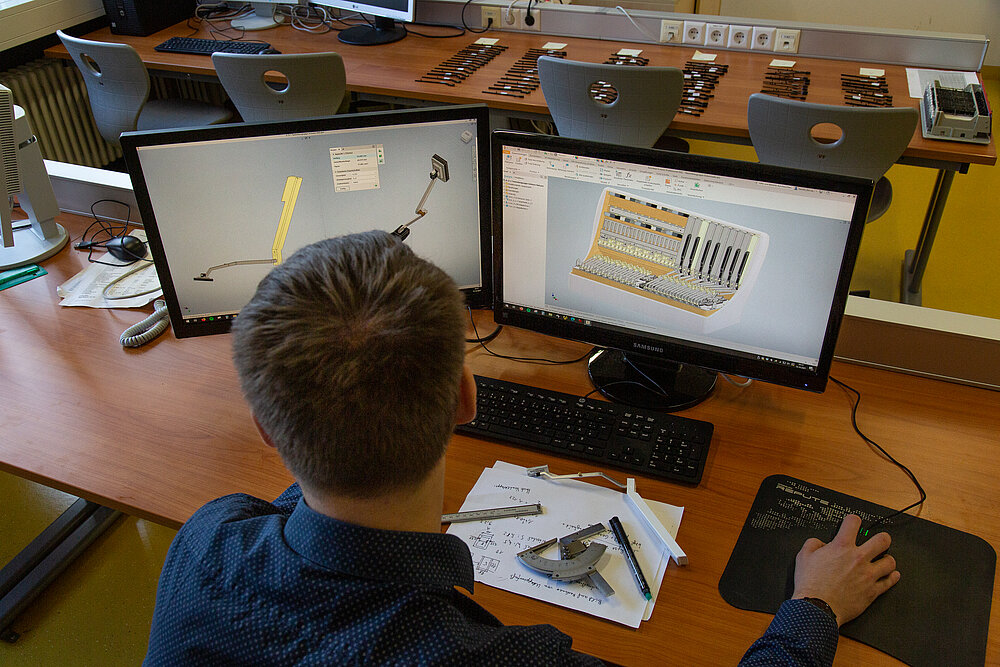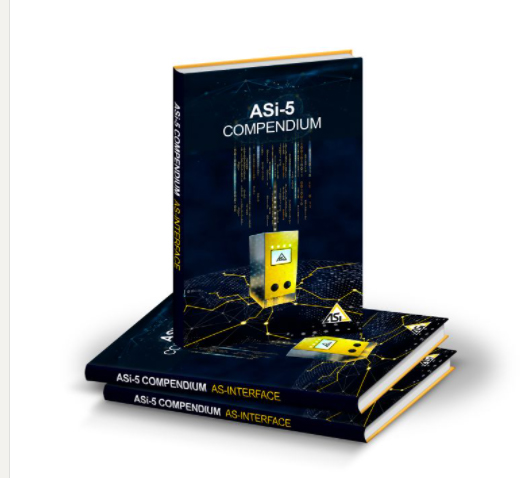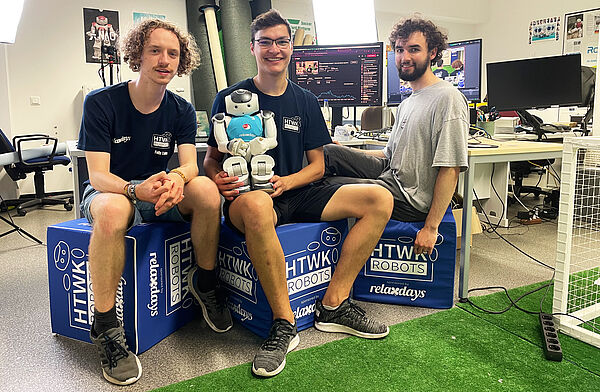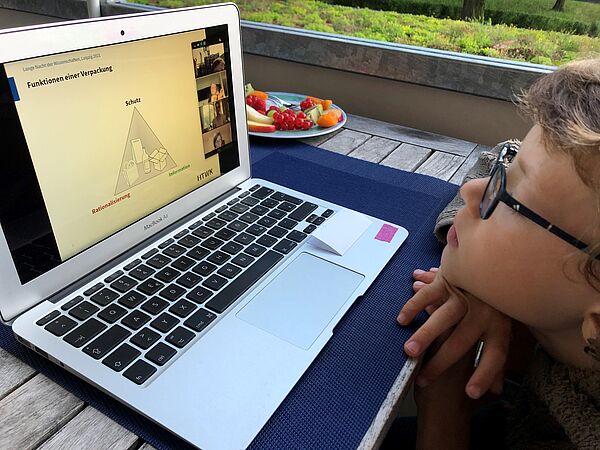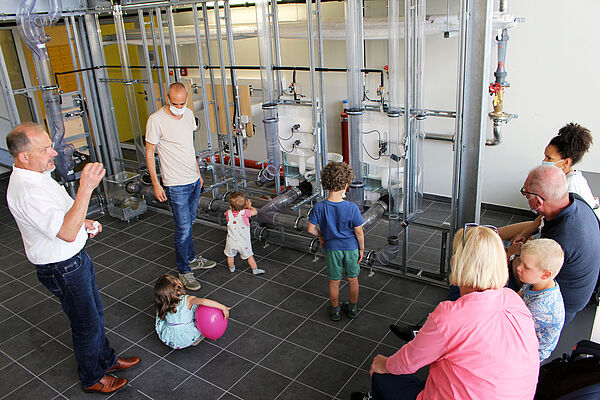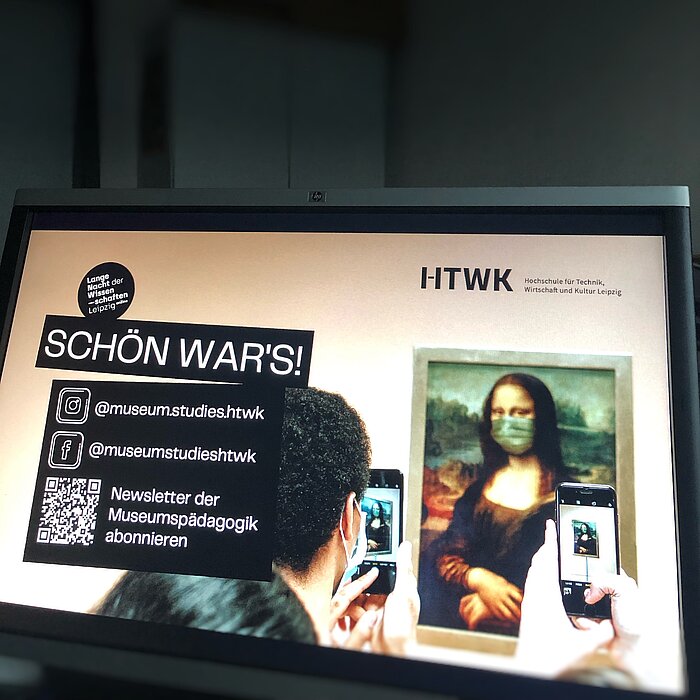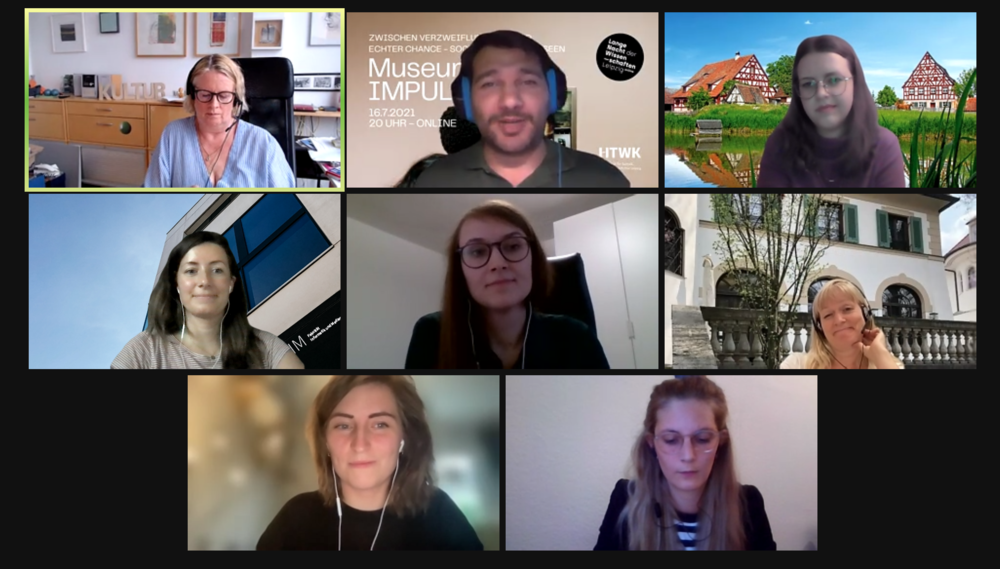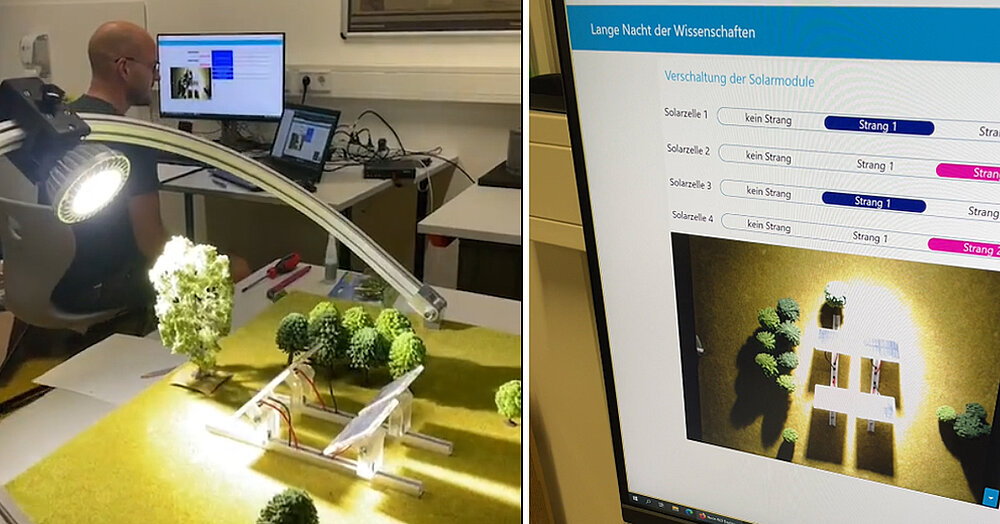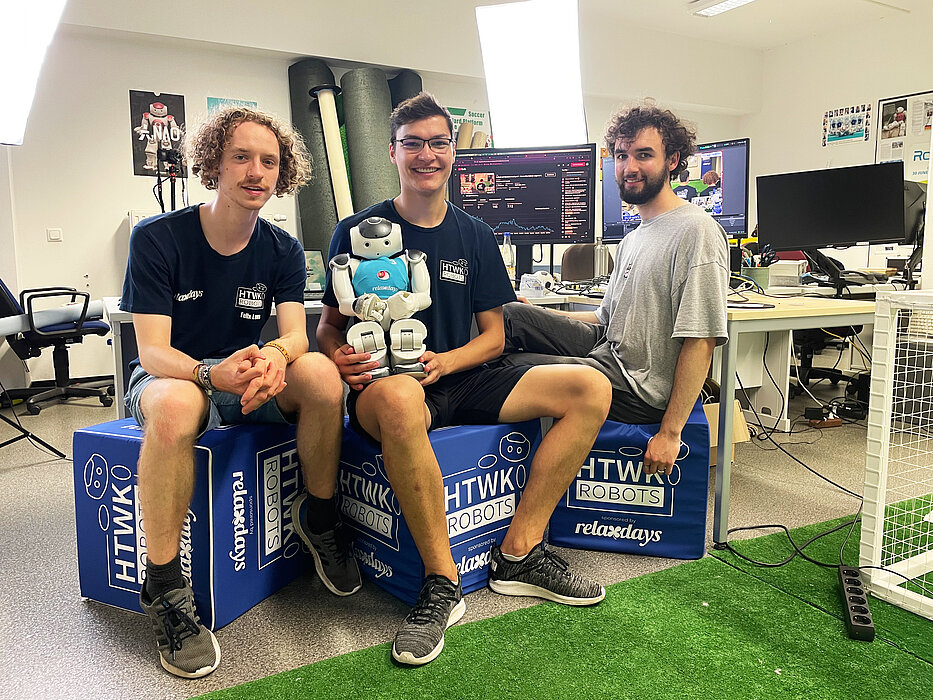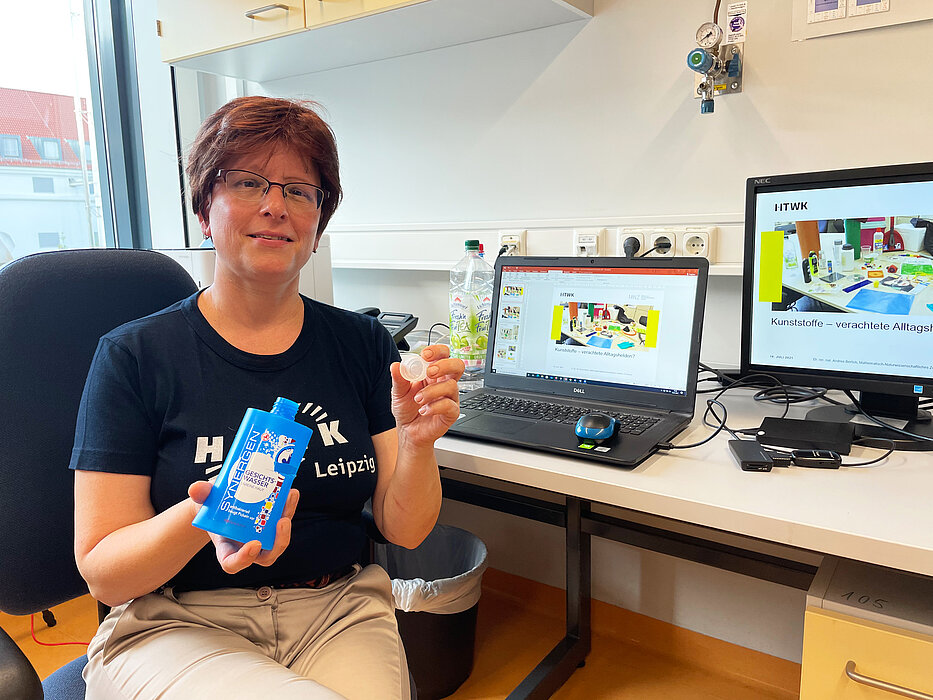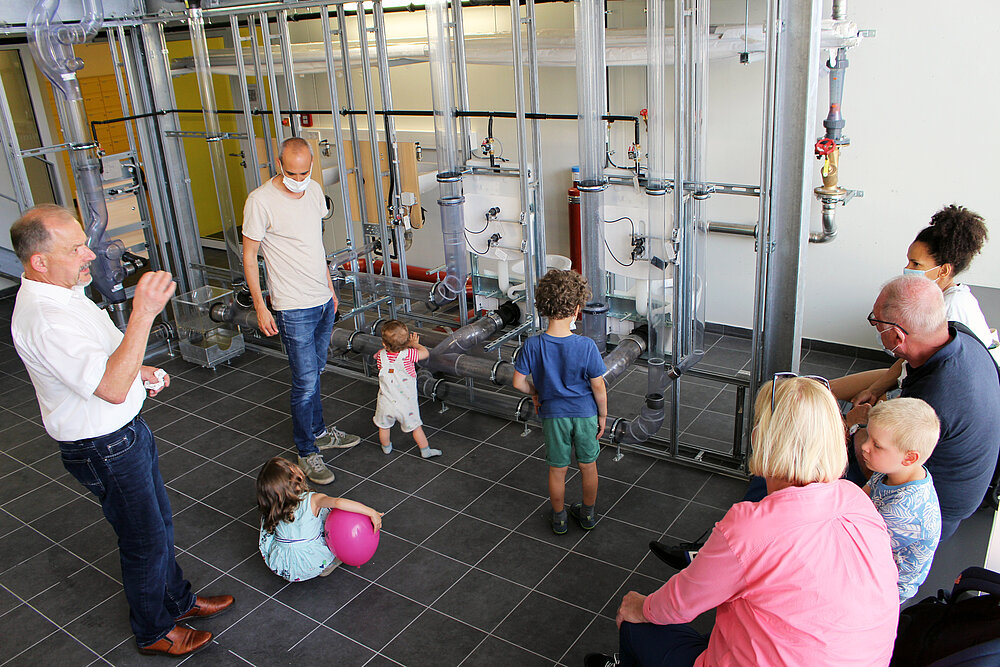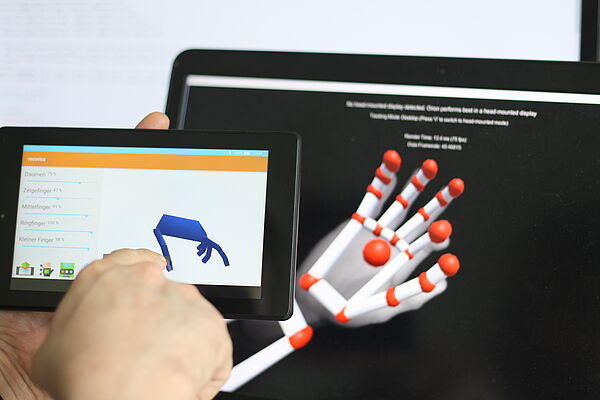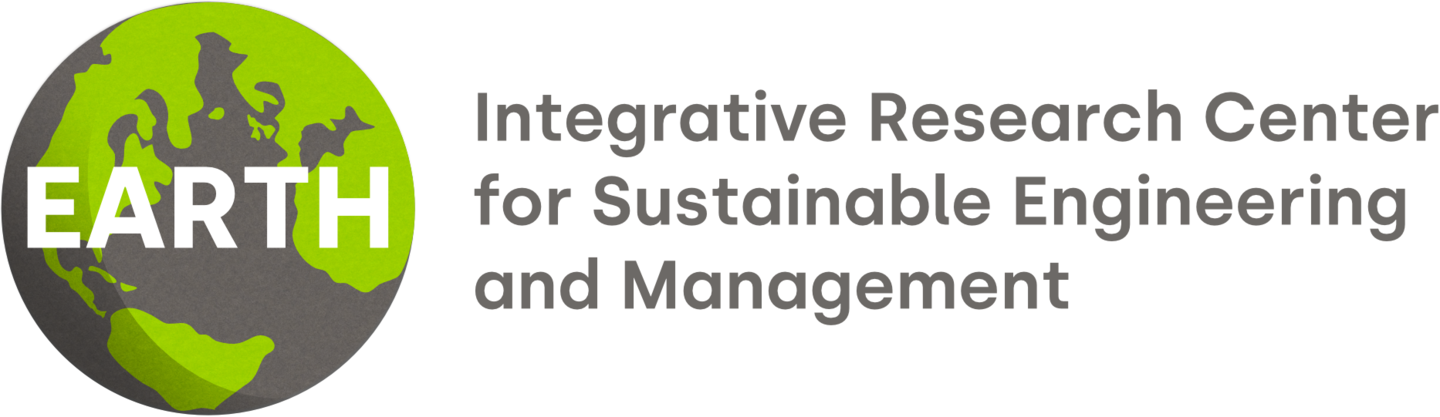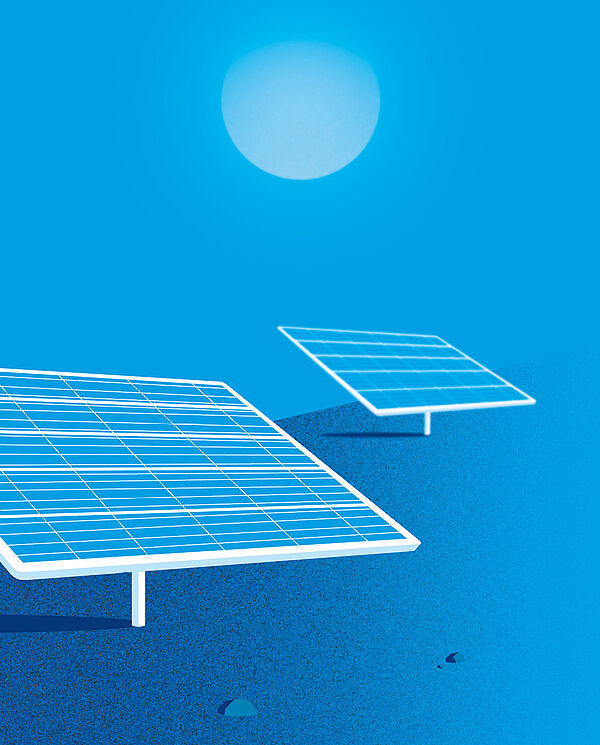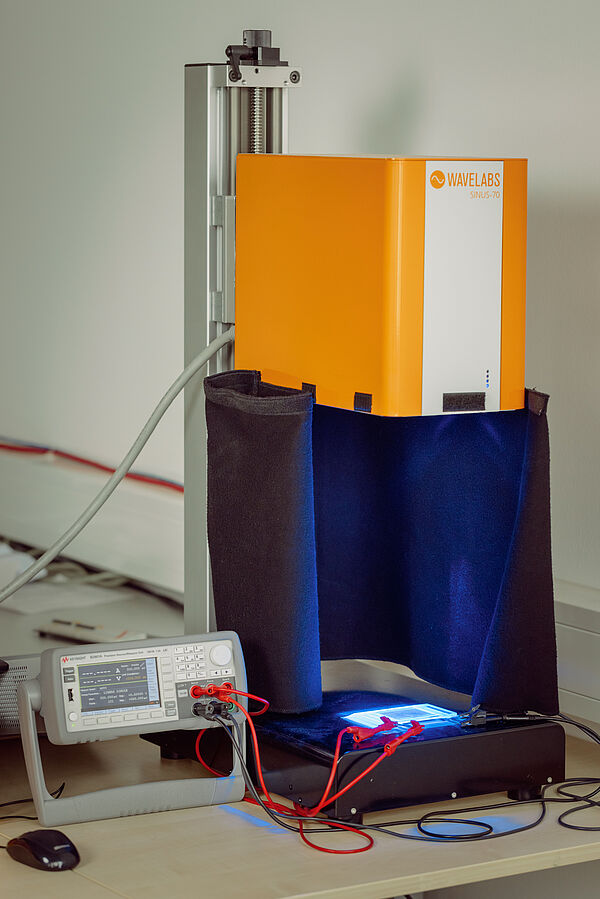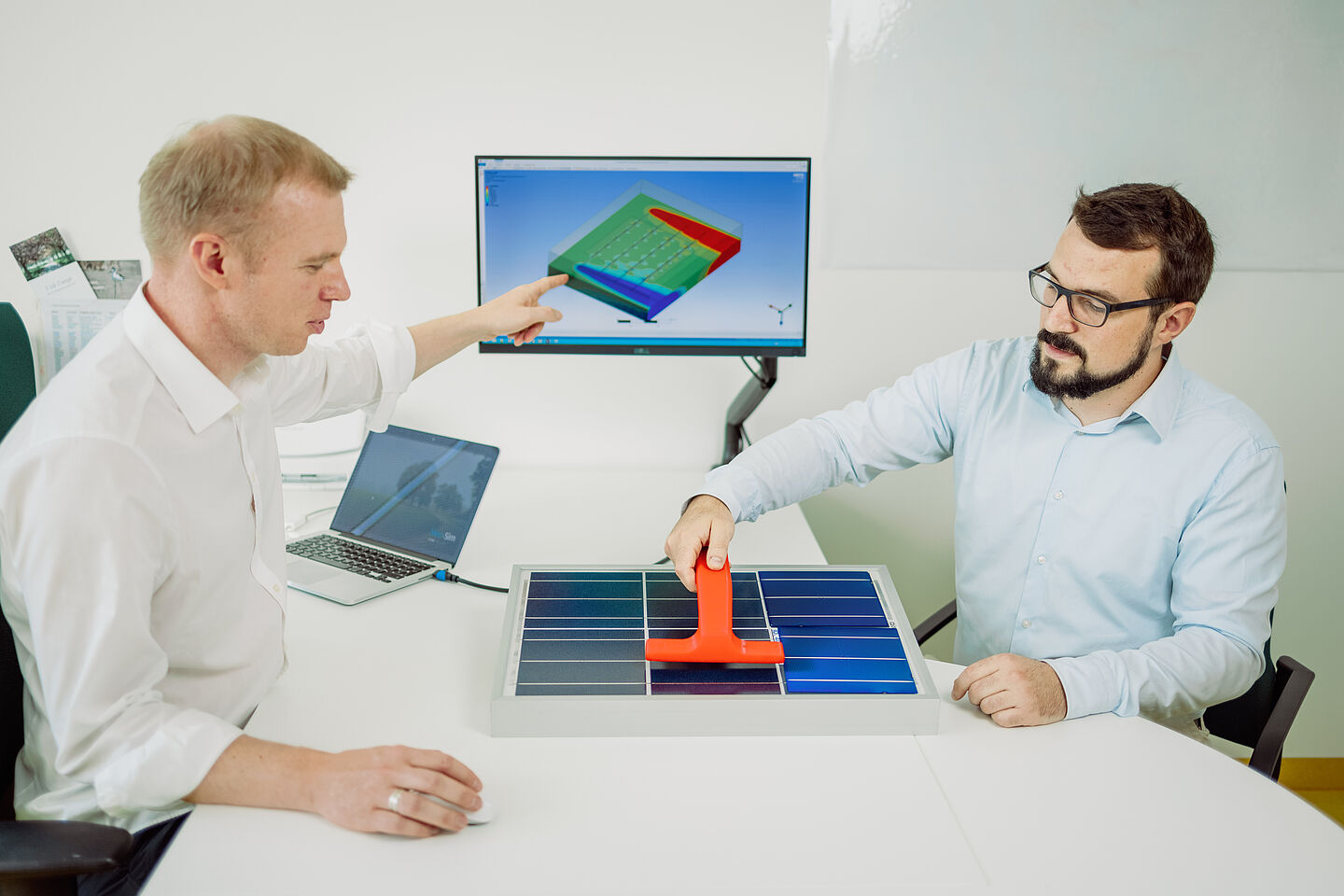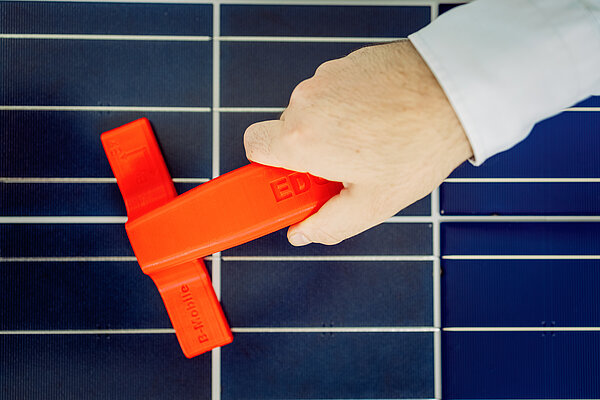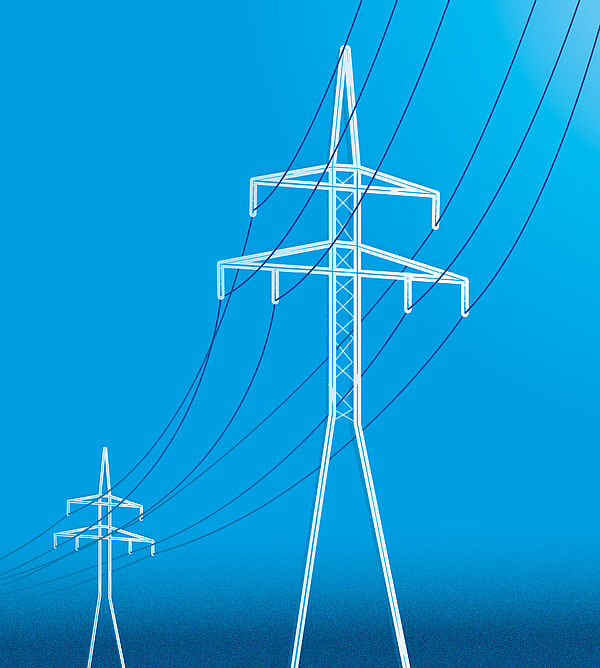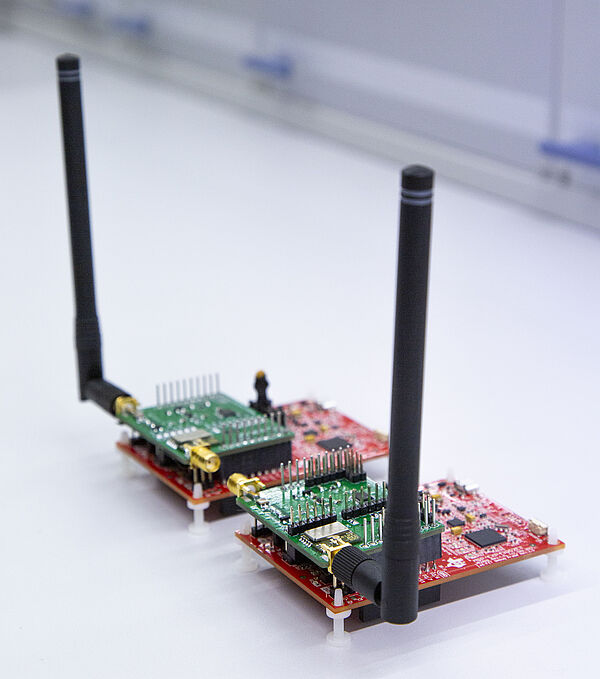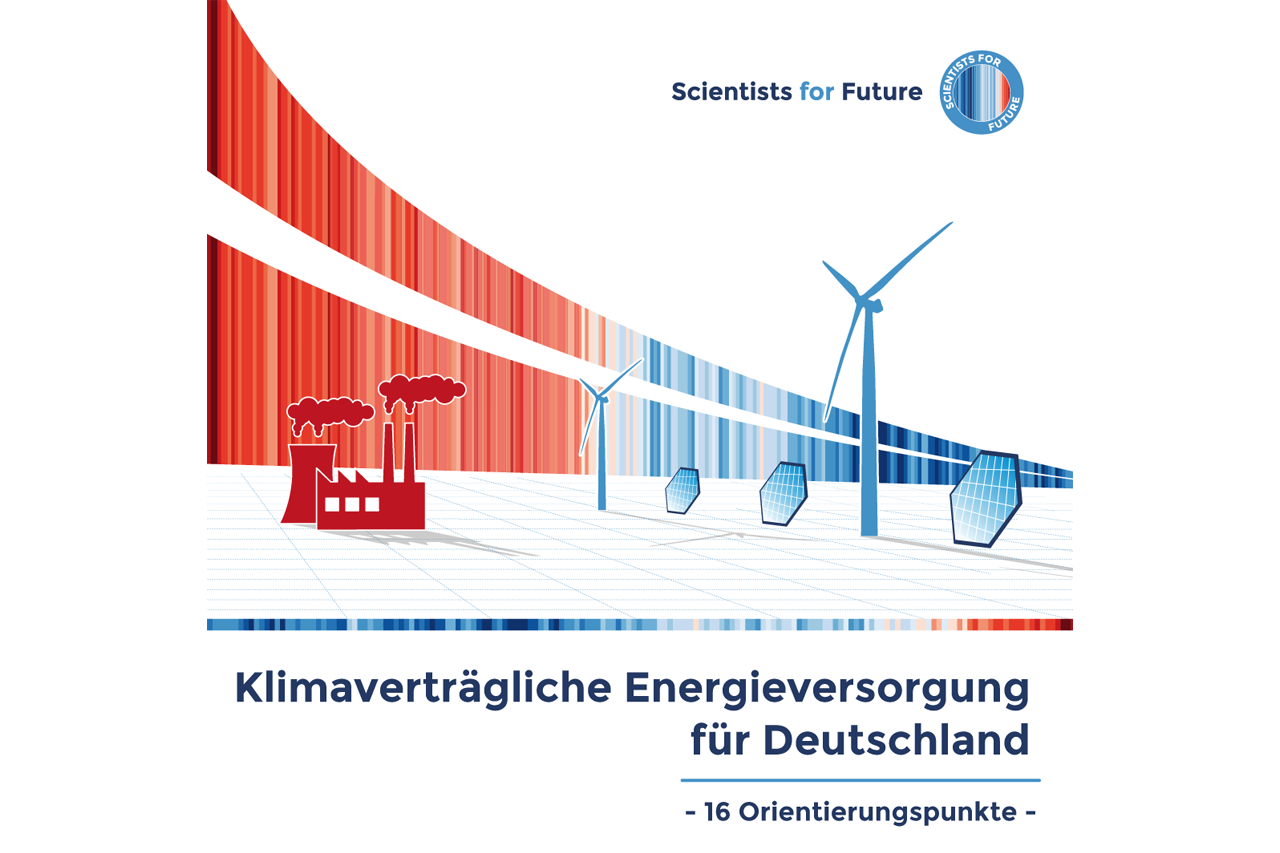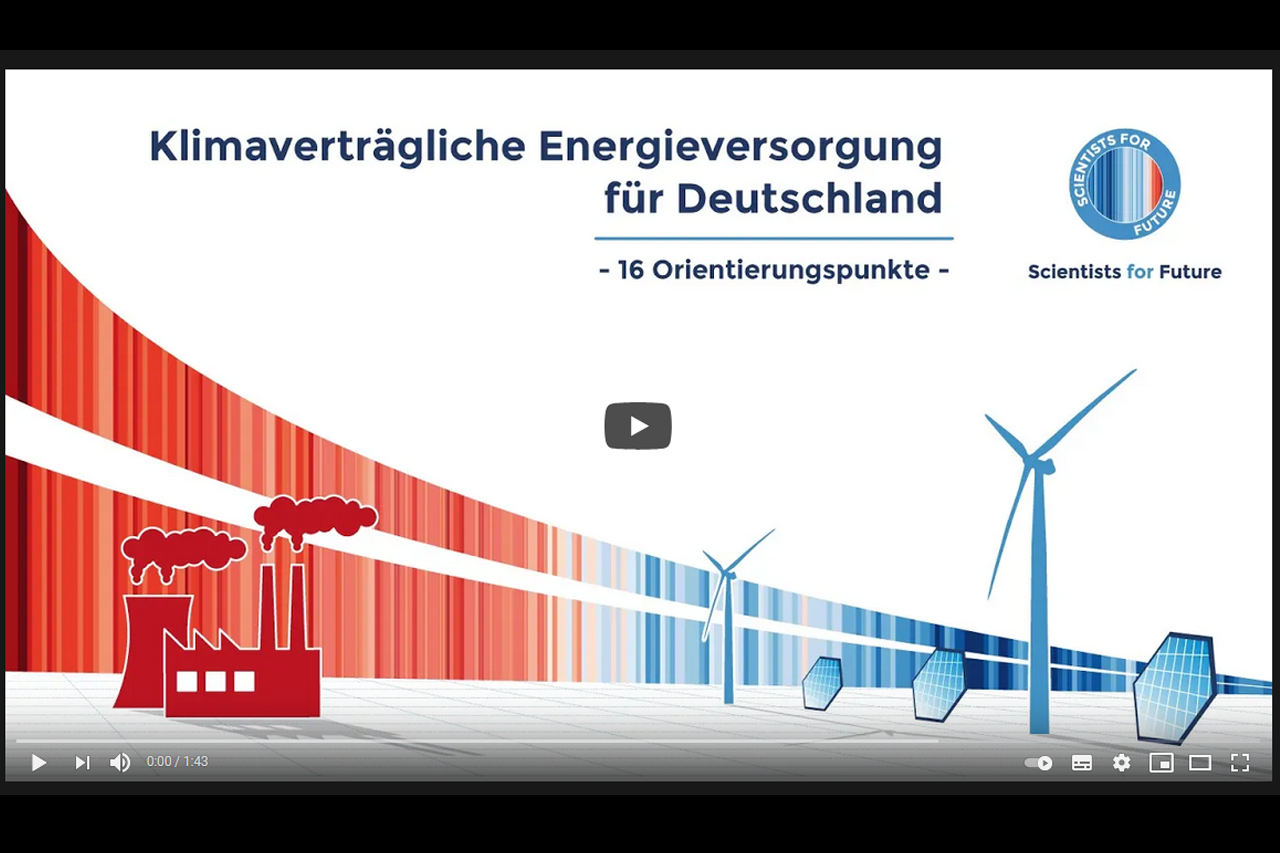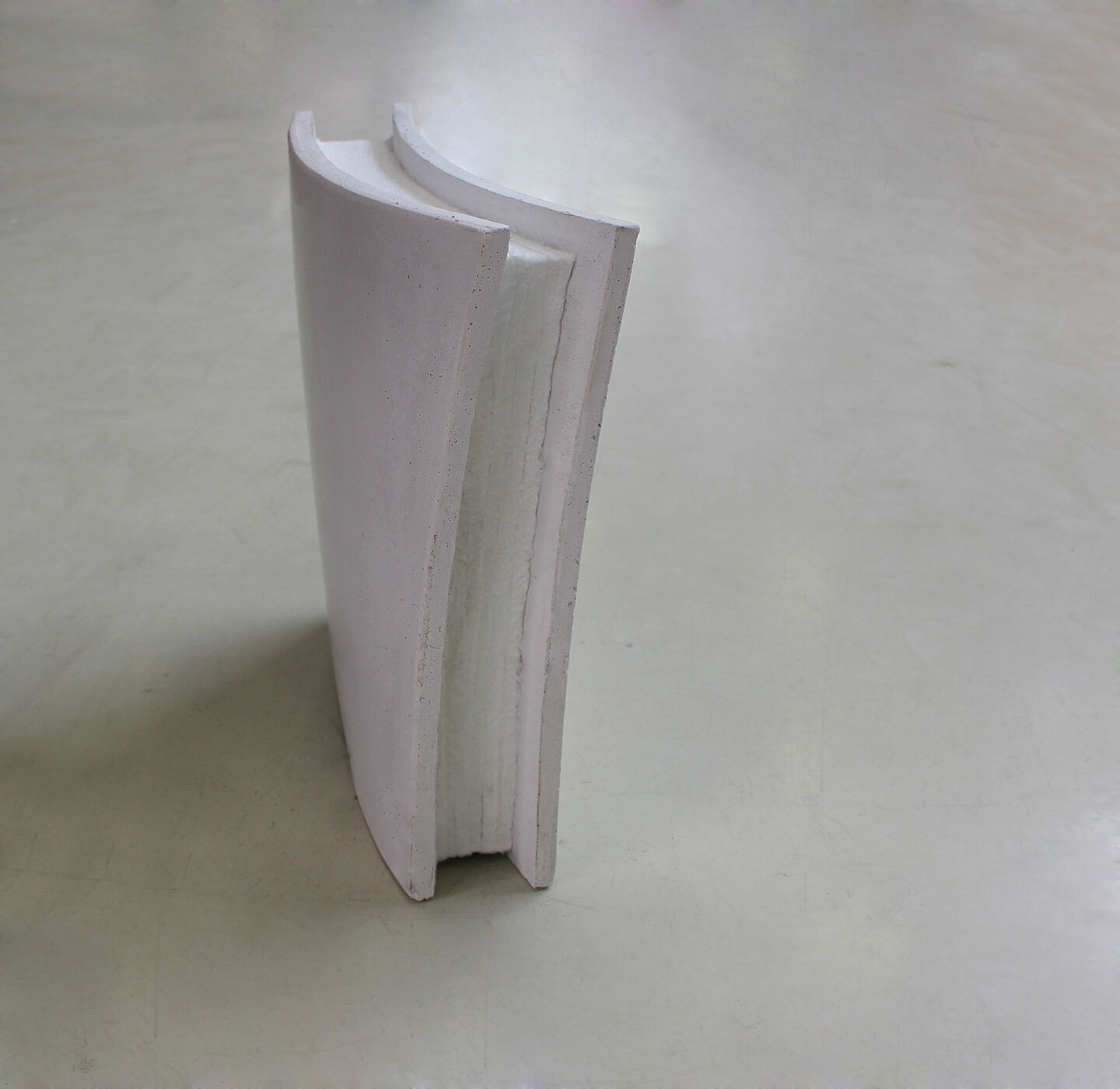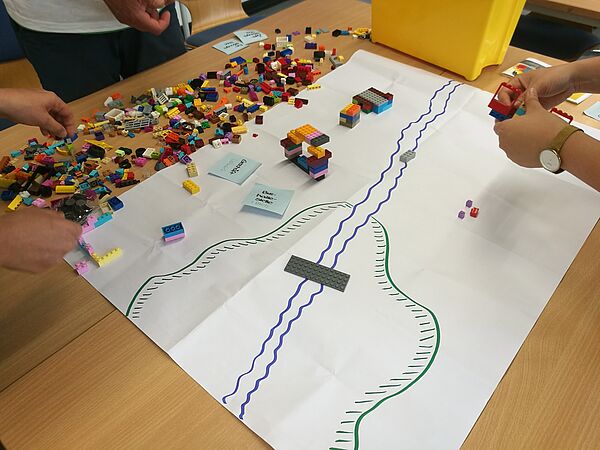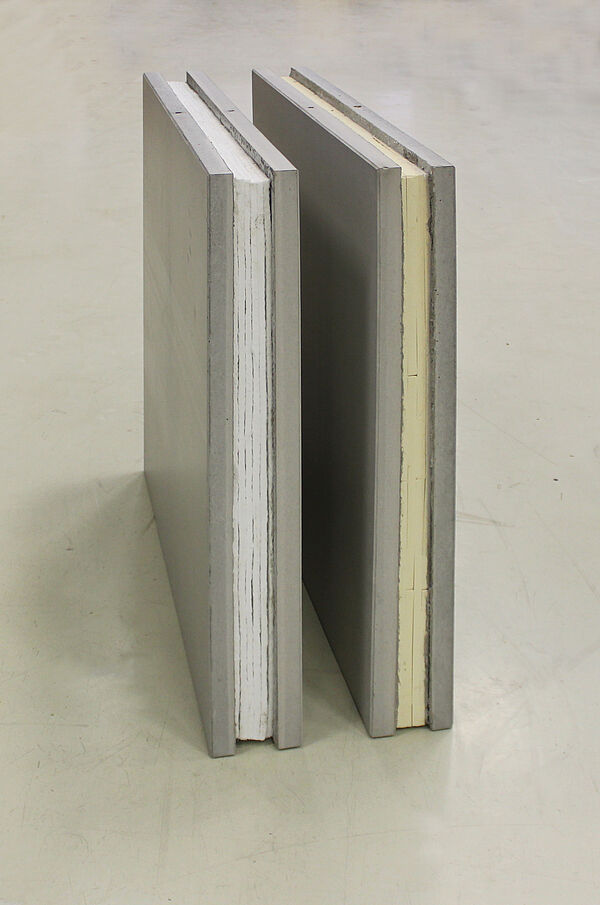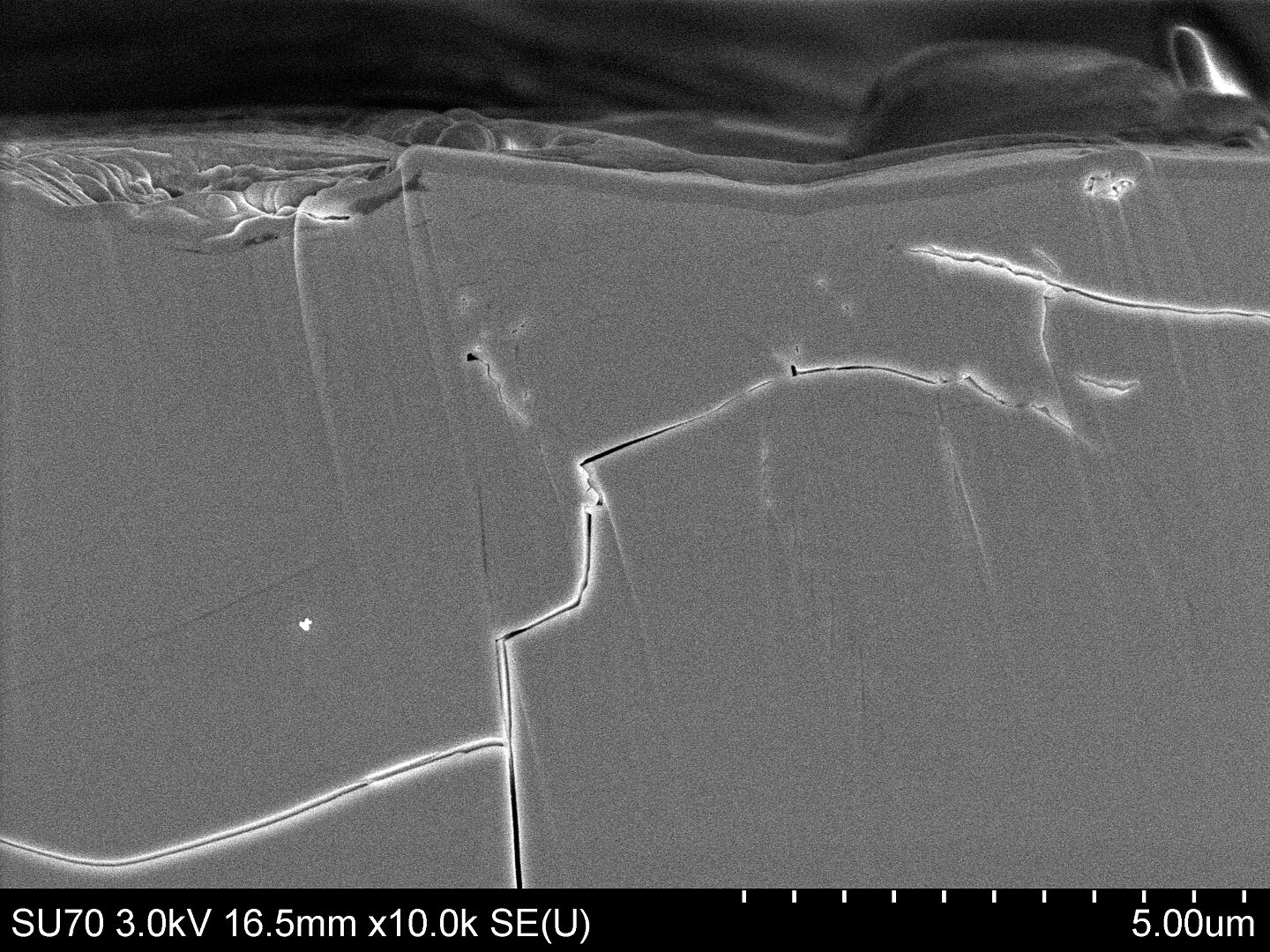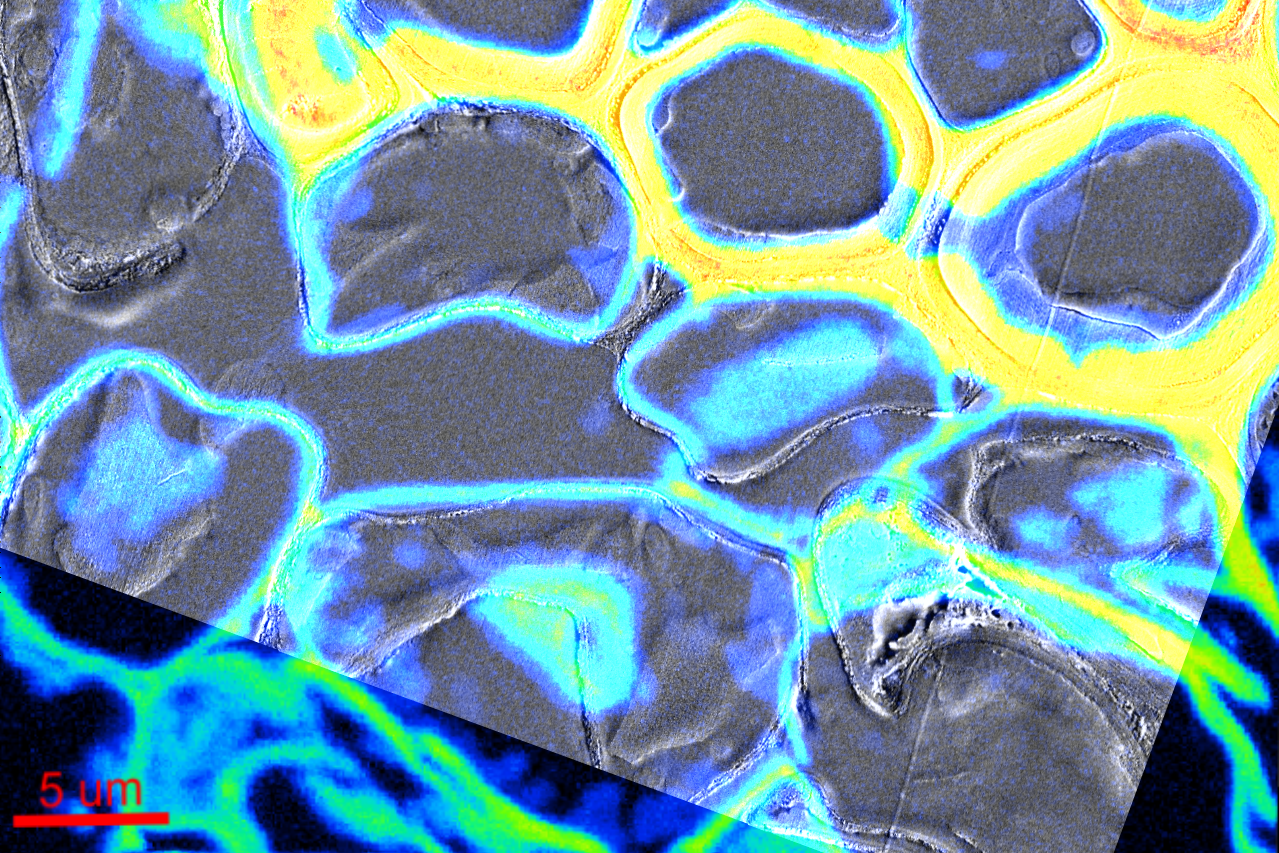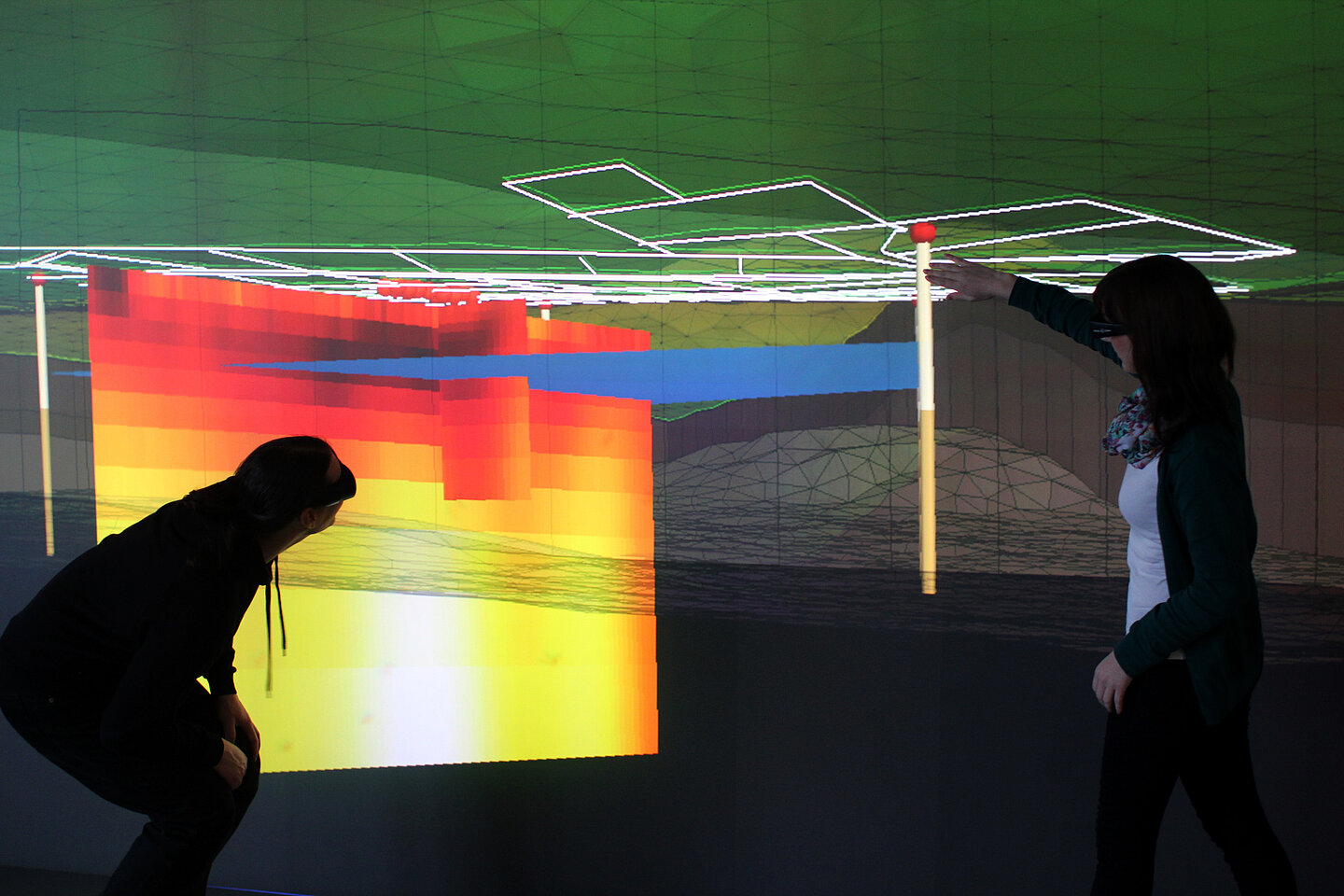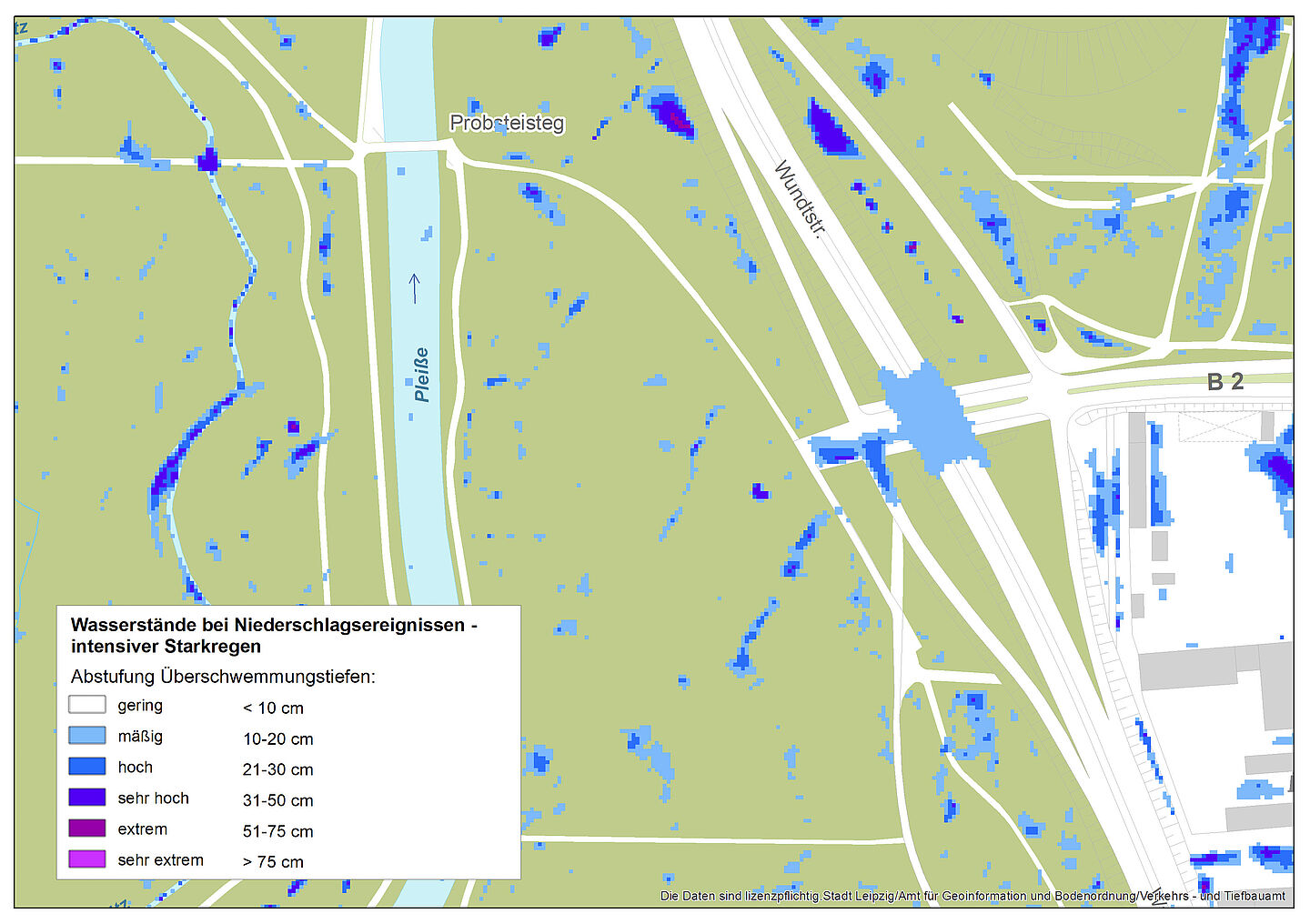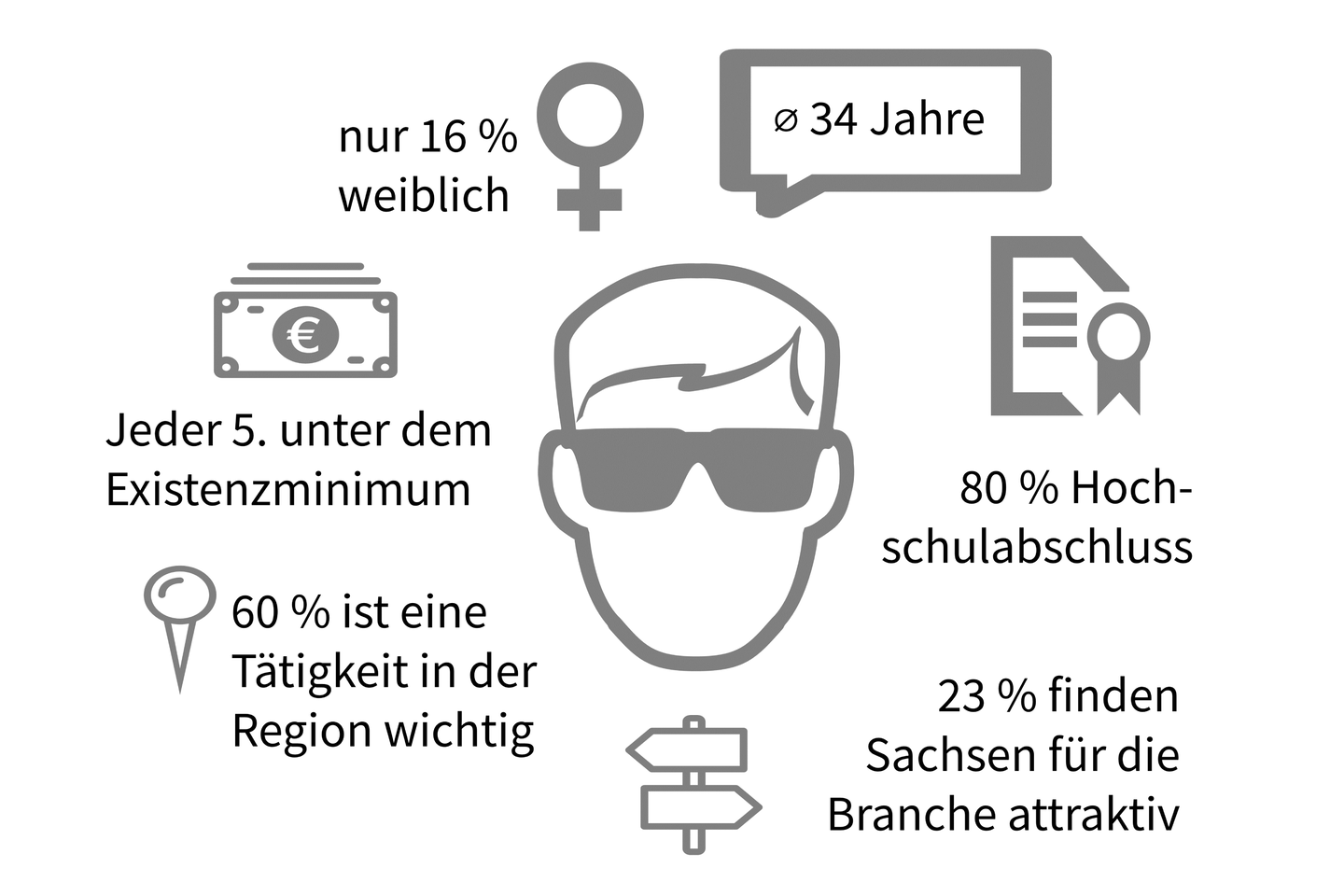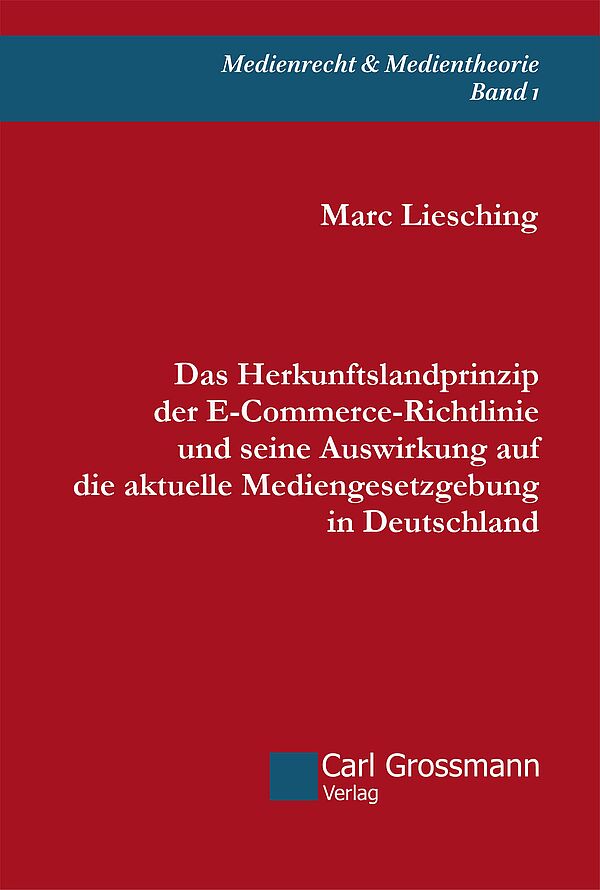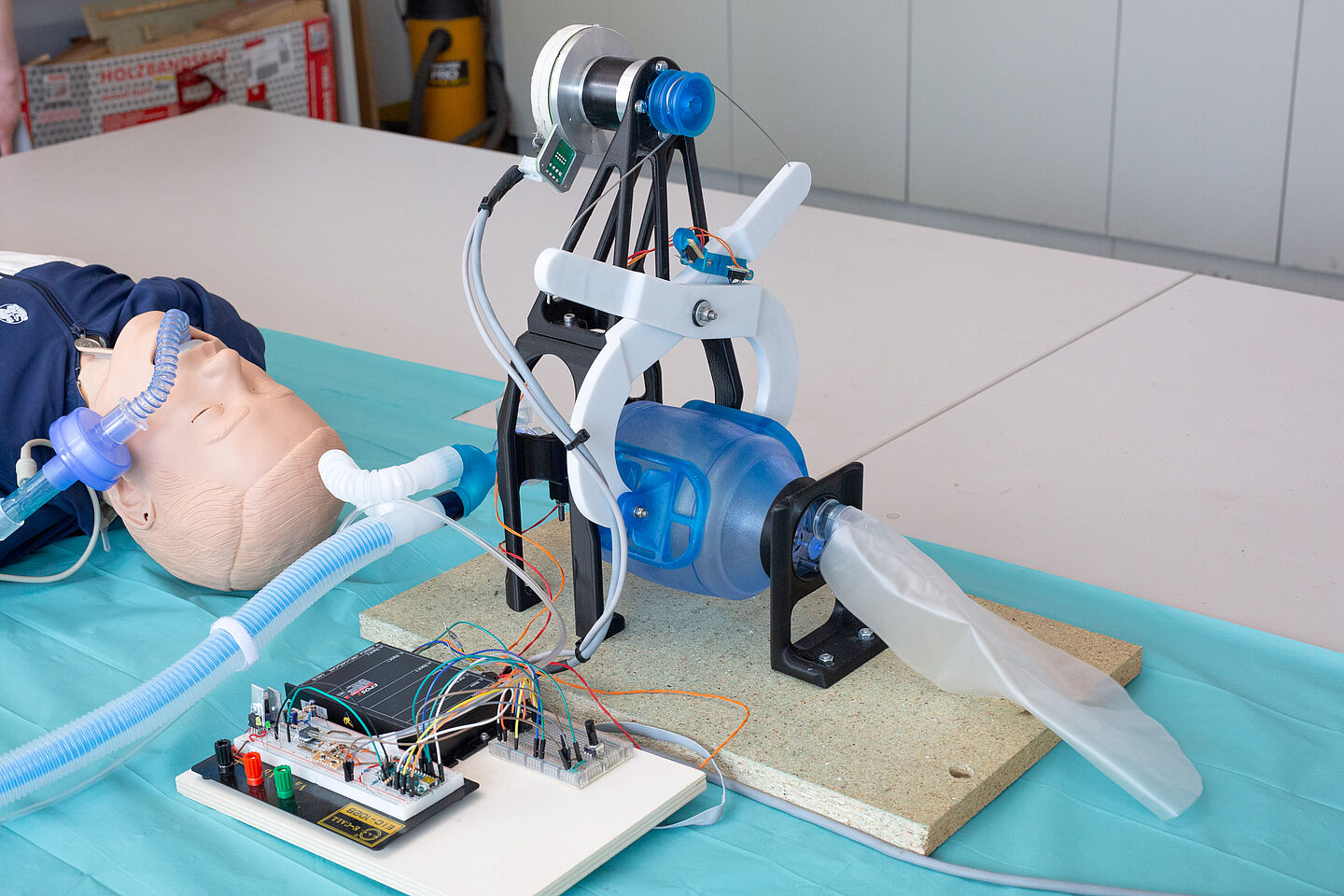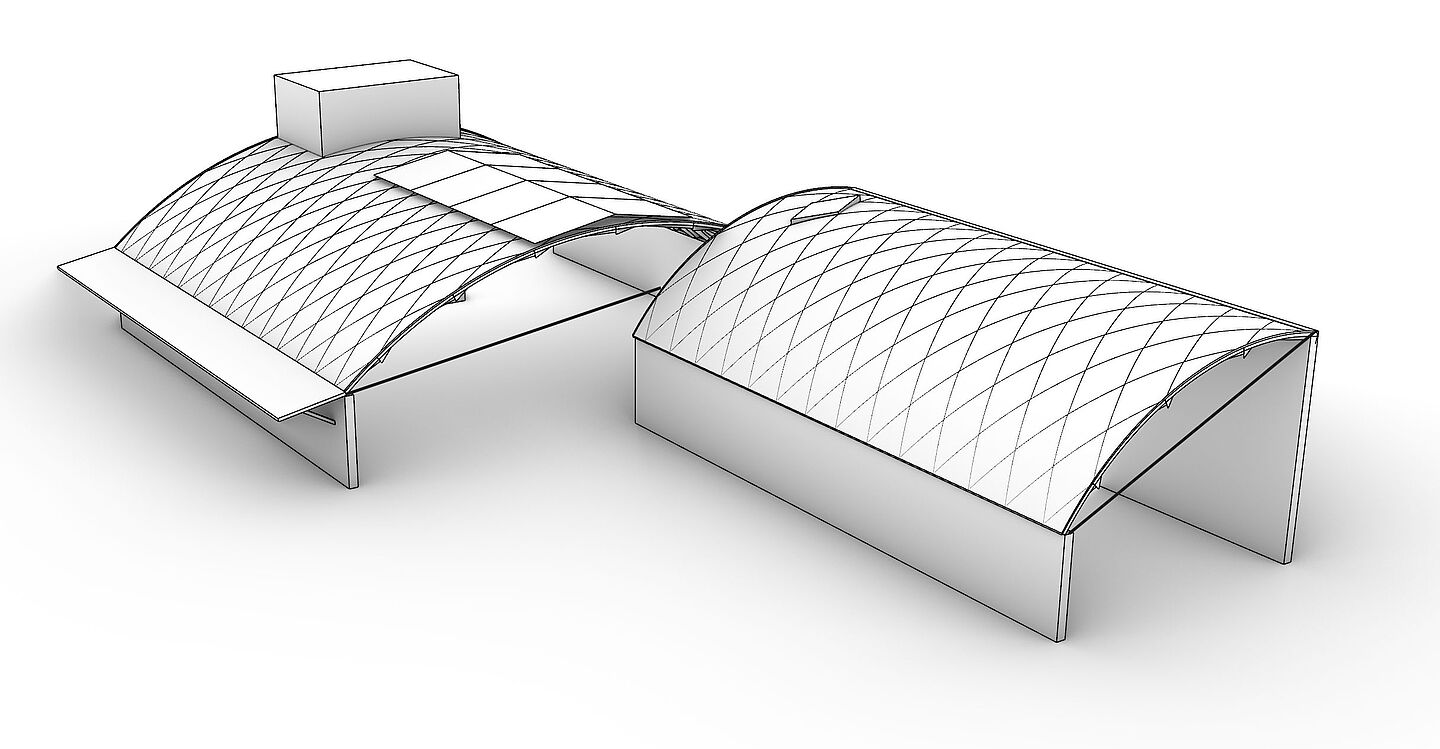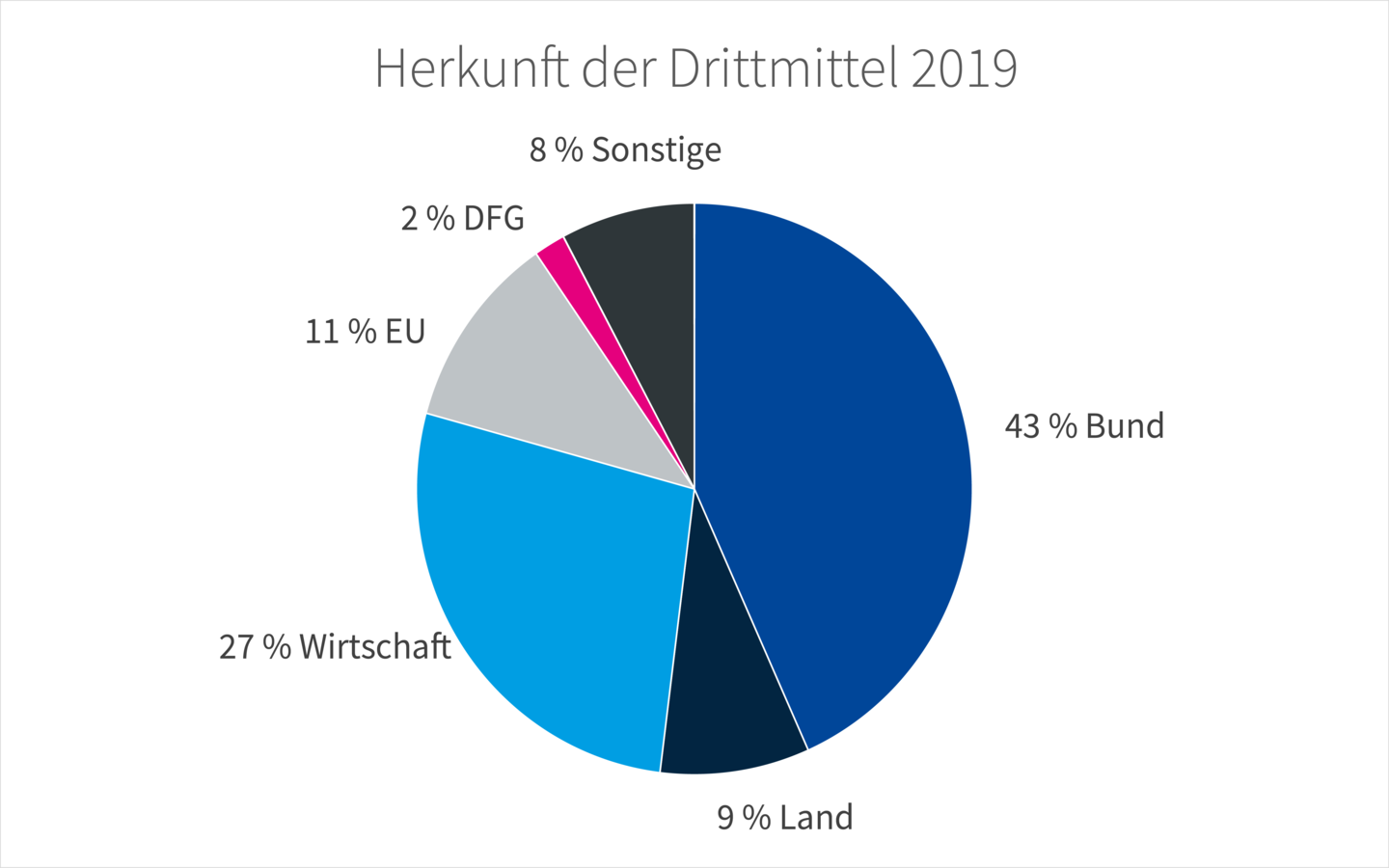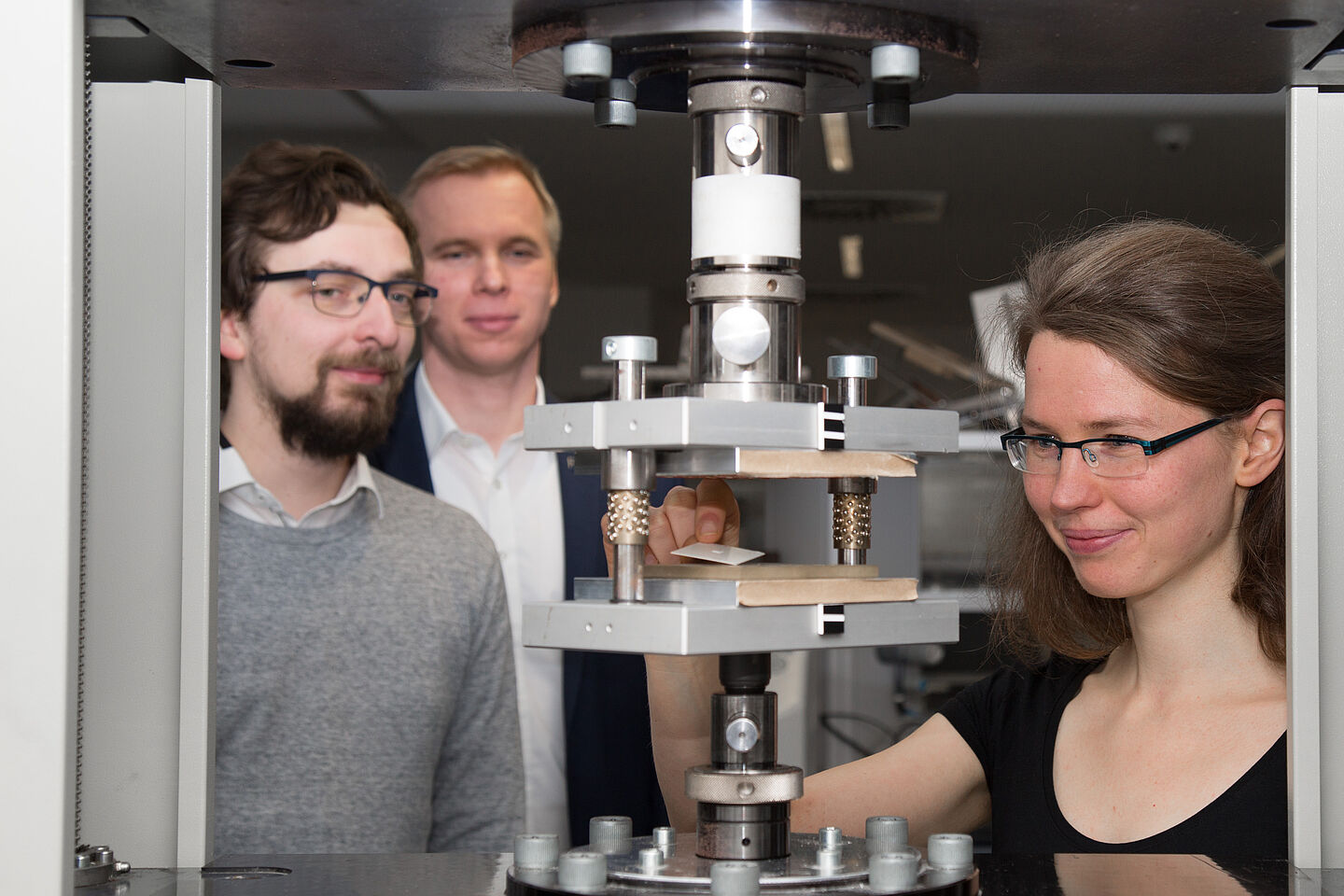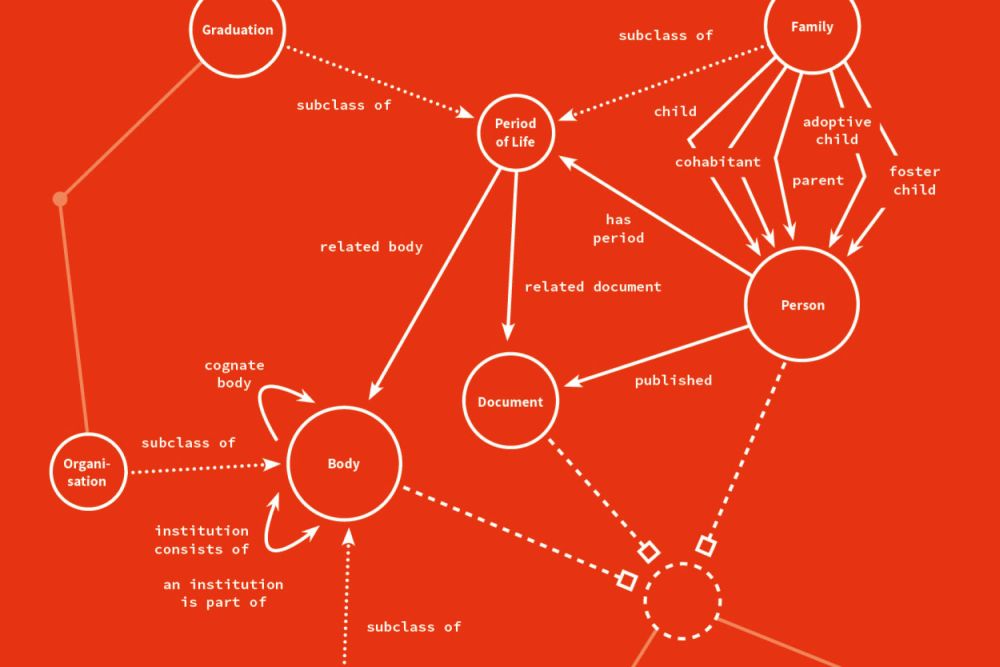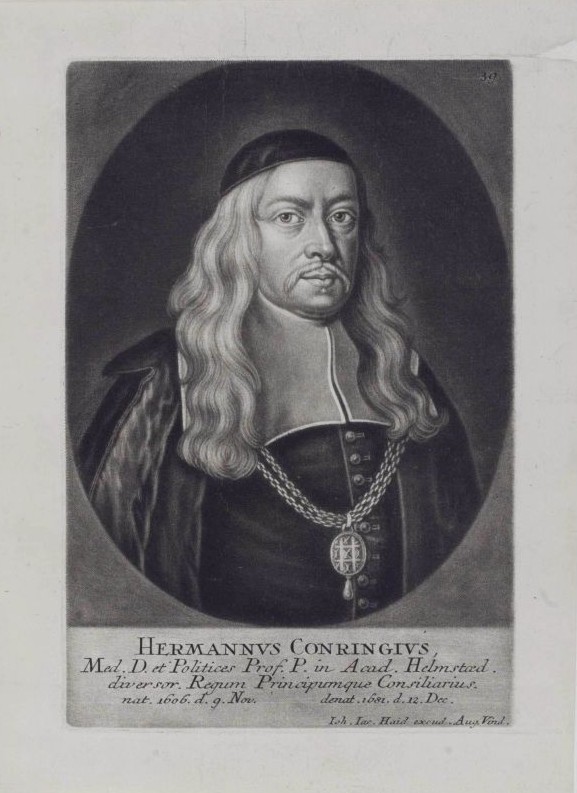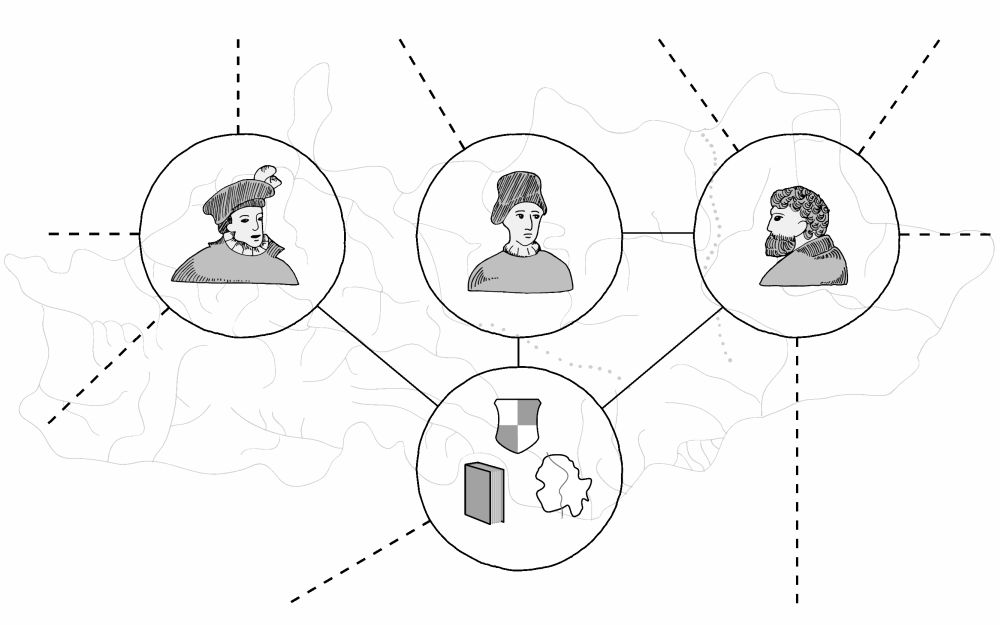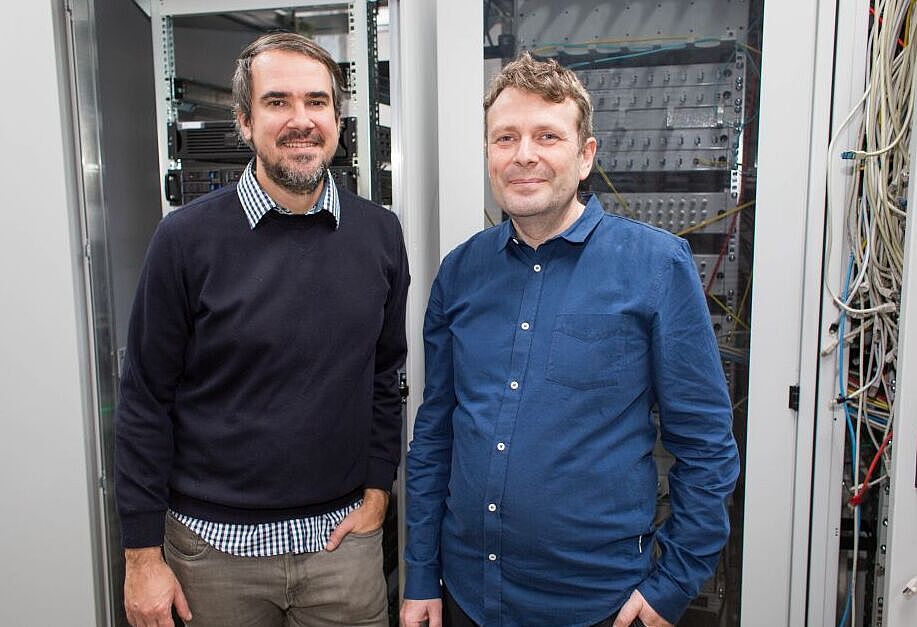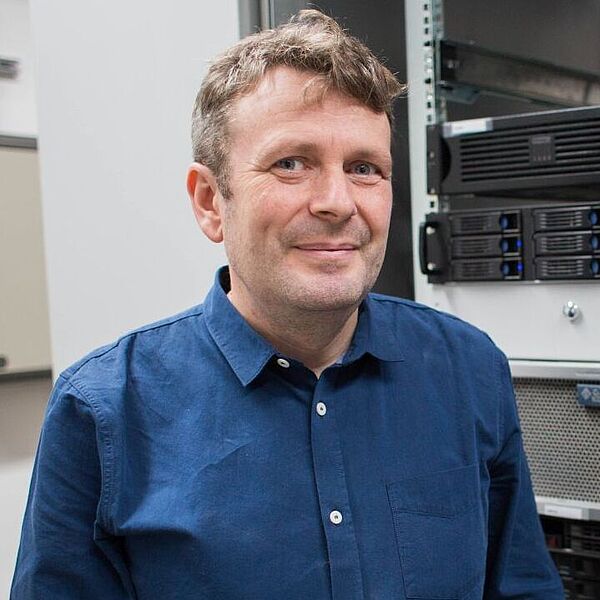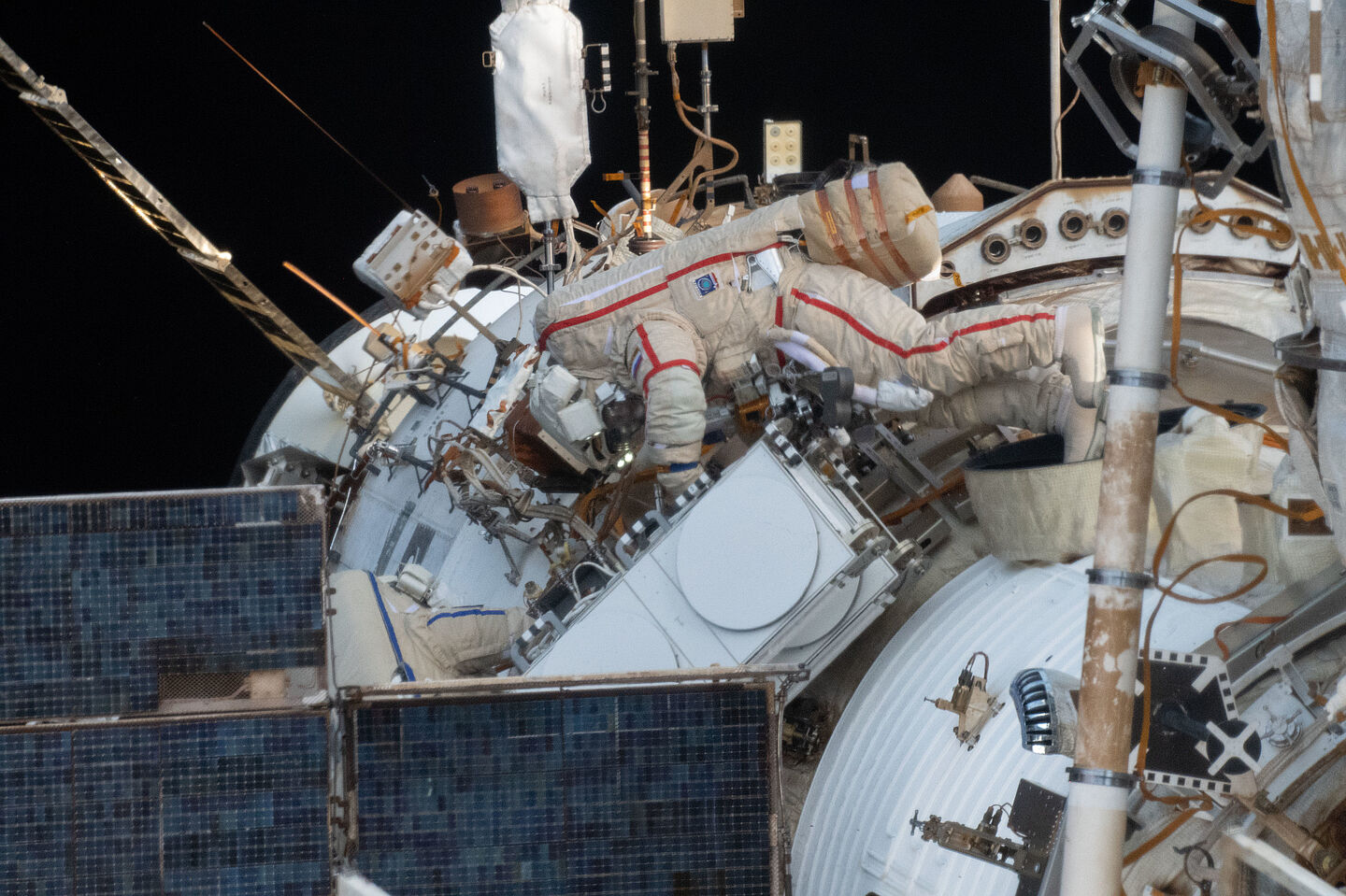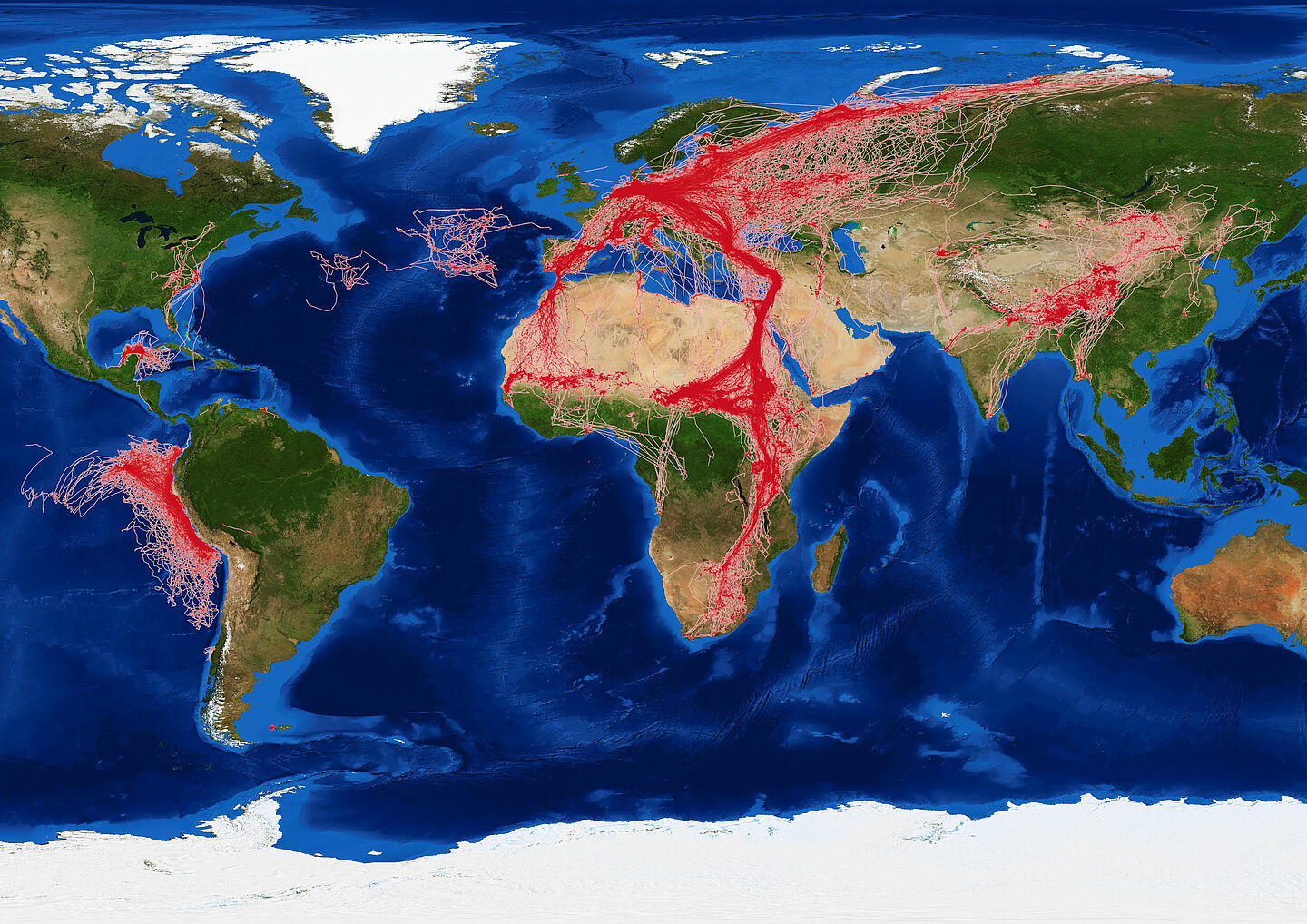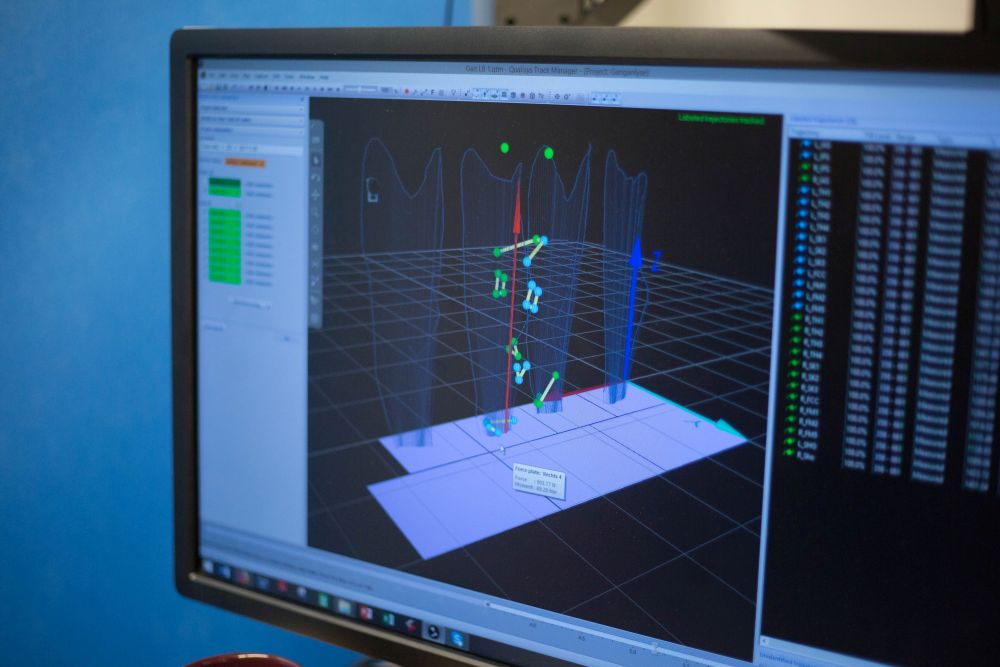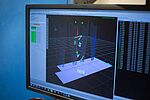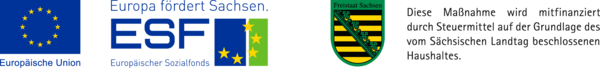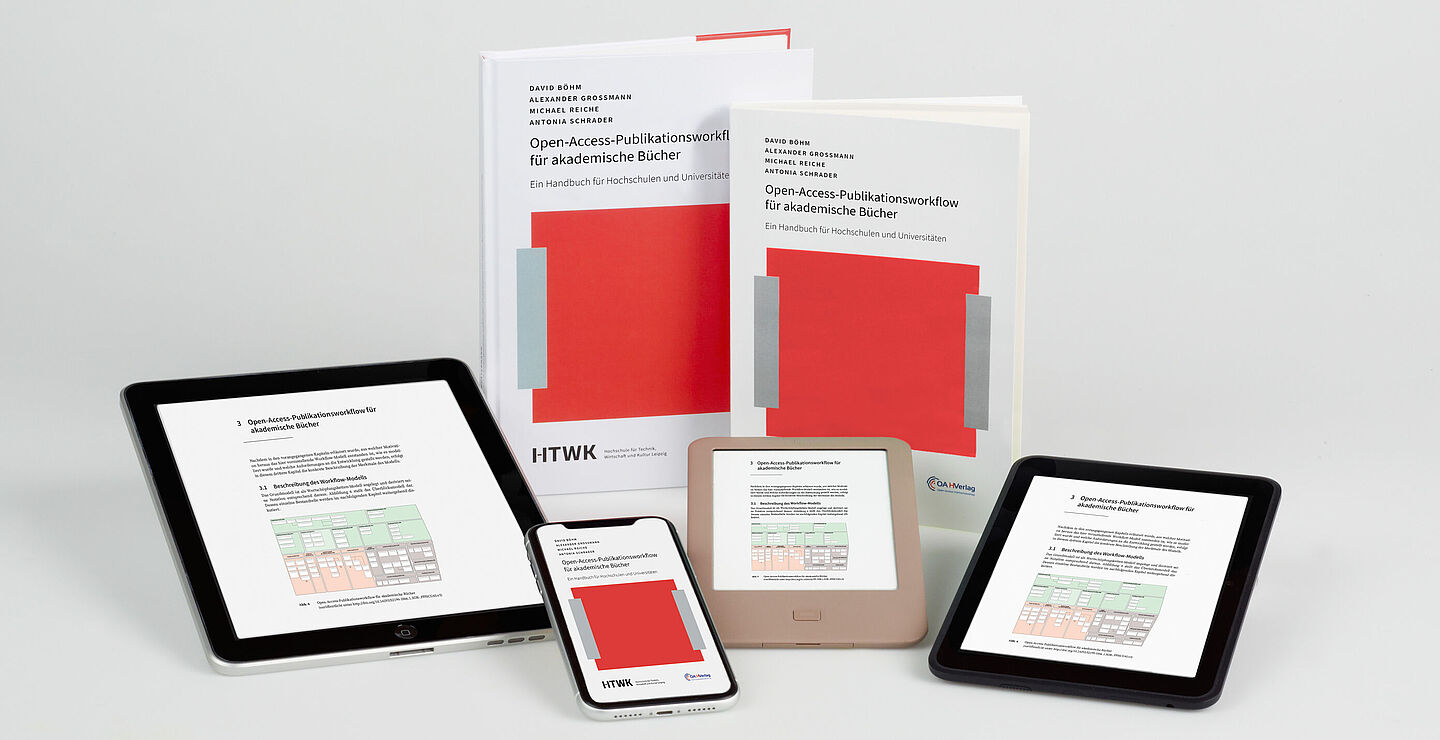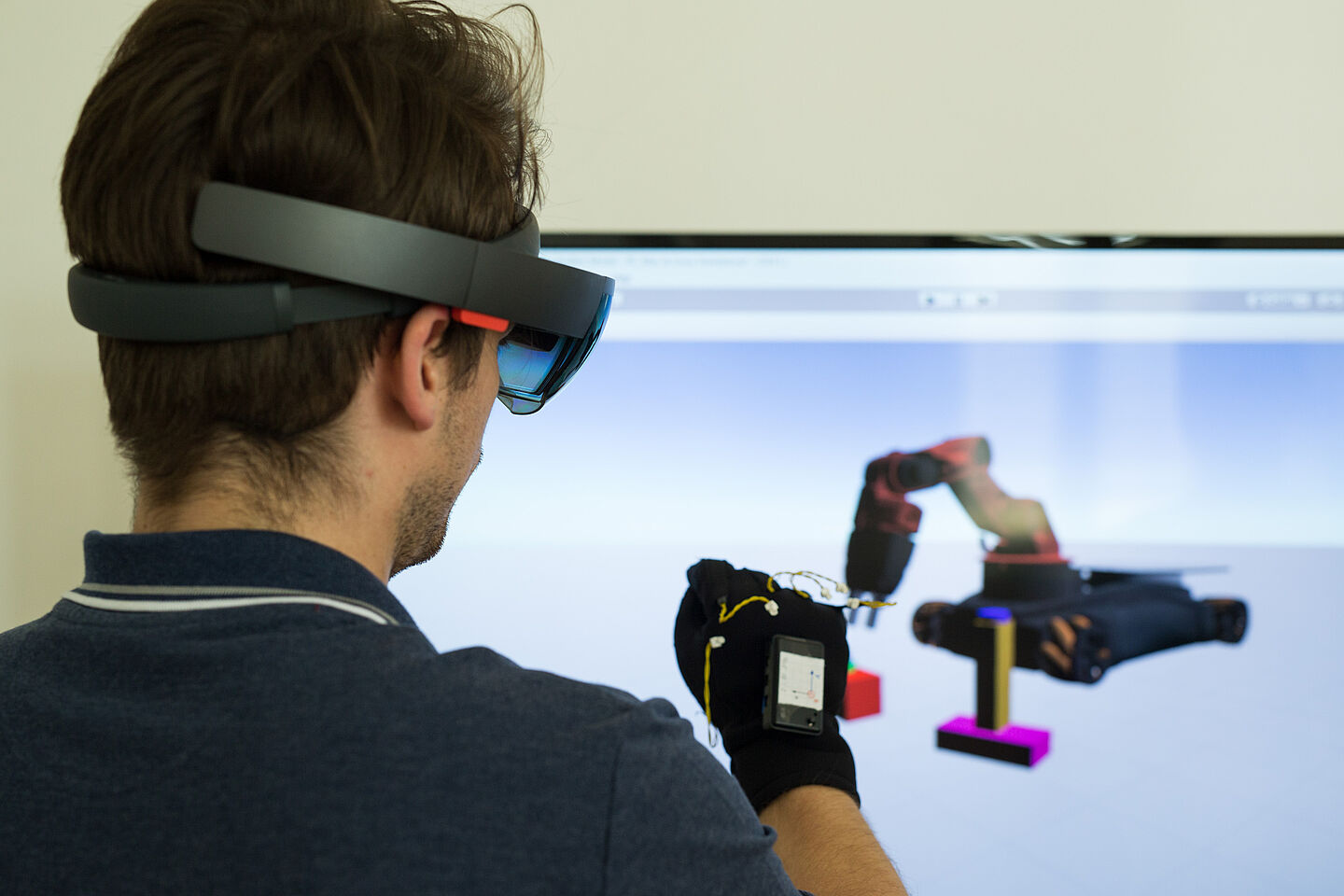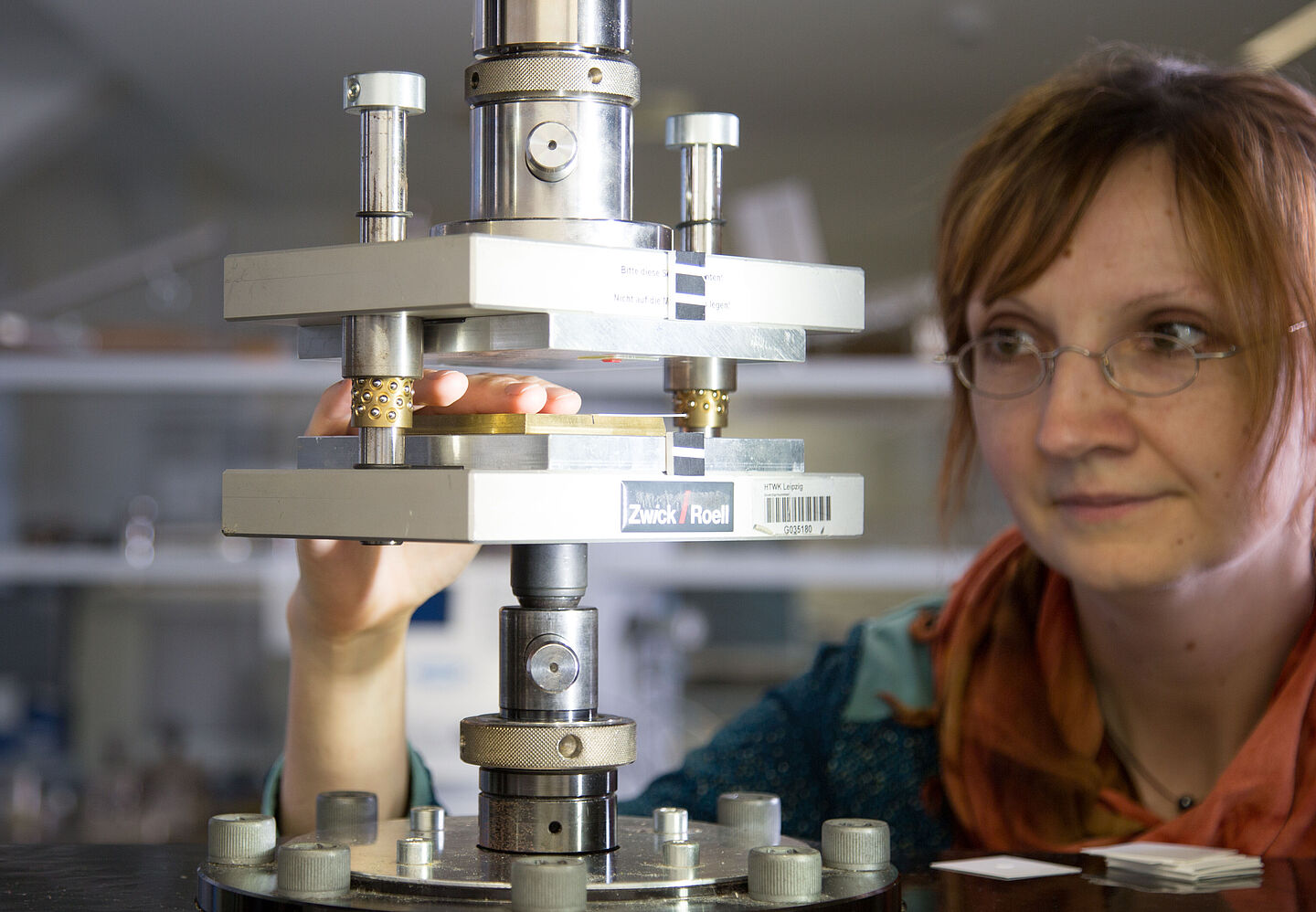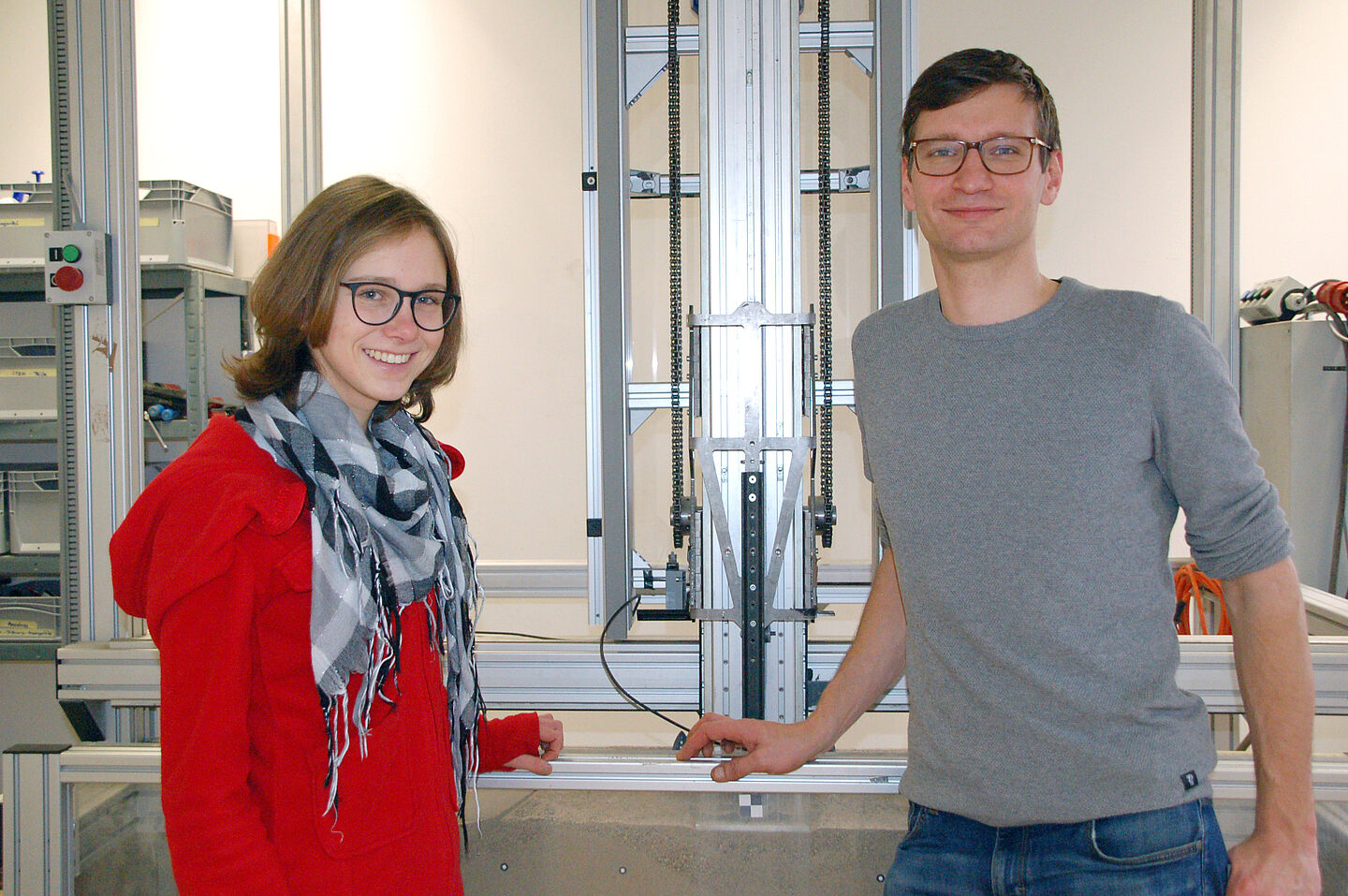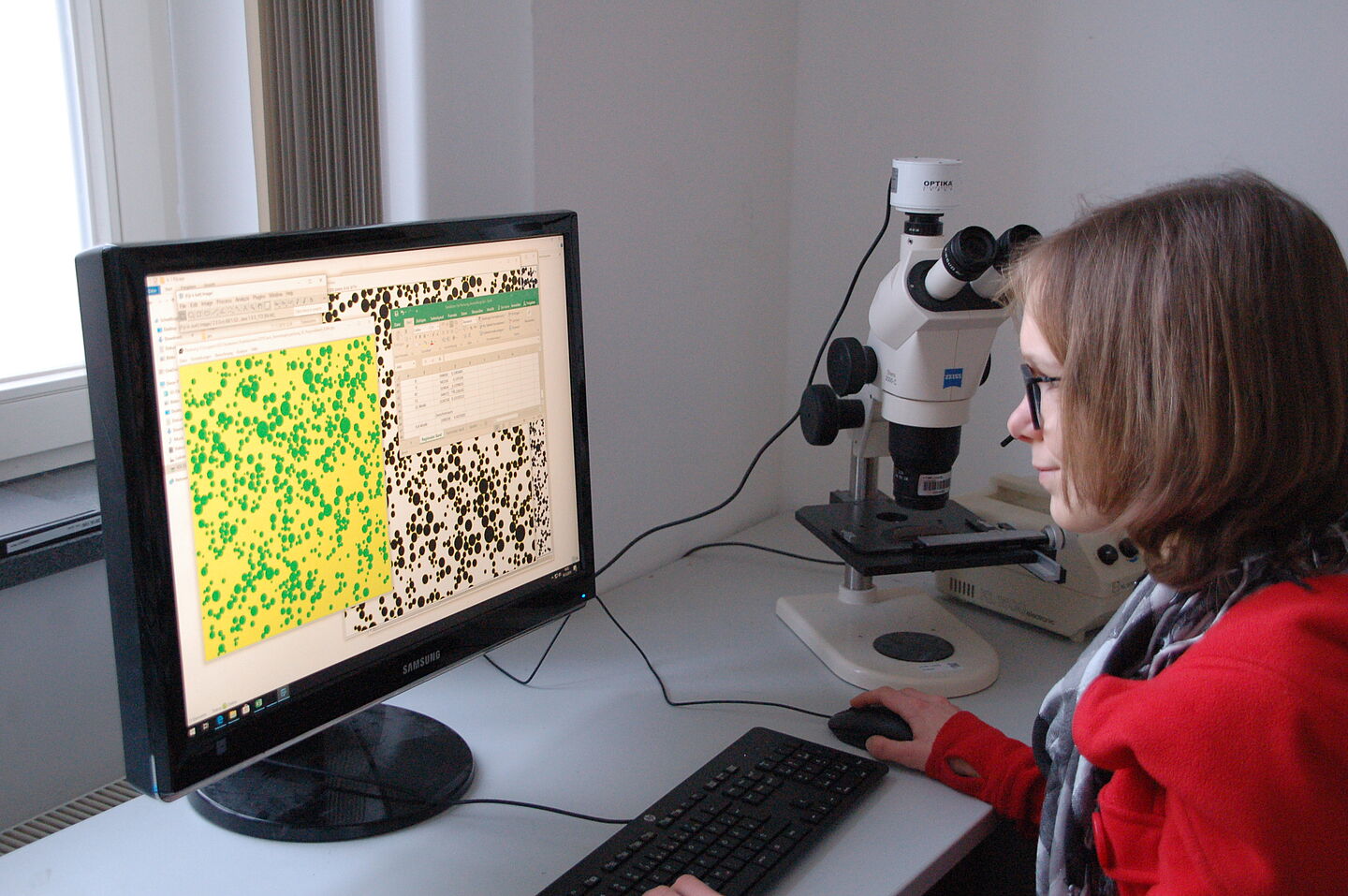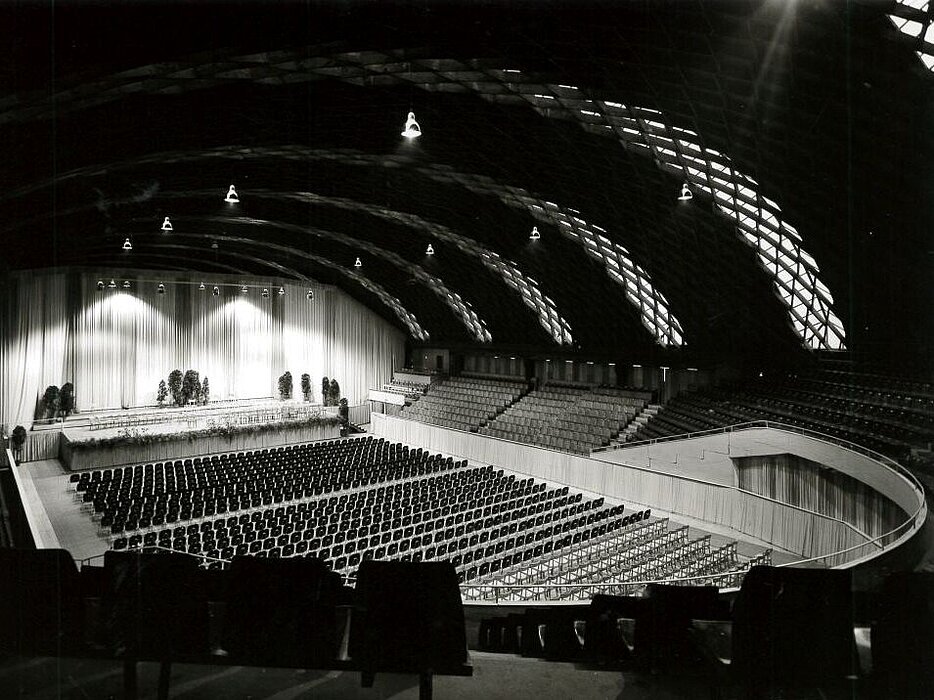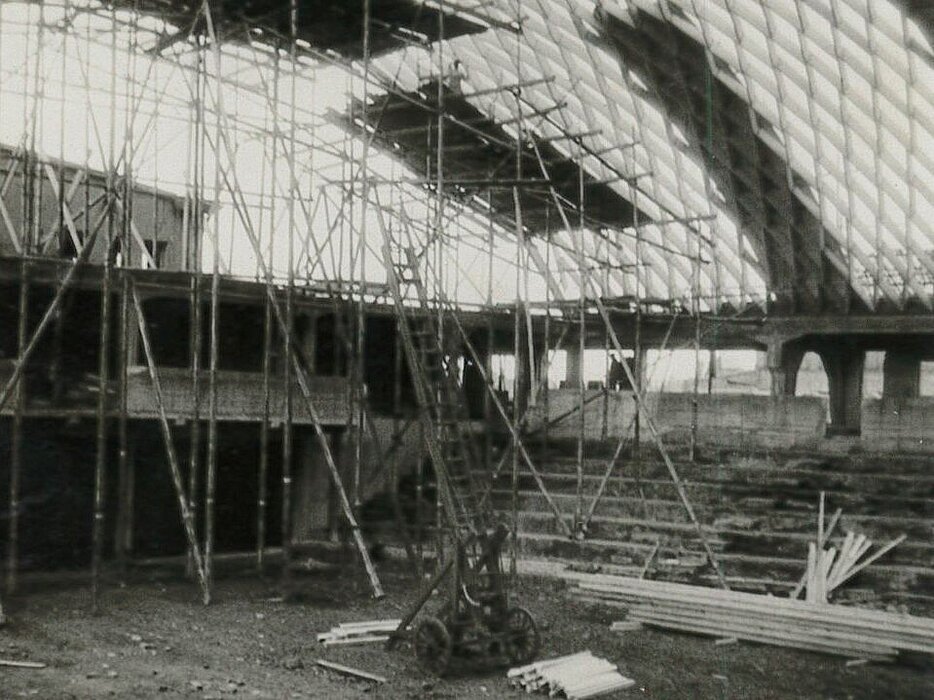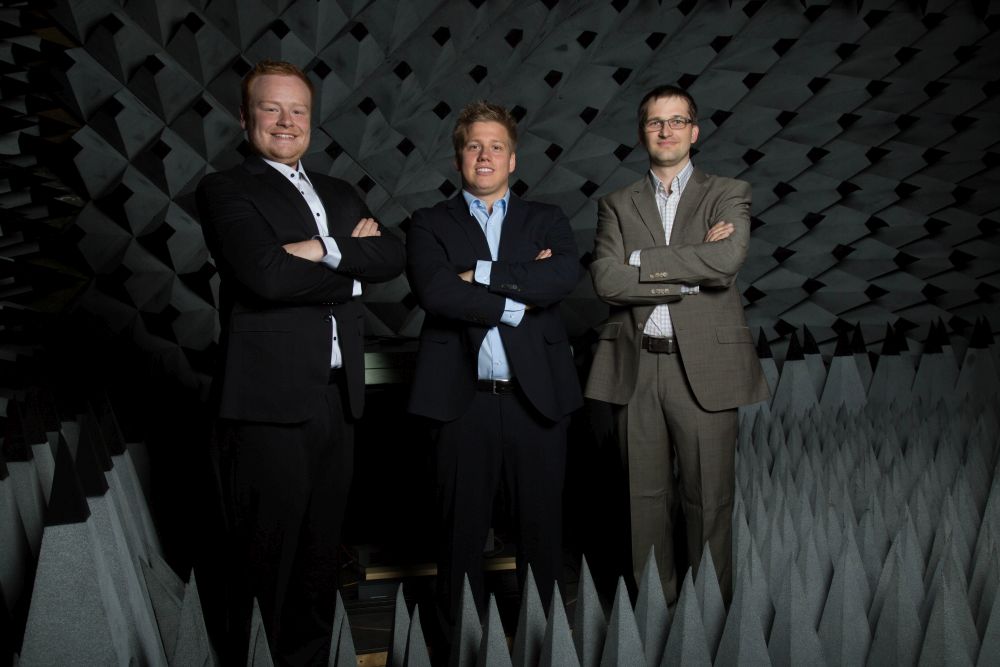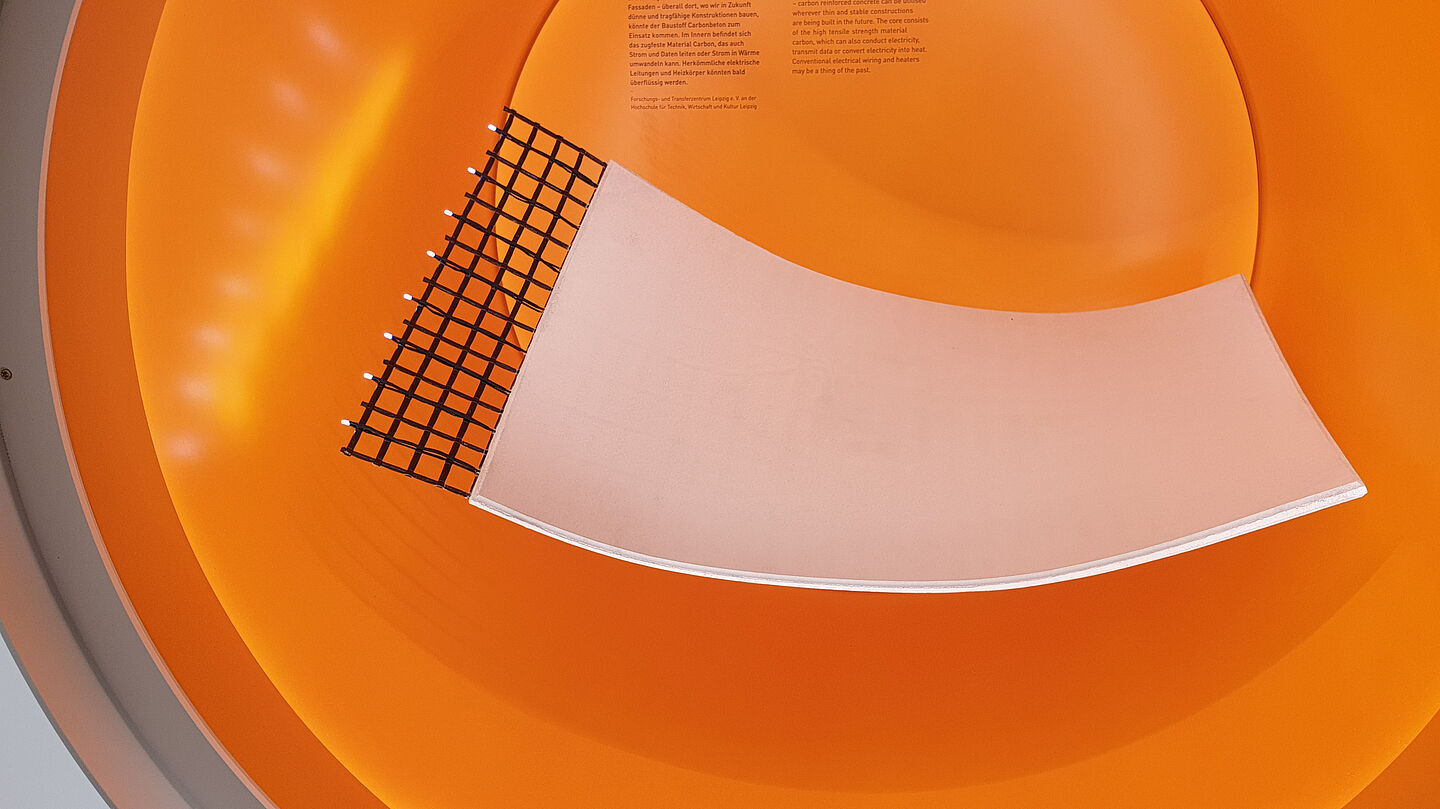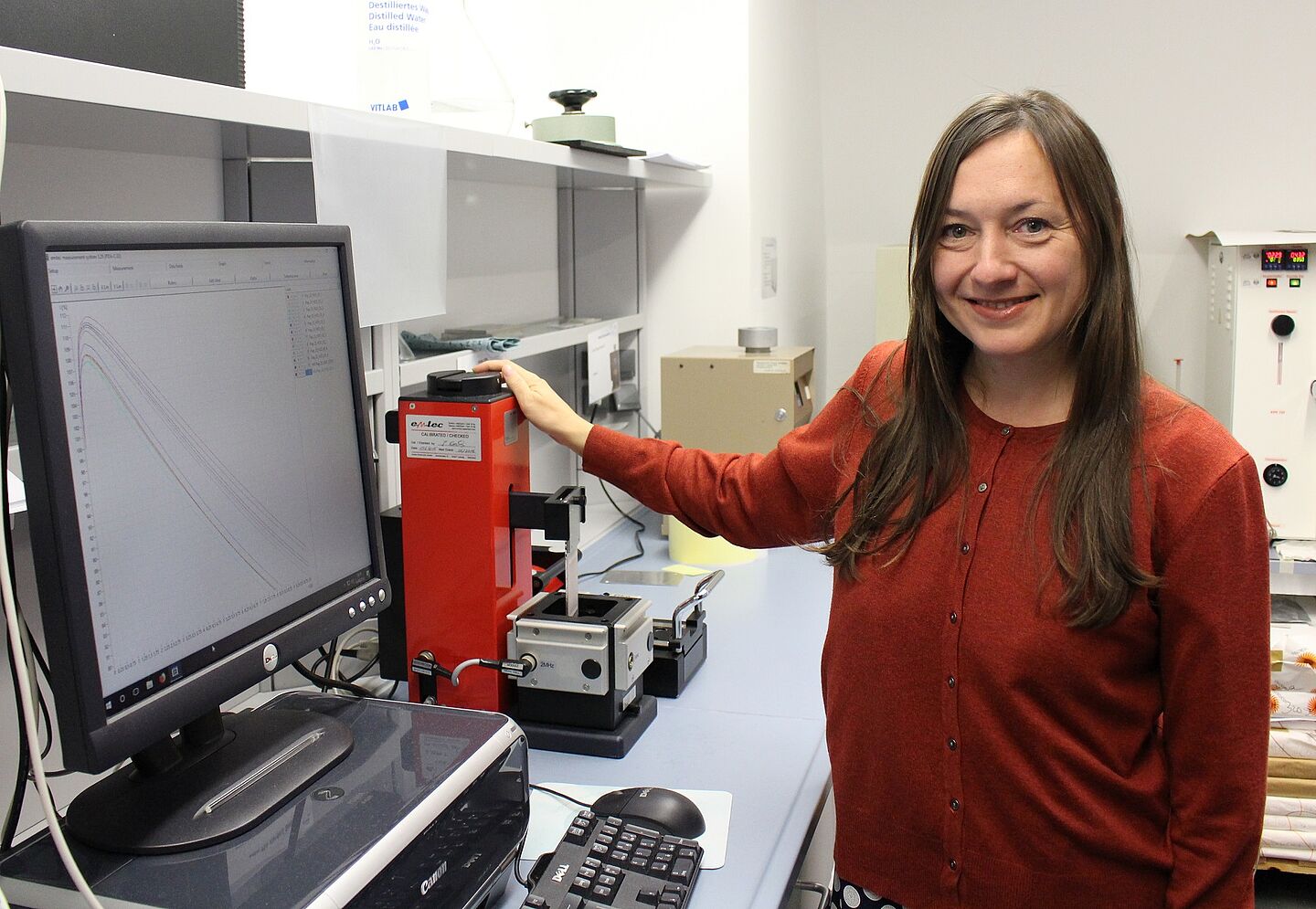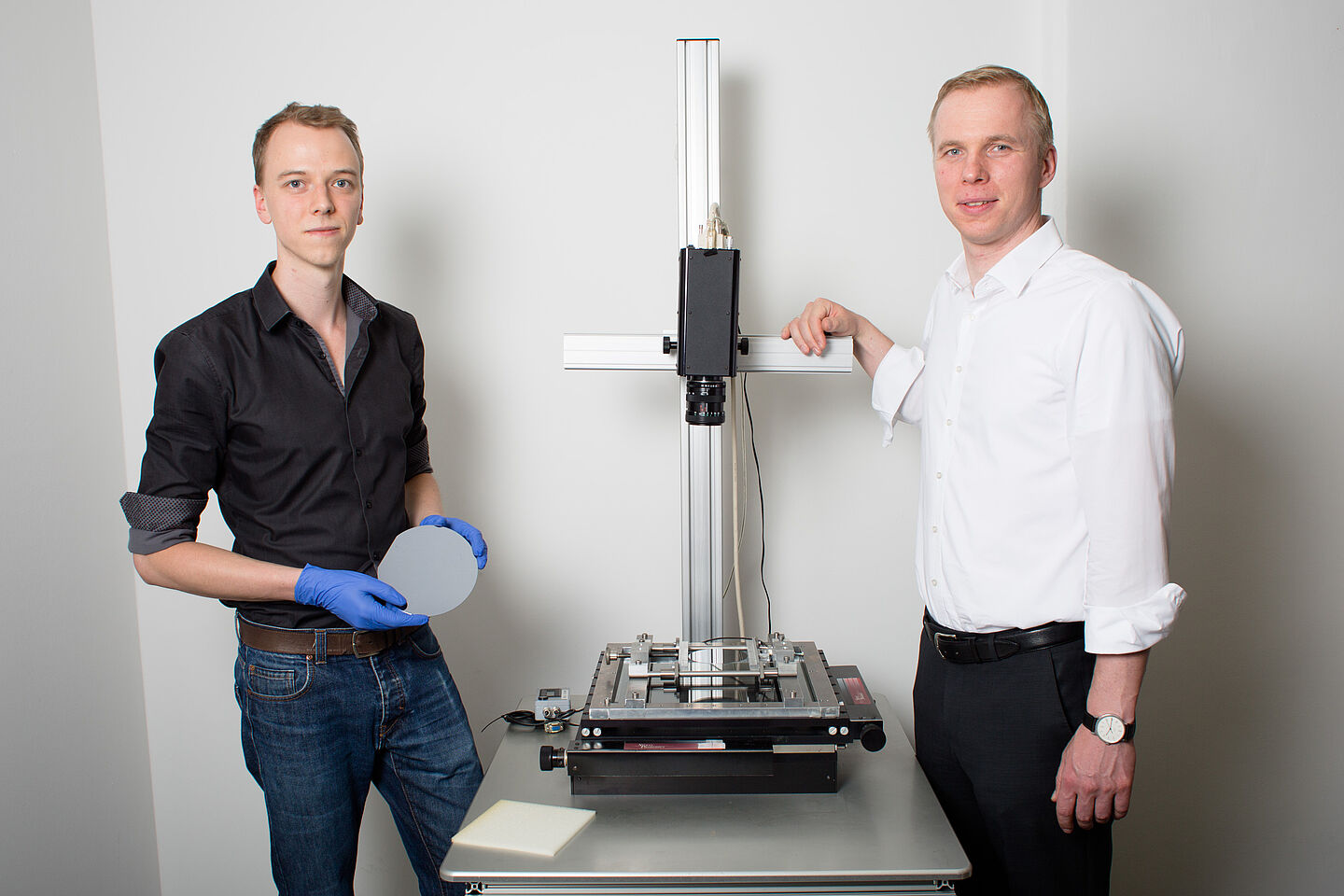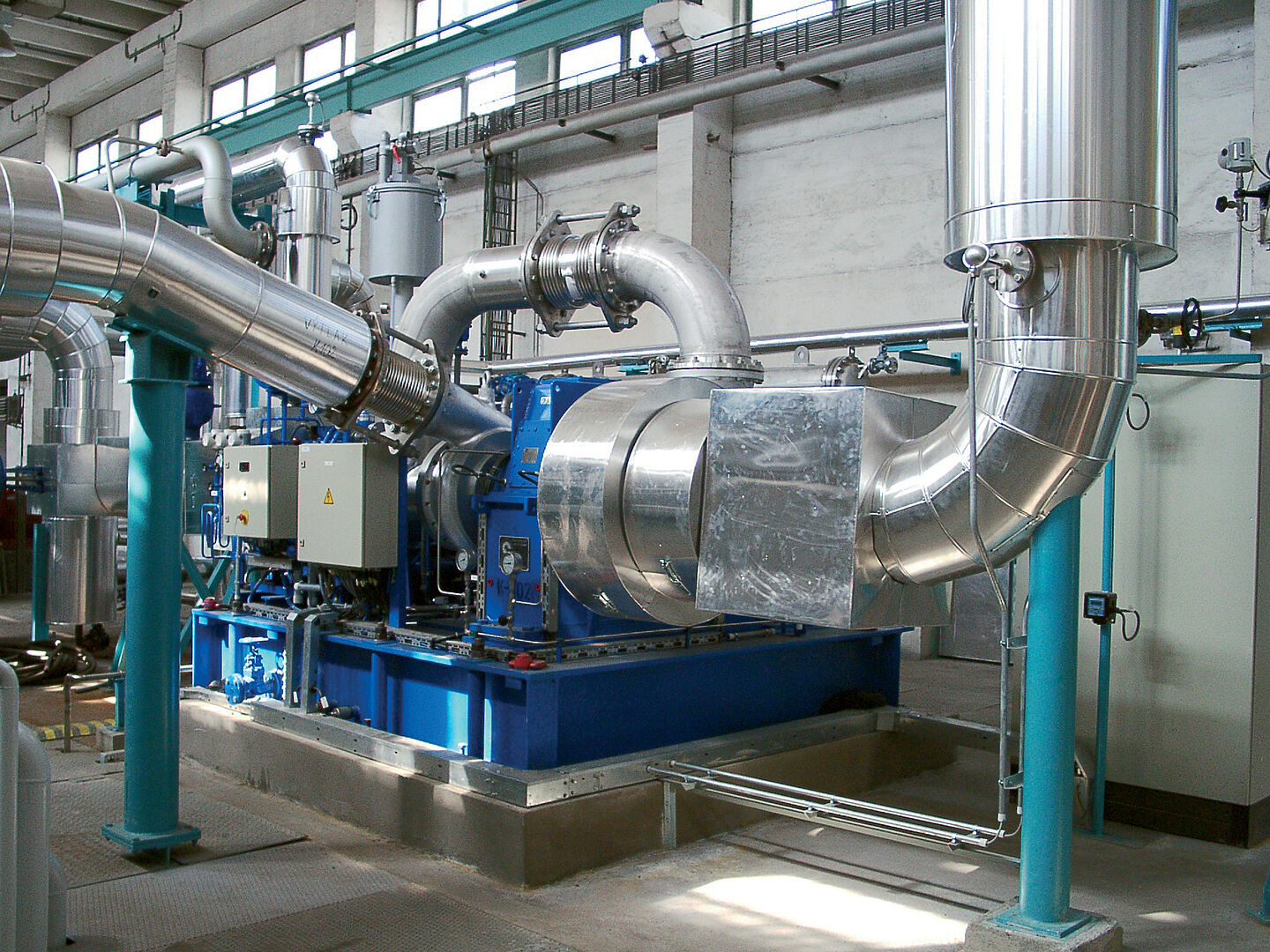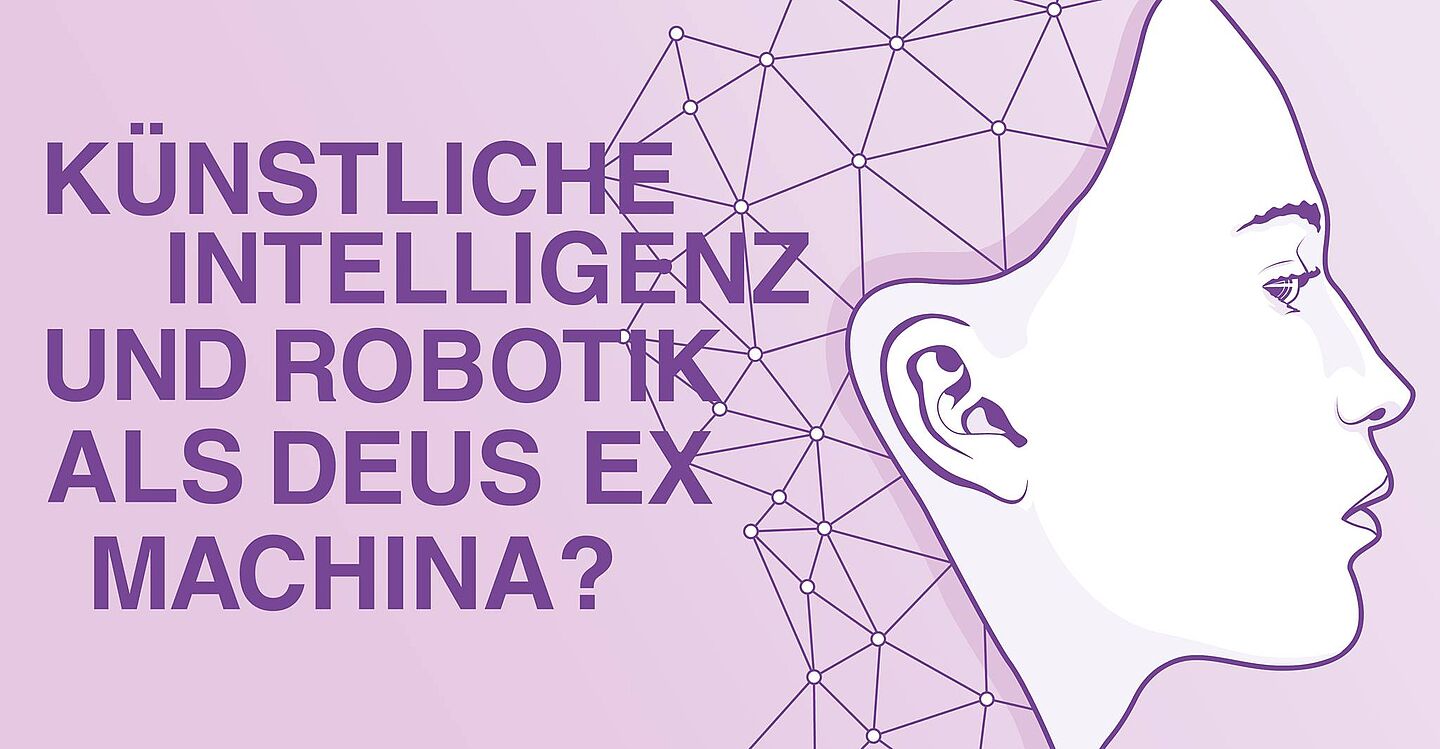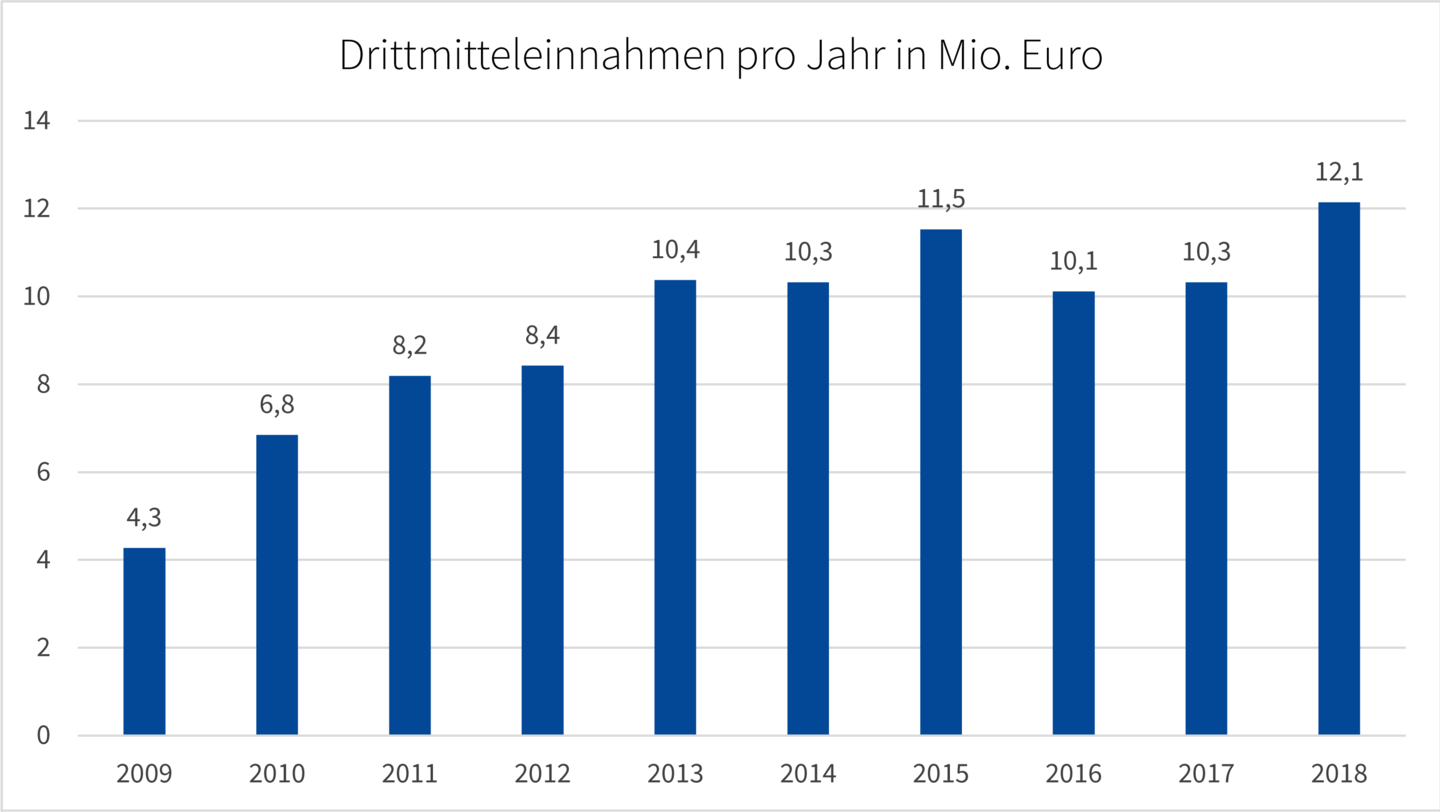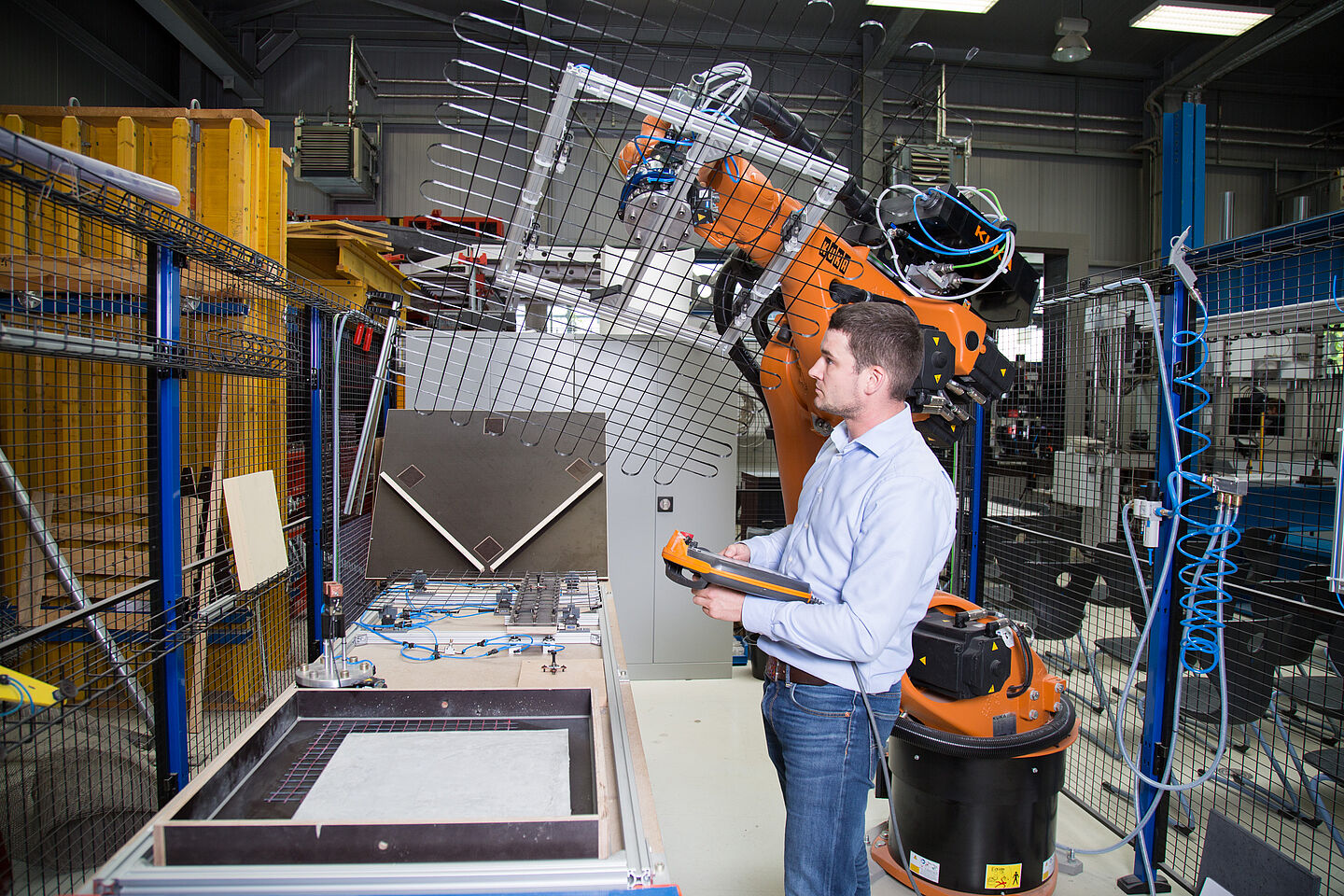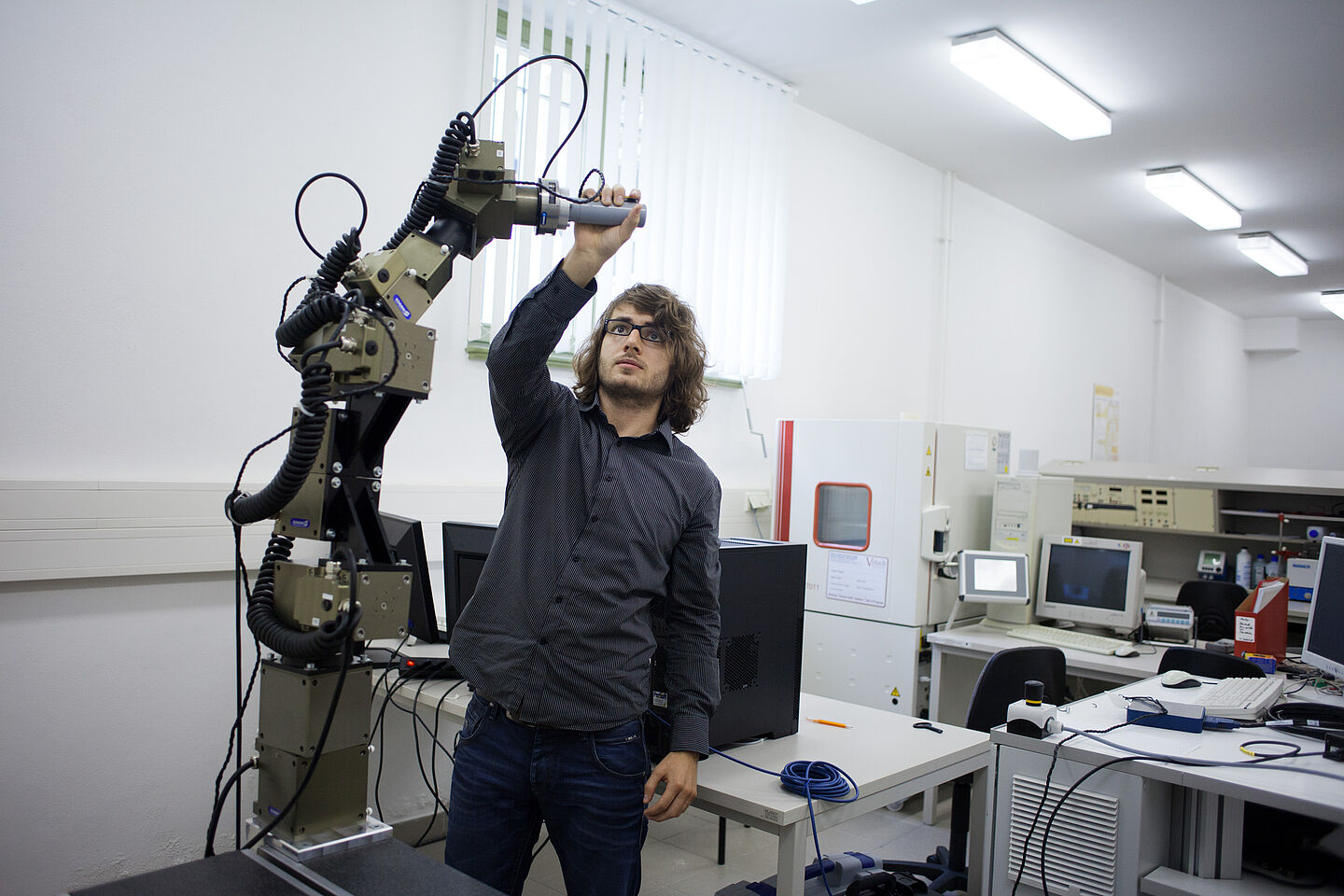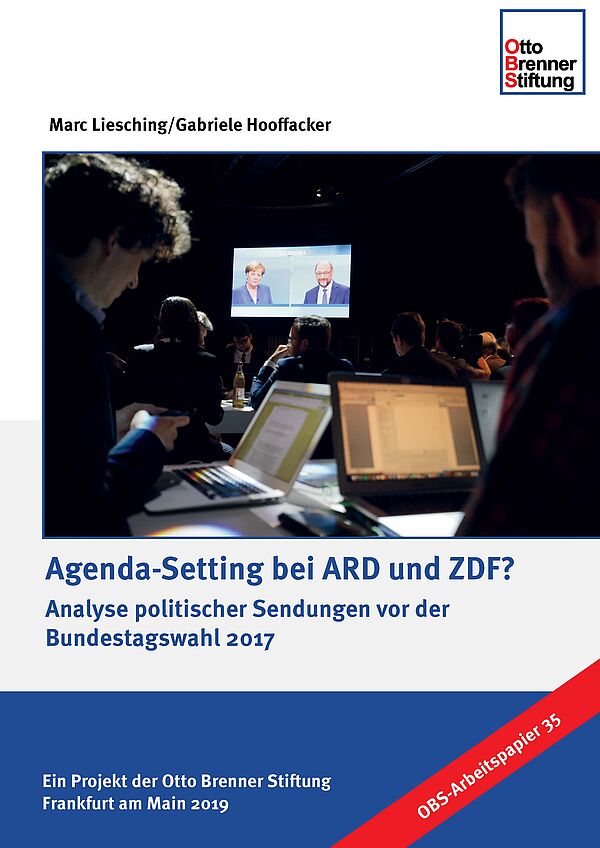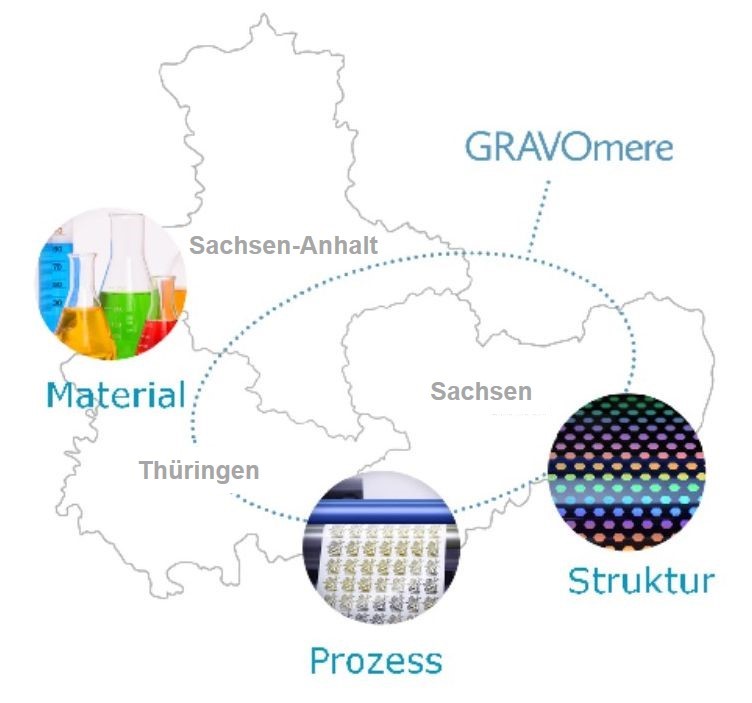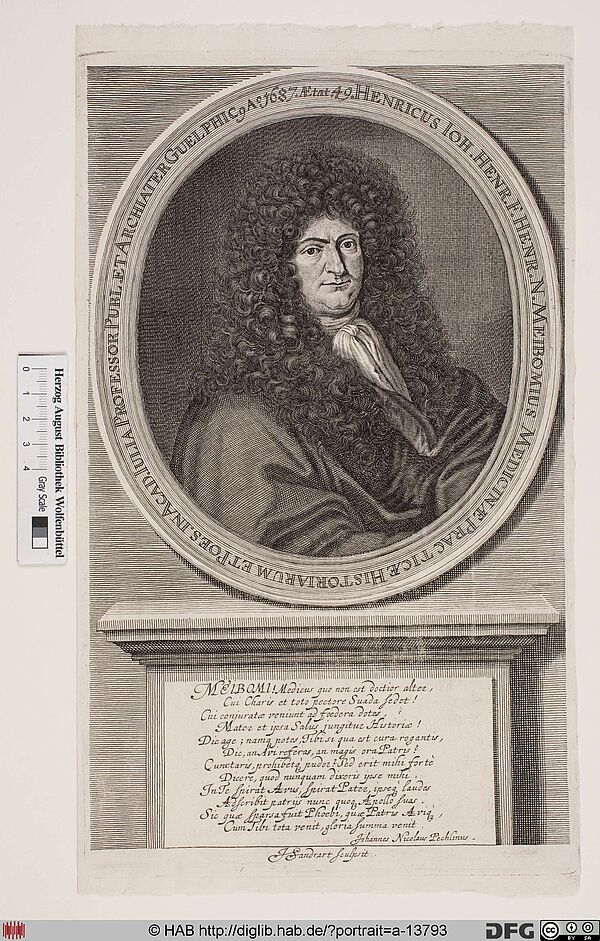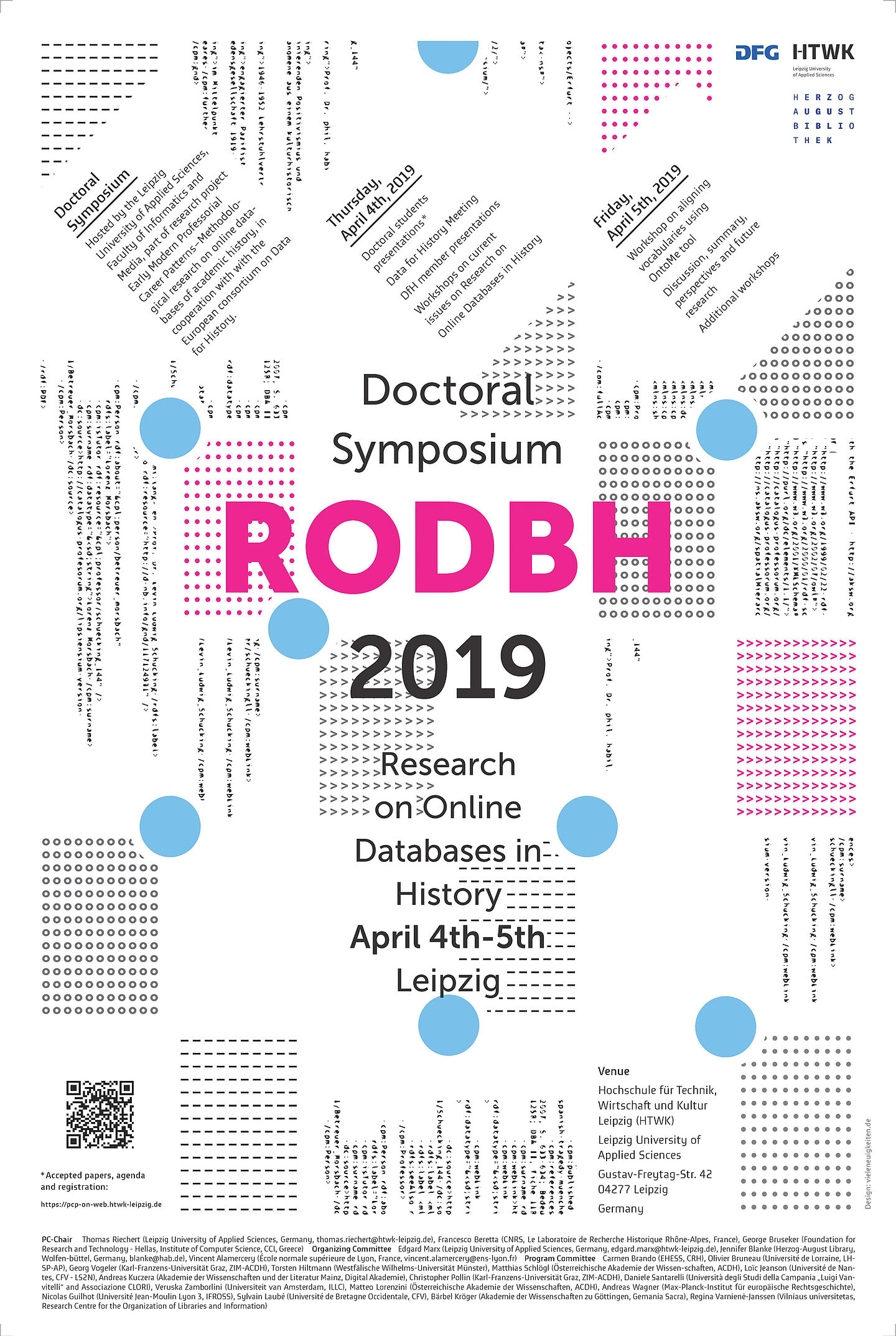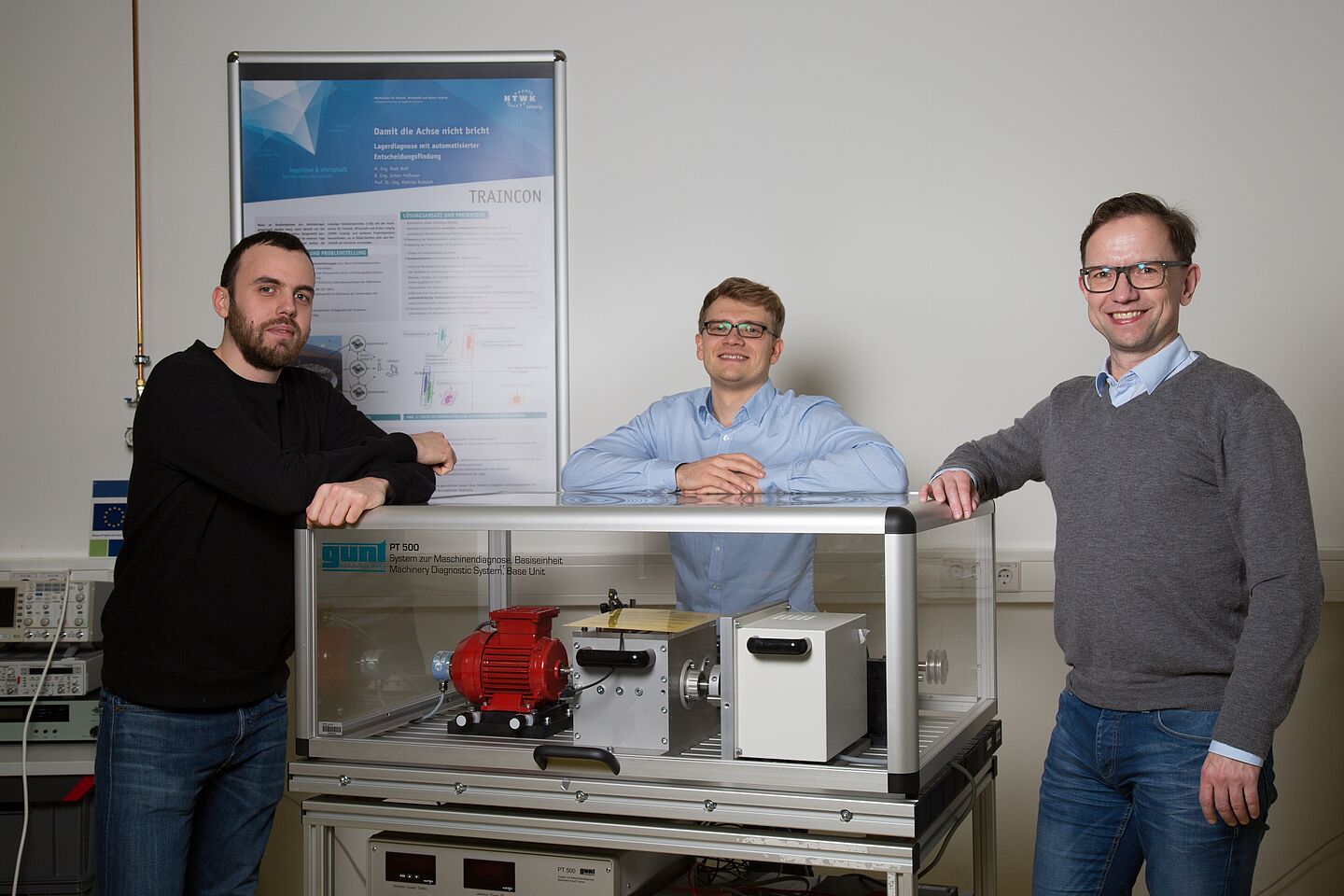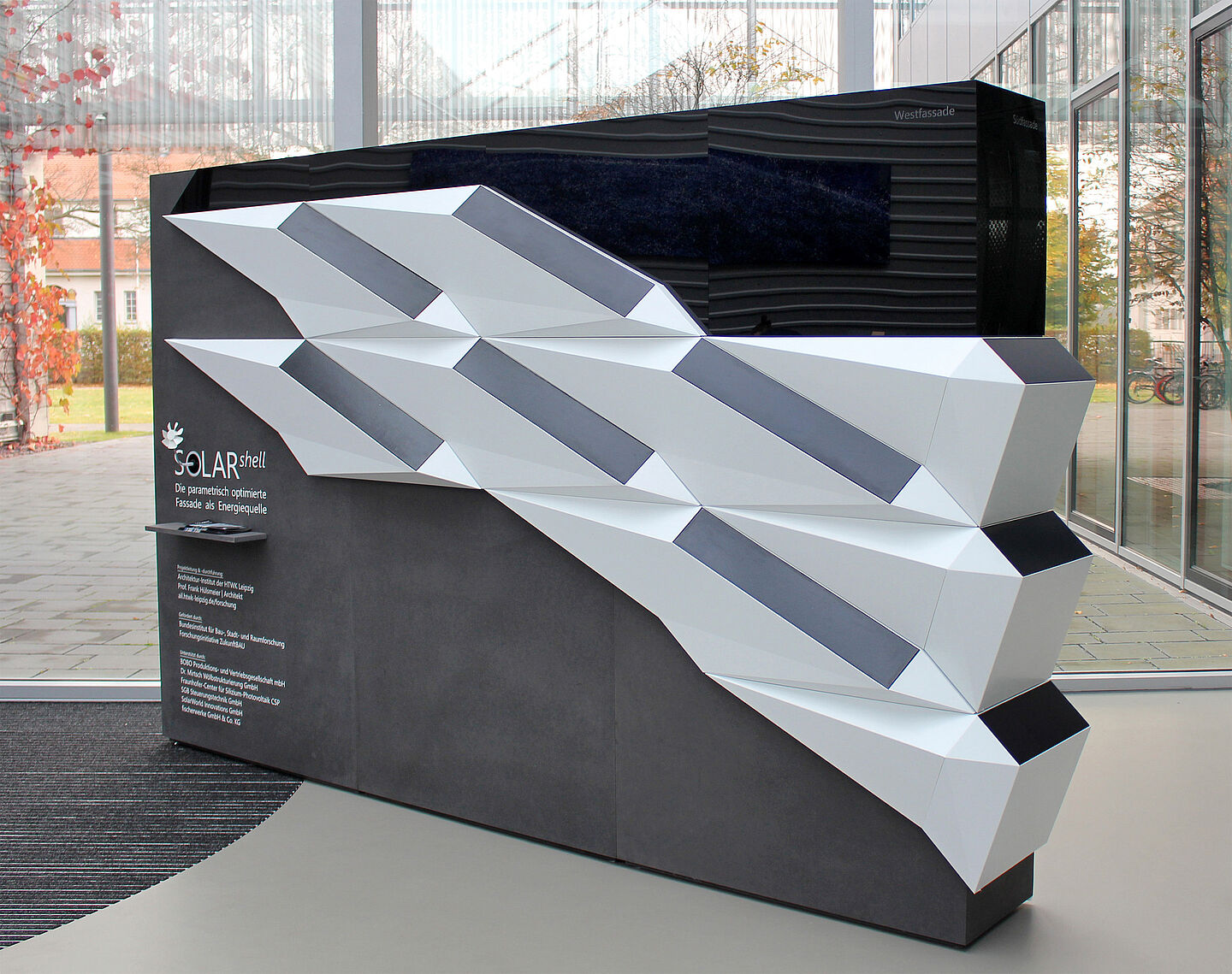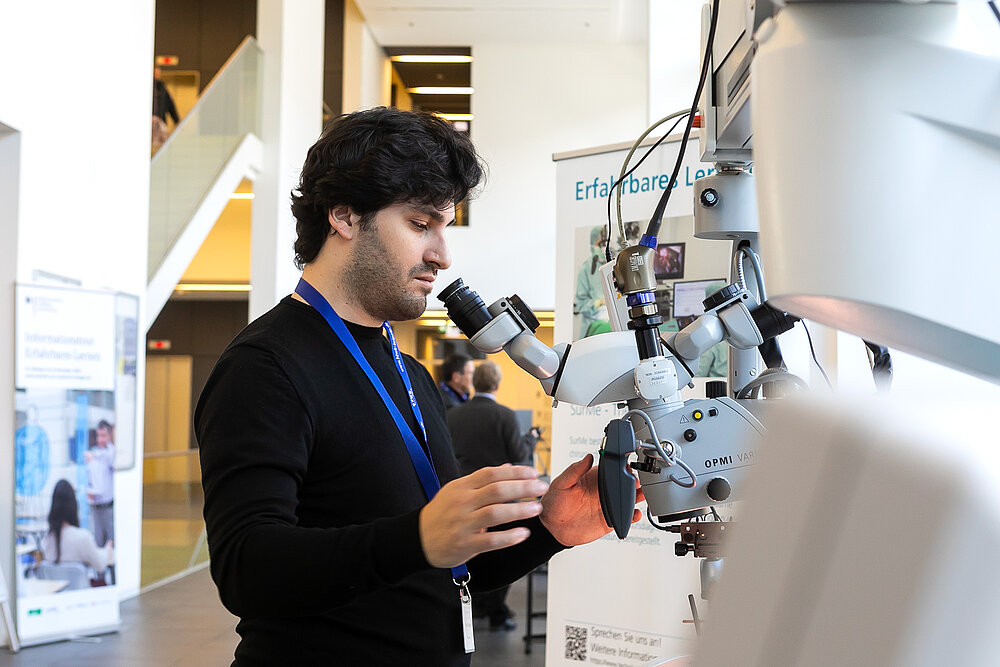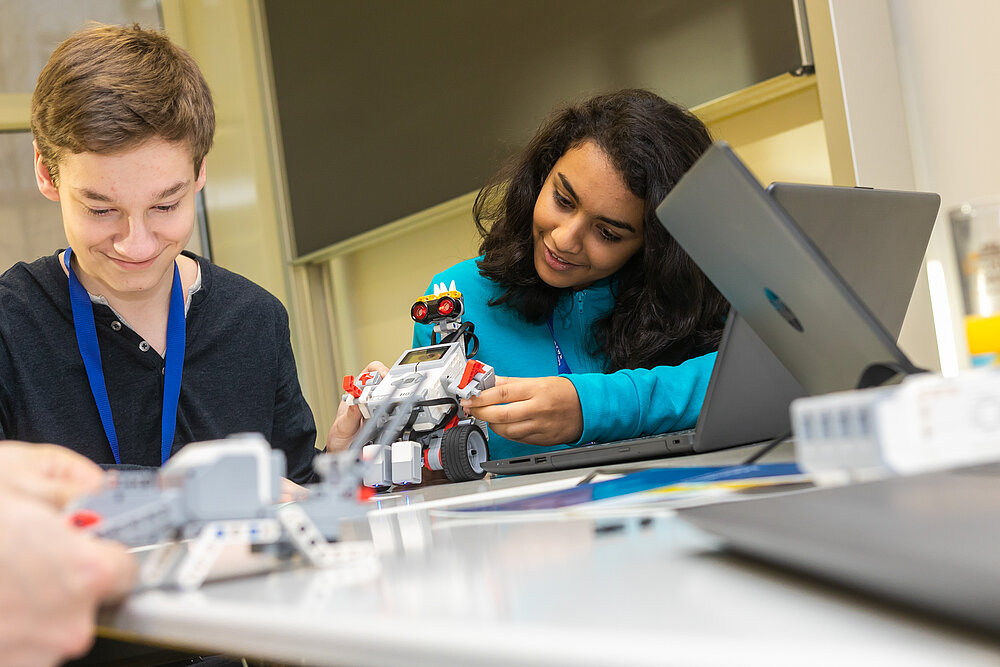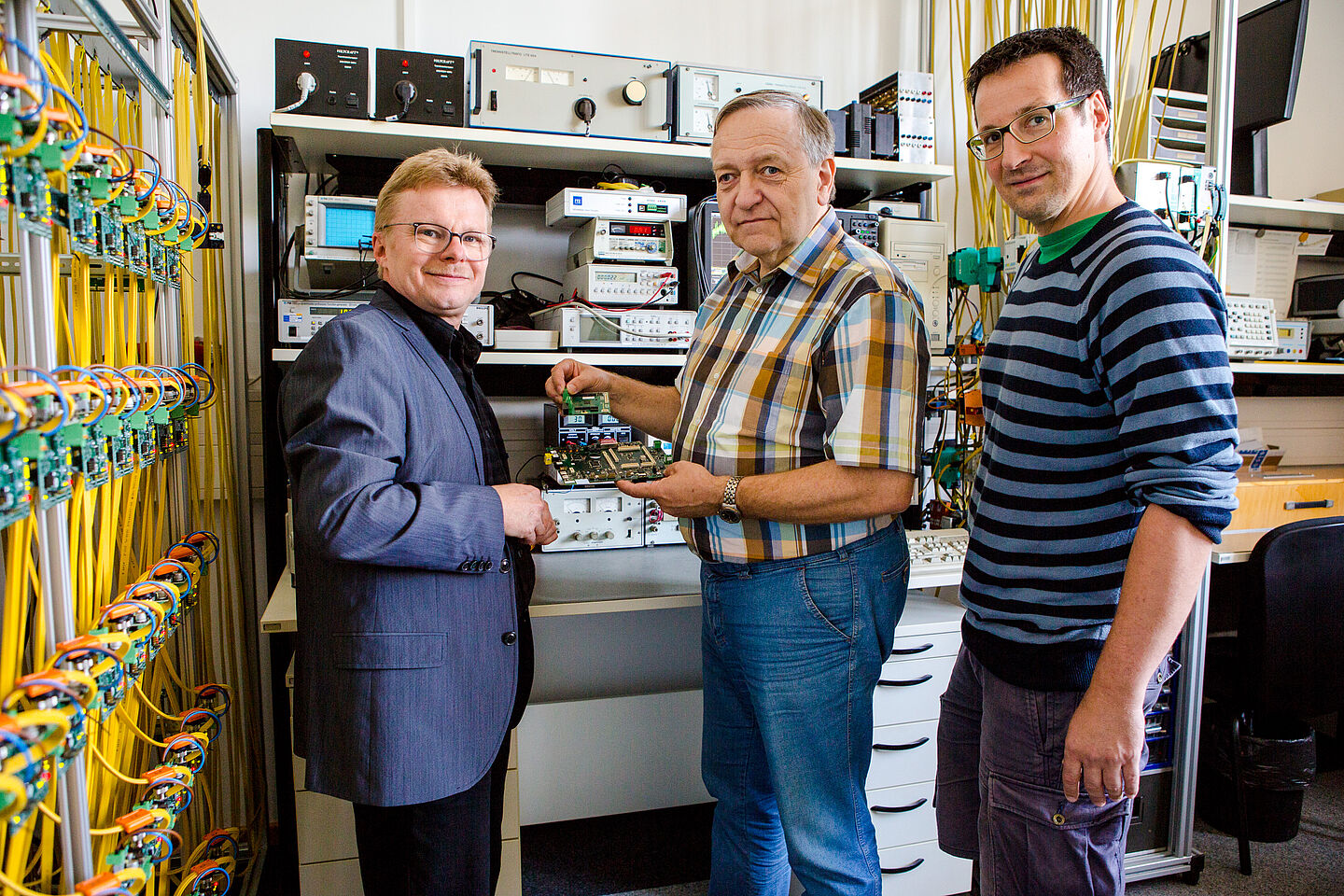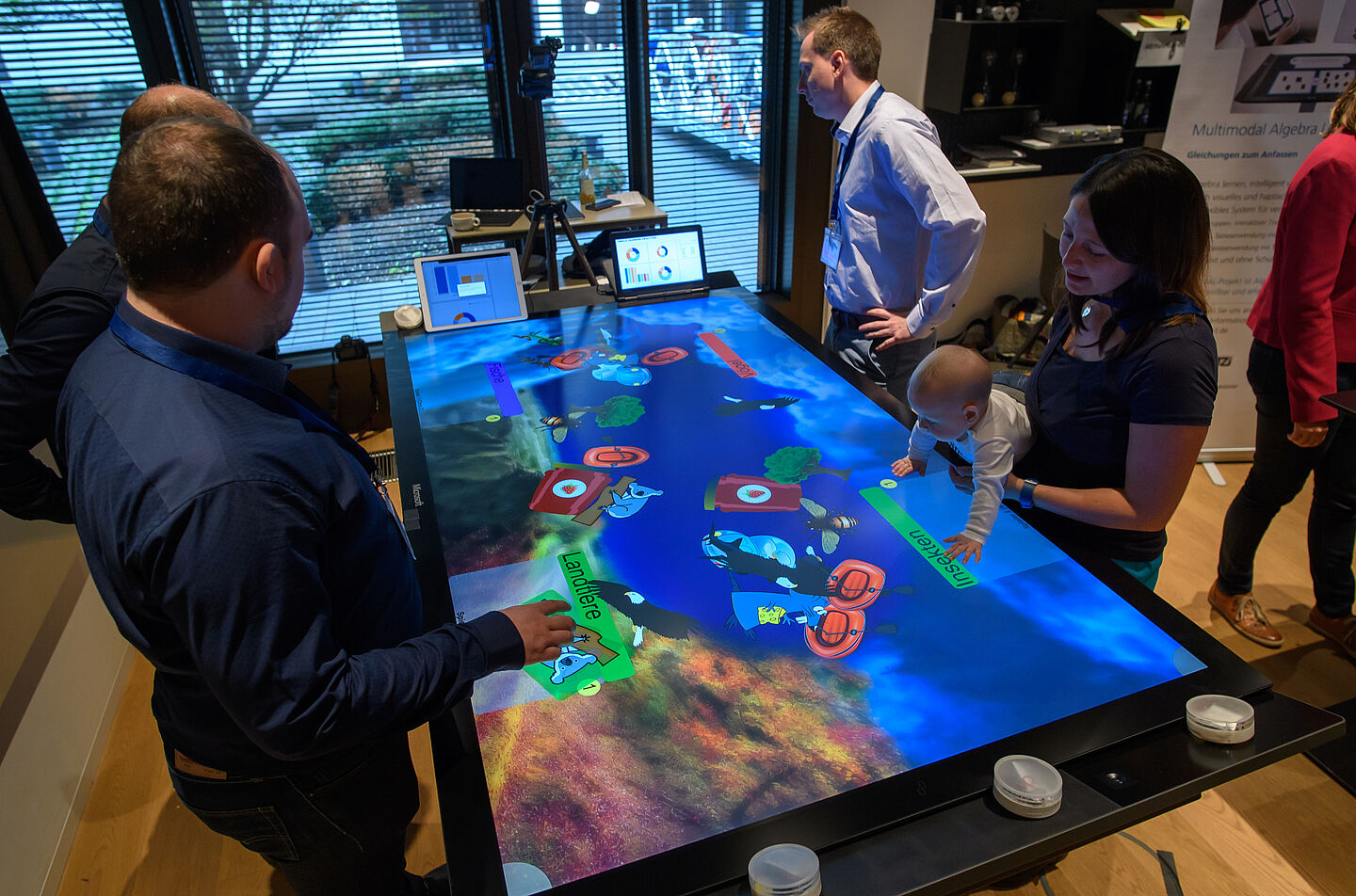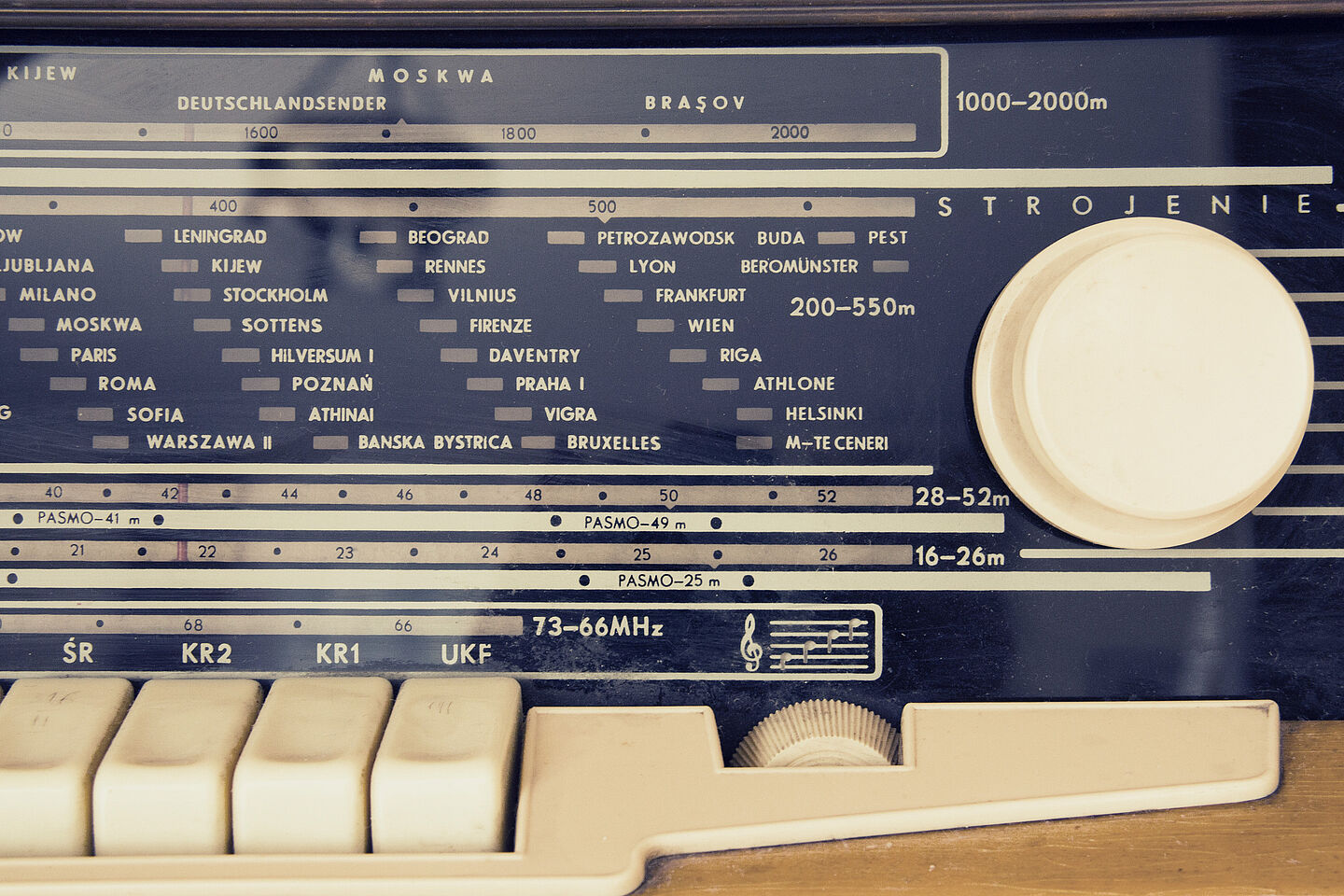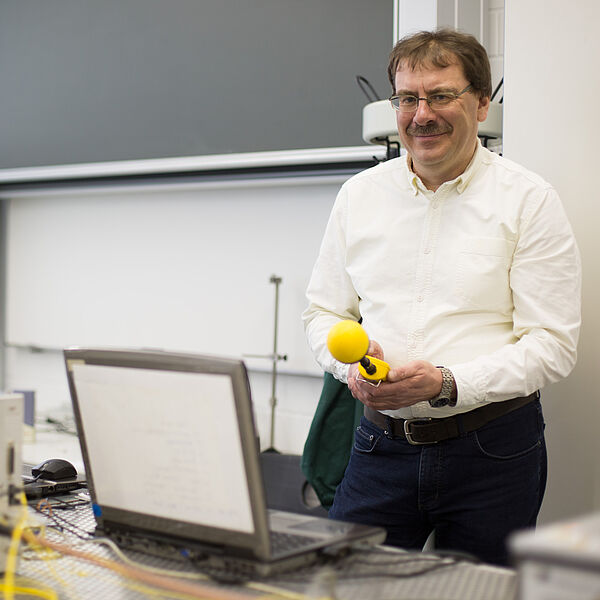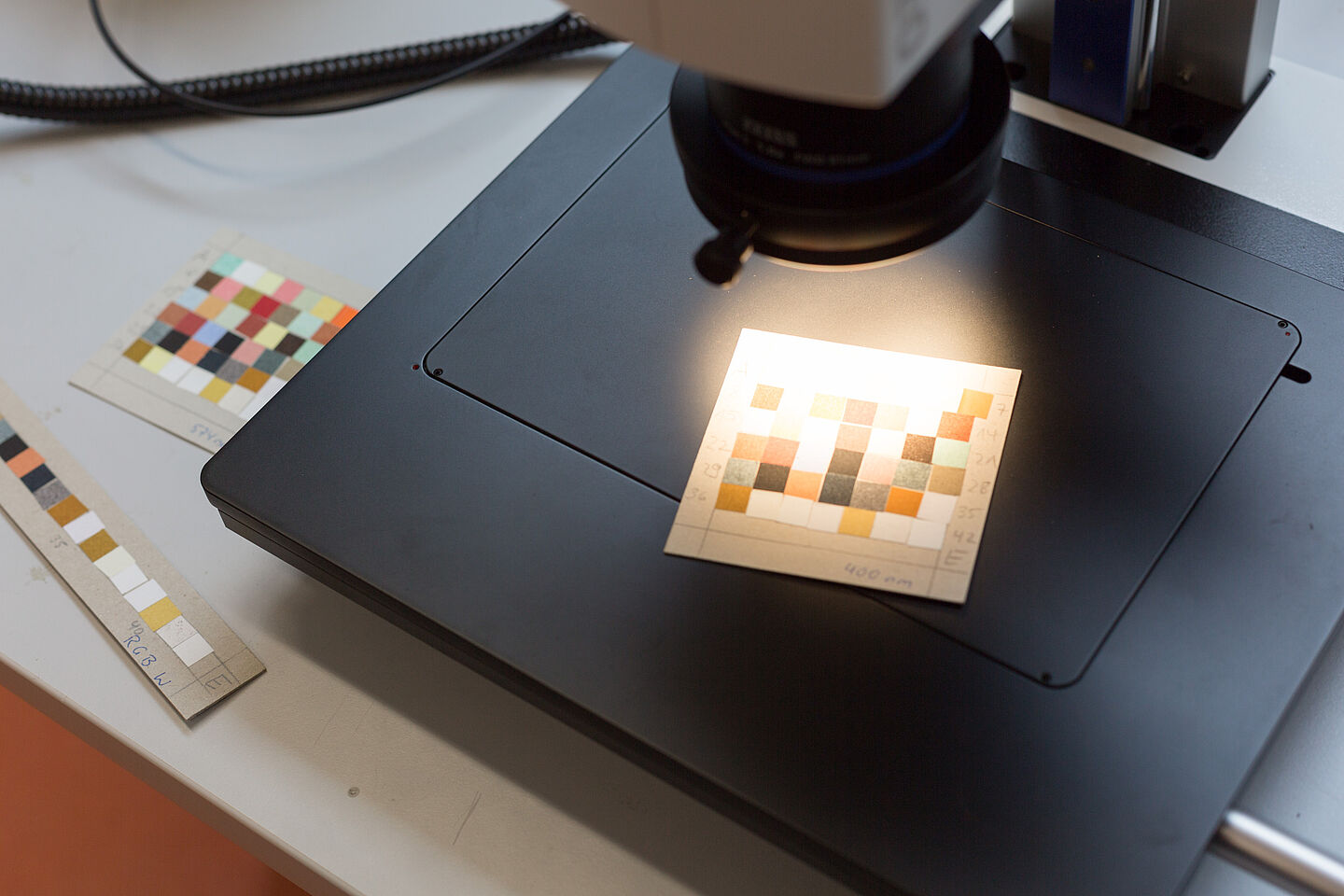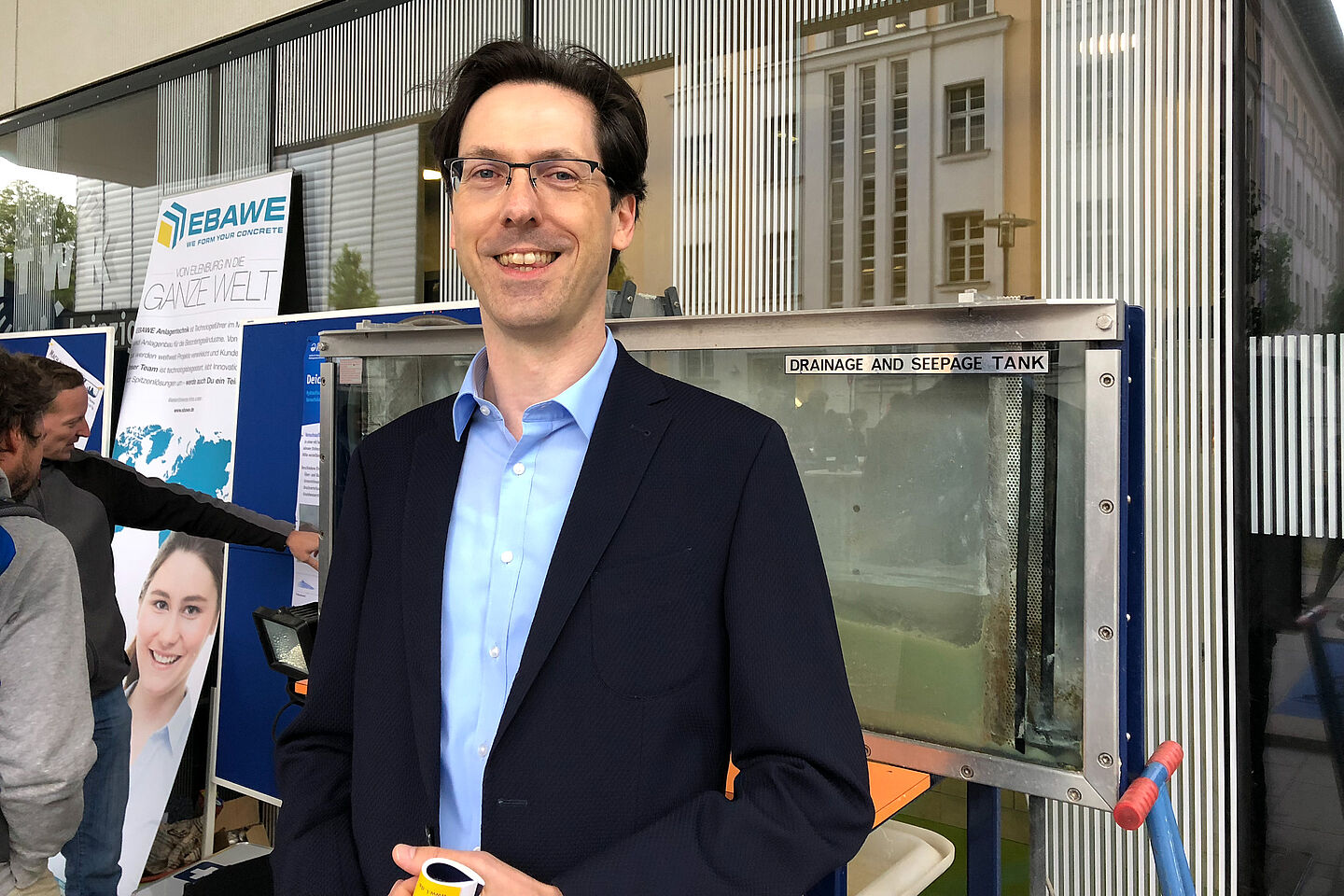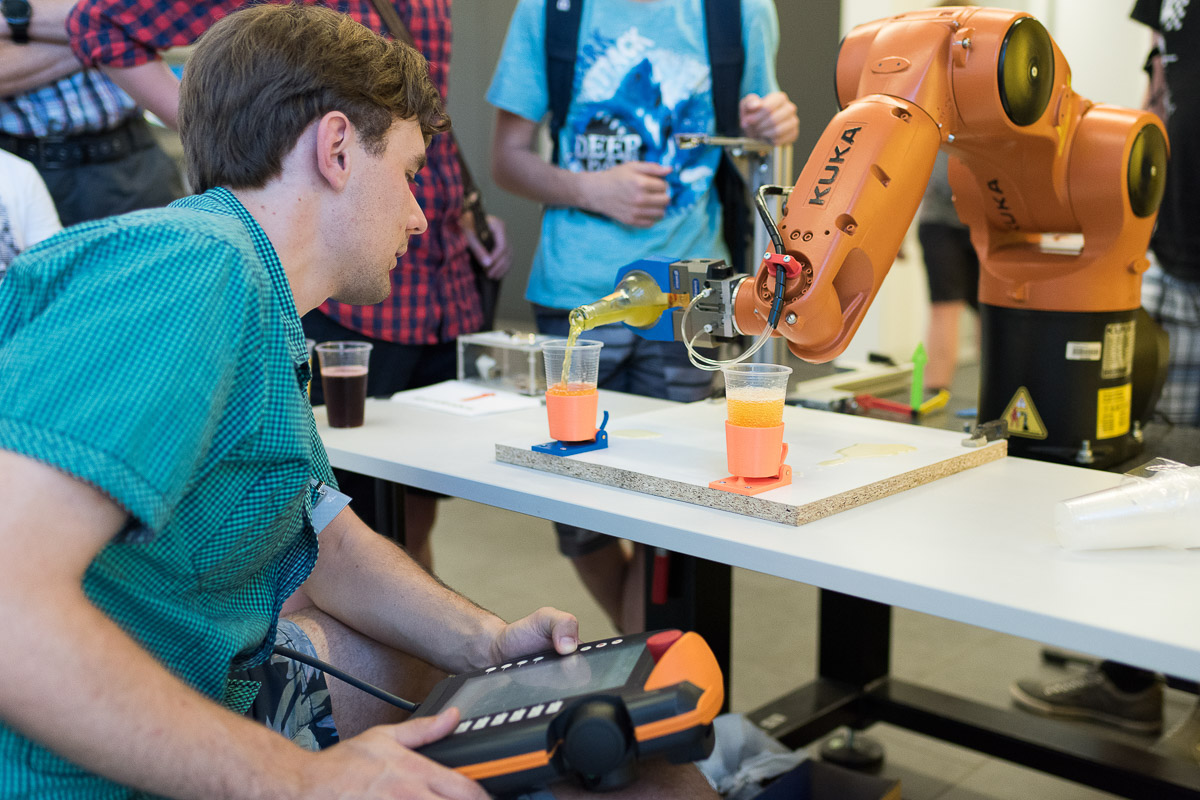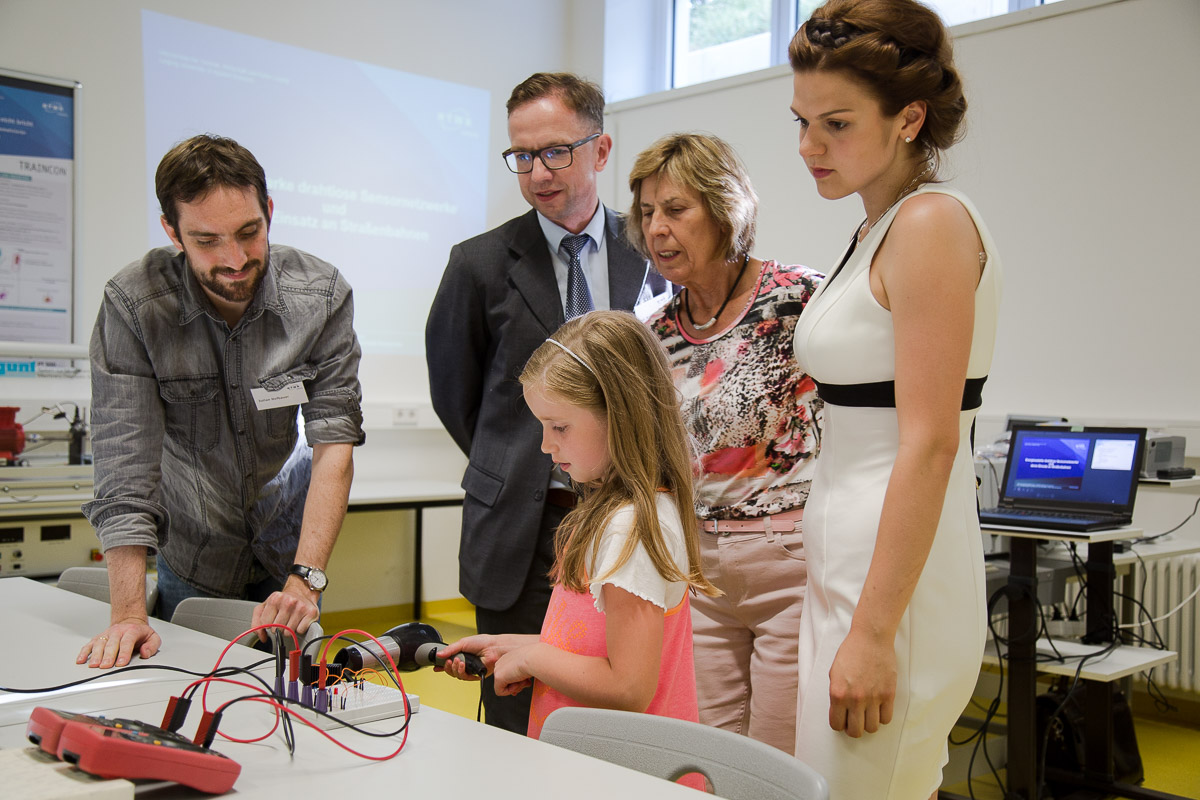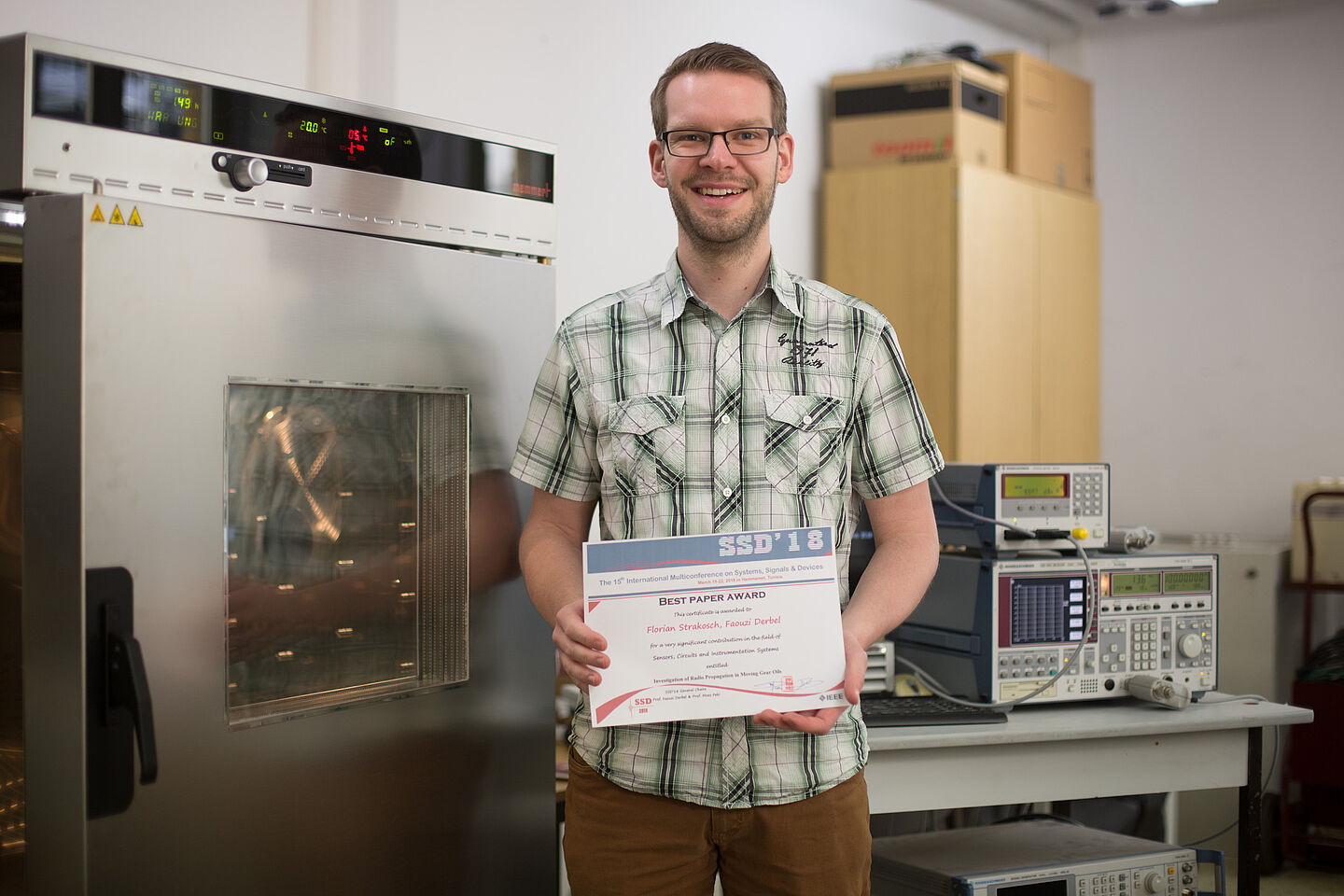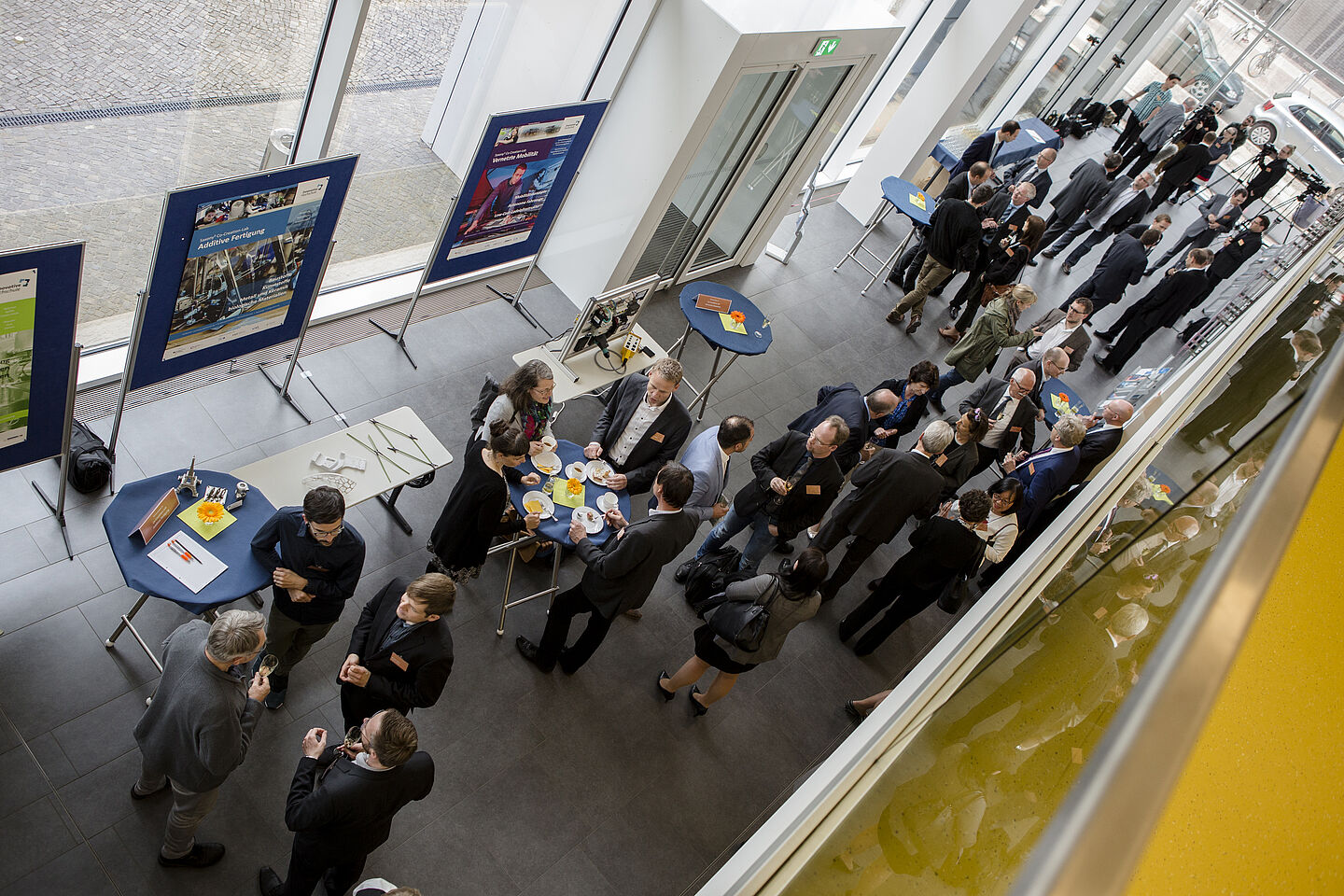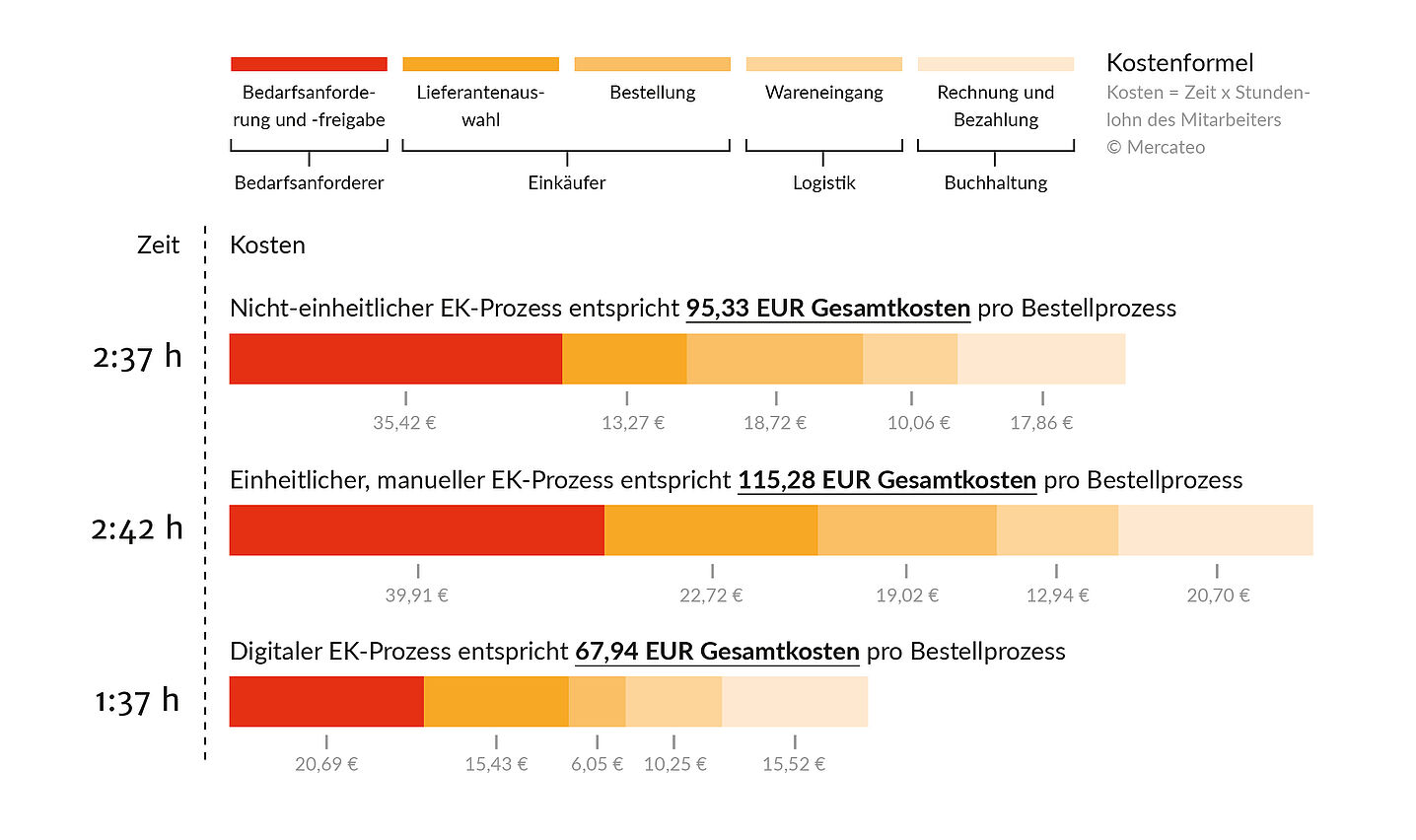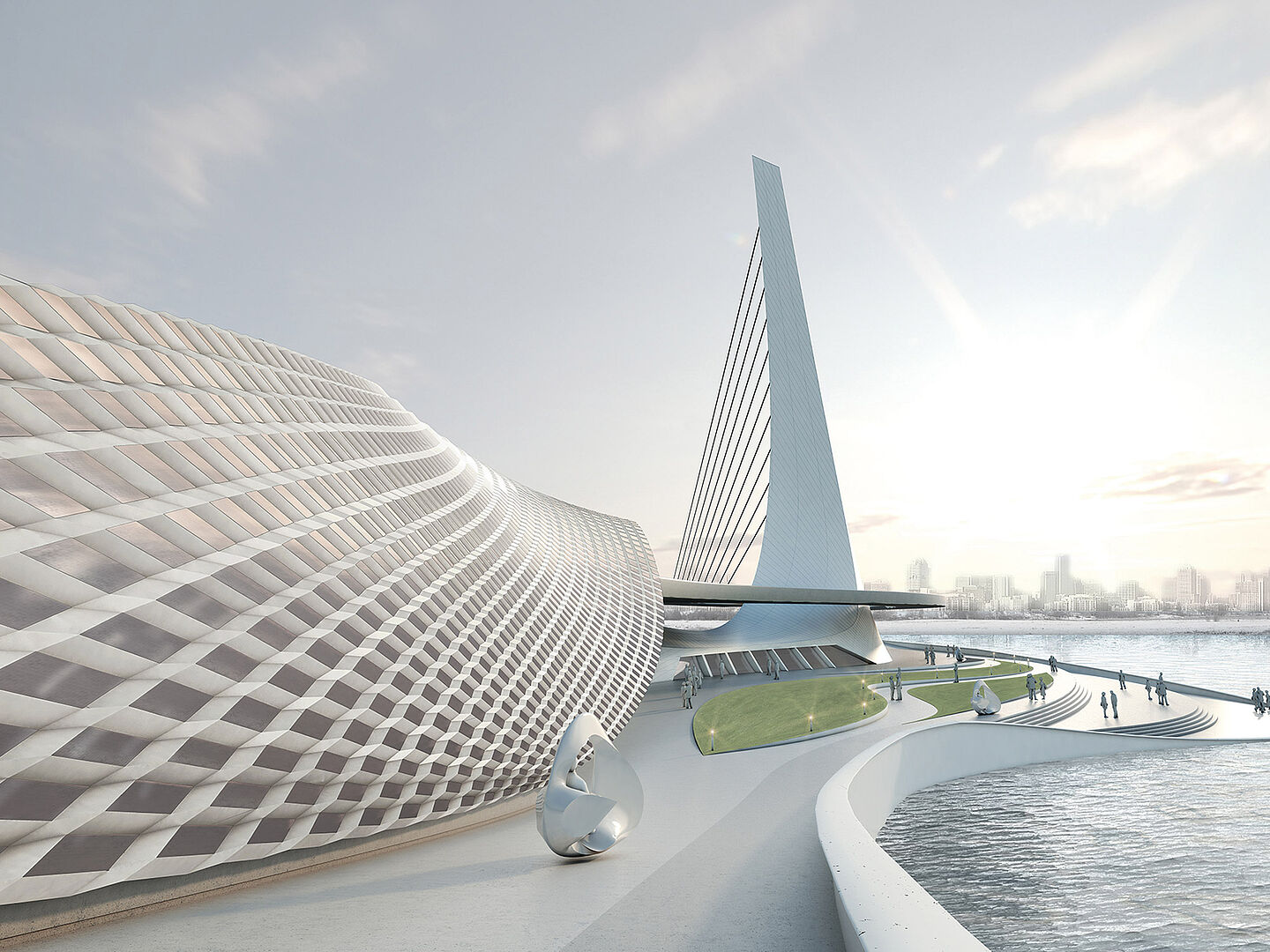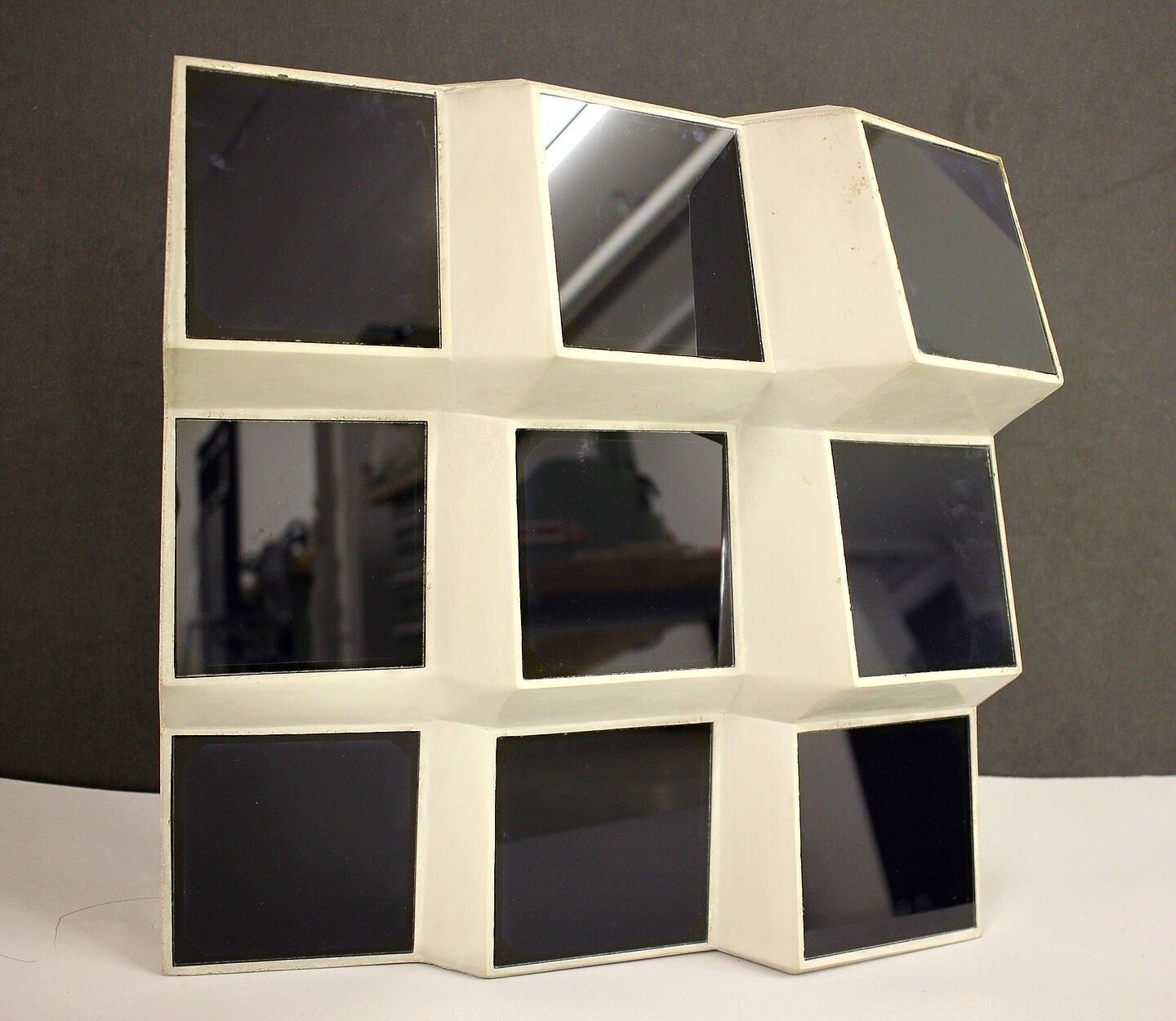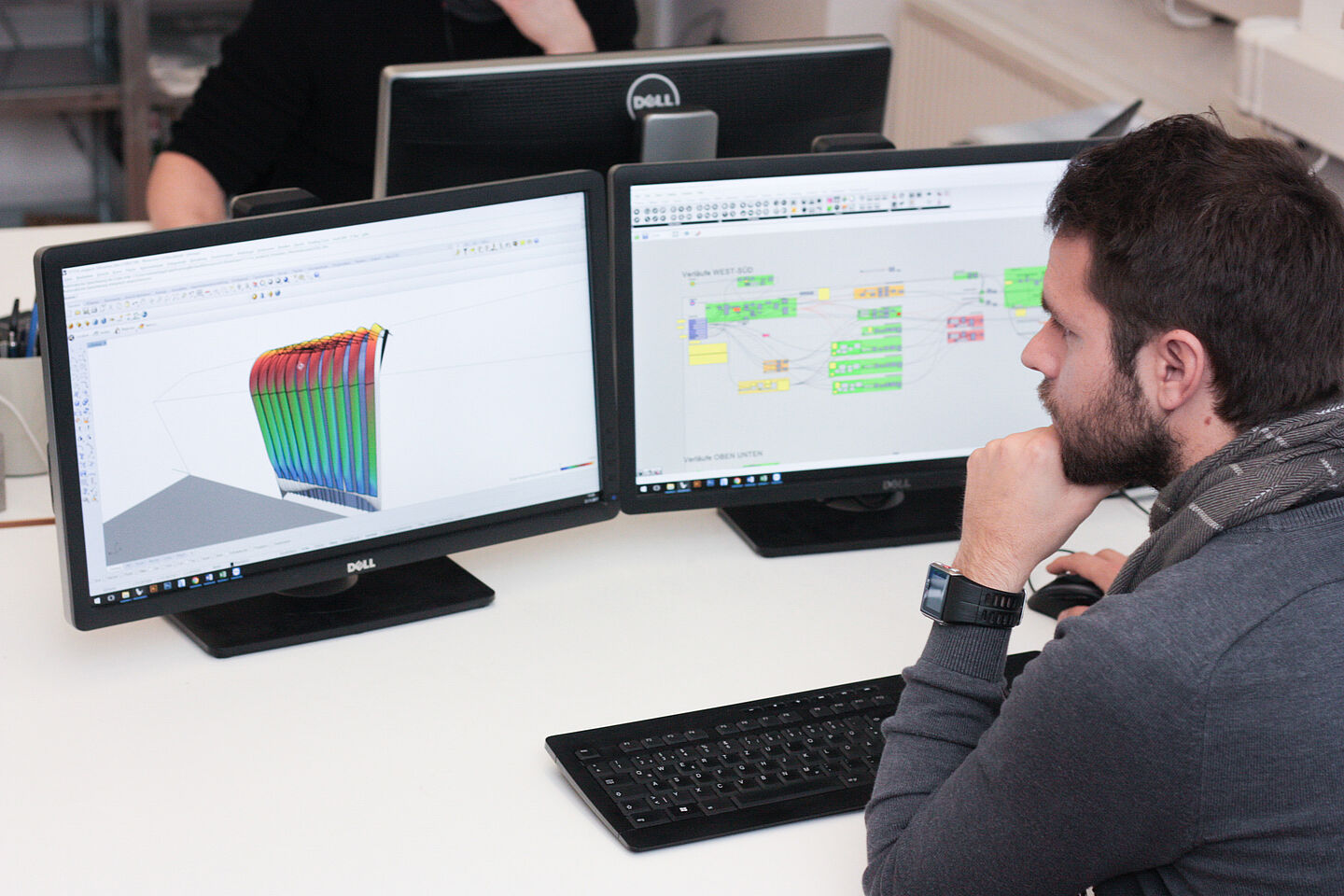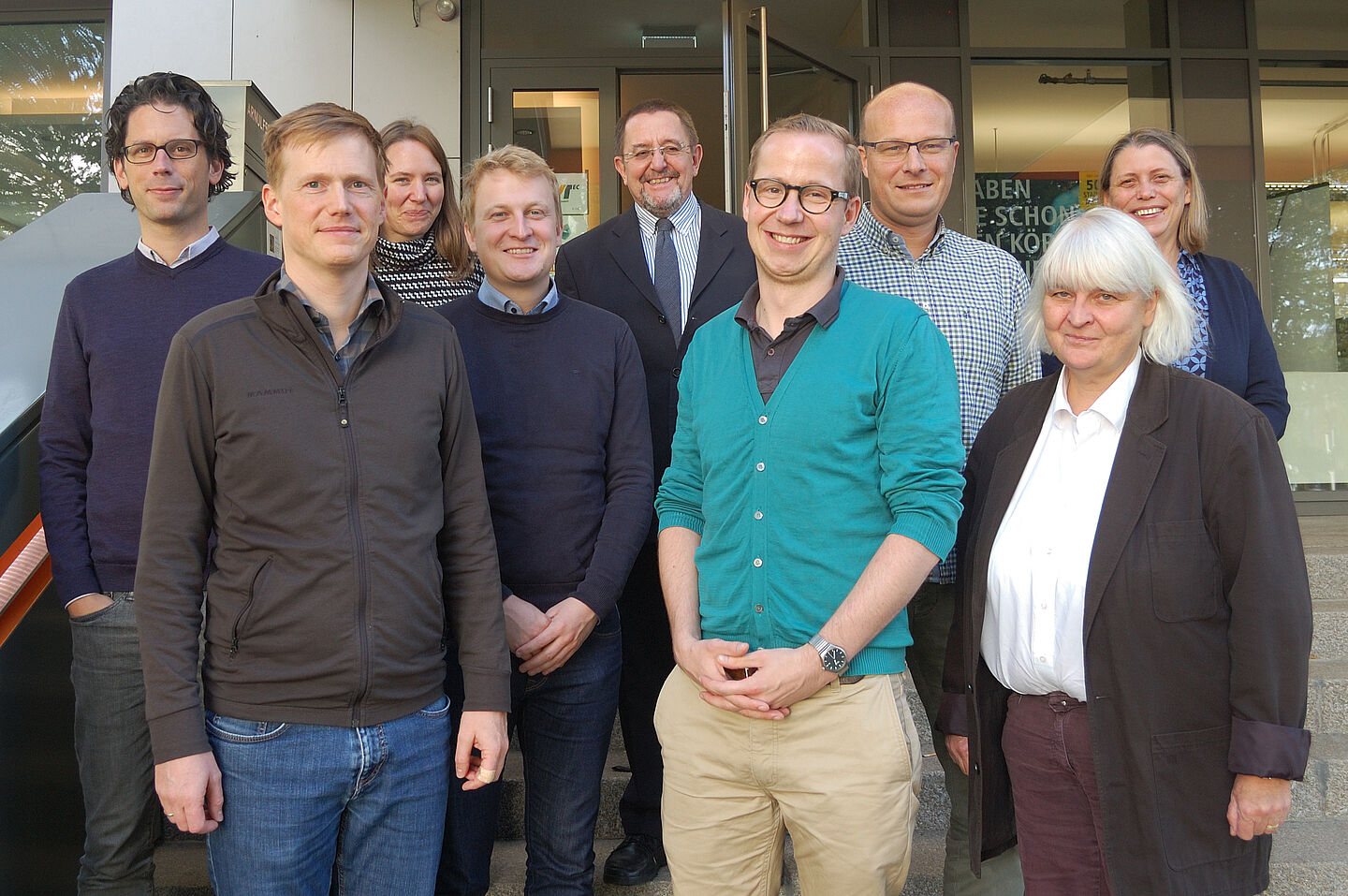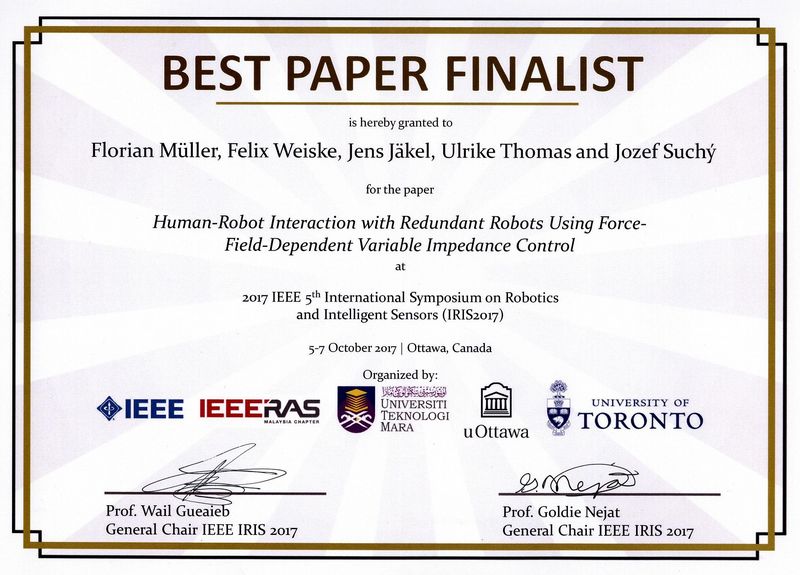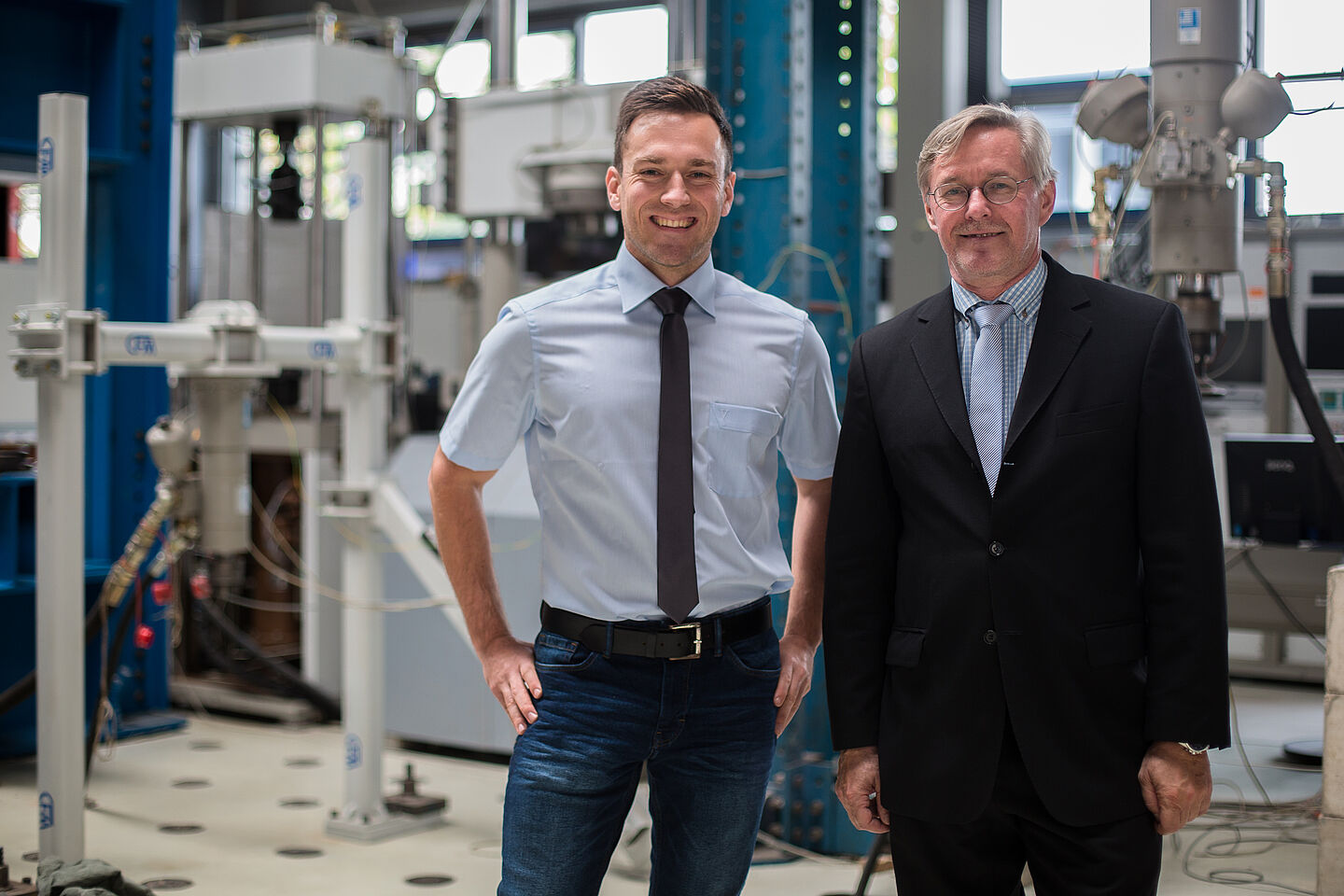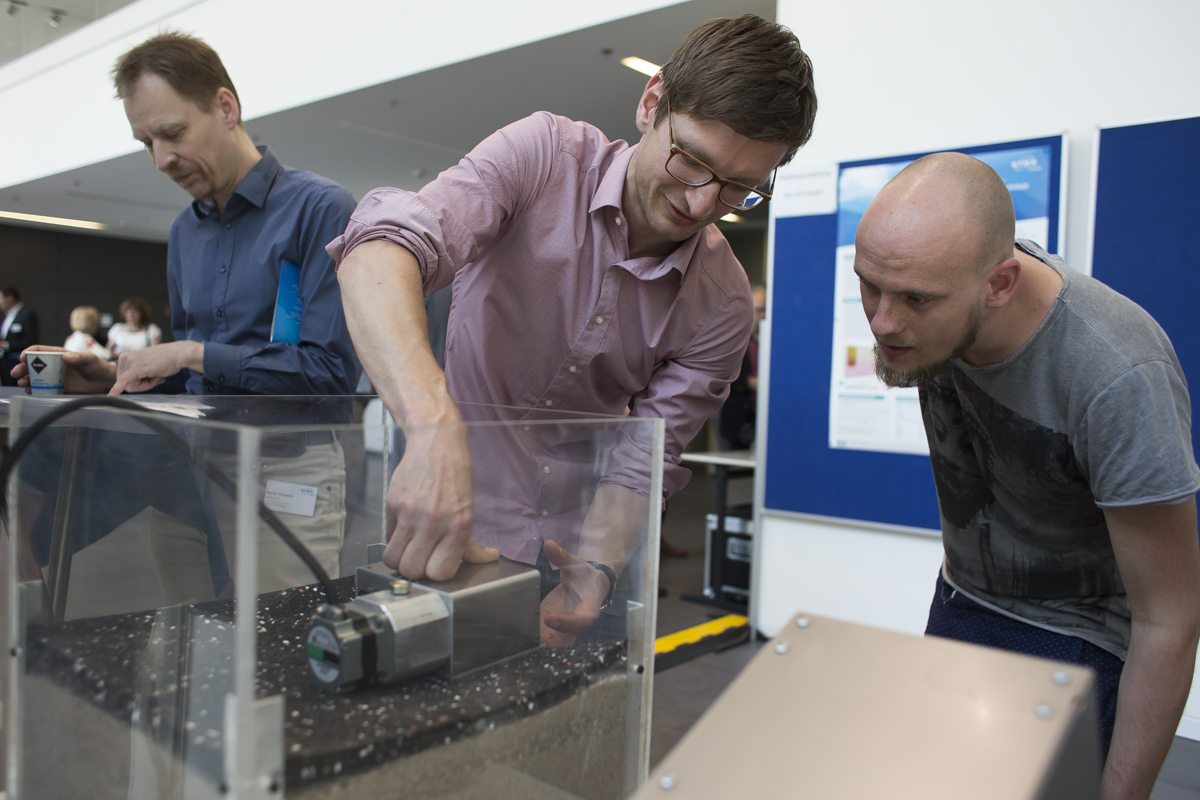Aktuelles aus der Forschung
„Wir freuen uns sehr, dass wir Gastgeber dieser bedeutenden Konferenz sein durften“, sagte Prof. Klaus Holschemacher, Direktor des Instituts für Betonbau an der HTWK Leipzig. „Gerade angesichts der technischen und gesellschaftlichen Transformationen unserer Zeit ist der rechtliche Diskurs im Bauwesen essenziell.“
Eröffnung mit Weitblick: Perspektiven auf Kooperation, Forschung und Recht
Die offizielle Eröffnung am 1. Juli in Leipzig wurde durch Grußworte aus Politik, Wissenschaft und Diplomatie eingerahmt. Prof. Klaus Holschemacher hob in seiner Rede die zentrale Rolle rechtlicher Fragestellungen für die Weiterentwicklung des Bauwesens hervor. Dirk Panter, sächsischer Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz, betonte die Bedeutung internationaler Kooperationen in Forschung und Entwicklung für den Freistaat Sachsen. Courtney Mazzone, Konsulin am US-Generalkonsulat Leipzig, verwies auf die enge und bewährte Zusammenarbeit zwischen den USA und Deutschland – auch in Wissenschaft und Technik. Prof. Faouzi Derbel, Prorektor für Forschung und Nachhaltigkeit der HTWK Leipzig, hob die Forschungskompetenz der Fakultät Bauwesen und die strategische Relevanz der Konferenz für die Hochschule hervor. Der Editor-in-Chief des Journals Dr. Lance VanDemark sagte im Nachgang: „Der internationale Workshop in Leipzig war ein zum richtigen Zeitpunkt stattfindender Workshop, der Wissenschaftler, Praktiker und Rechtsexperten zusammenbrachte, um das Verständnis von Streitigkeiten und deren Beilegung voranzubringen. Die vielfältigen Hintergründe und Wissensgebiete der Teilnehmenden trugen dazu bei, das Verständnis für Streitigkeiten zu vertiefen und das Risiko von Auseinandersetzungen in Zeiten der Globalisierung zu verringern.“
Zur thematischen Vertiefung folgten zwei Keynotes: Dr.-Ing. Matthias Tietze (C3 – Carbon Concrete Composite) sprach über regulatorische Herausforderungen beim Einsatz von Carbonbeton. Sarah Kristina Merz (Deubim) gab Einblicke in rechtliche Rahmenbedingungen und Normen bei BIM-Projekten.
Fachlich fundiert und international vernetzt

Insgesamt wurden 57 Fachvorträge gehalten – zu Themen wie Schadensersatz, Vertragsgestaltung, Streitbeilegung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Besonders gefragt waren die neuen Themen Building Information Modeling (BIM) und Vertragsmanagement. Die Vortragenden lieferten aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, die in einer LADR-Sonderausgabe veröffentlicht werden – ein wichtiges Instrument für den internationalen Wissenstransfer.
Die lebhaften Diskussionen im Anschluss an viele Vorträge zeigten, wie groß das Interesse an Austausch und Kooperation ist – über Disziplin- und Ländergrenzen hinweg.
Leipzig kennenlernen
Bereits zur Welcome Reception am Vorabend der Konferenz trafen sich die Teilnehmenden in der Kanzlei Seufert Rechtsanwälte, einem Sponsor der Veranstaltung. Bei Fingerfood und kühlen Getränken genossen sie den Blick über das alte Rathaus, und knüpften erste Kontakte in entspannter Atmosphäre.
Auch das festliche Konferenz-Dinner bot Gelegenheit zum Austausch über Forschungsthemen hinaus. Den Abschluss bildete ein Stadtrundgang durch Leipzig mit Besuch des traditionsreichen Auerbachs Keller, in dem schon Goethes Faust zu Tisch saß.
Bildimpressionen
„Wir freuen uns sehr, dass wir Gastgeber dieser bedeutenden Konferenz sein durften“, sagte Prof. Klaus Holschemacher, Direktor des Instituts für Betonbau an der HTWK Leipzig. „Gerade angesichts der technischen und gesellschaftlichen Transformationen unserer Zeit ist der rechtliche Diskurs im Bauwesen essenziell.“
Eröffnung mit Weitblick: Perspektiven auf Kooperation, Forschung und Recht
Die offizielle Eröffnung am 1. Juli in Leipzig wurde durch Grußworte aus Politik, Wissenschaft und Diplomatie eingerahmt. Prof. Klaus Holschemacher hob in seiner Rede die zentrale Rolle rechtlicher Fragestellungen für die Weiterentwicklung des Bauwesens hervor. Dirk Panter, sächsischer Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz, betonte die Bedeutung internationaler Kooperationen in Forschung und Entwicklung für den Freistaat Sachsen. Courtney Mazzone, Konsulin am US-Generalkonsulat Leipzig, verwies auf die enge und bewährte Zusammenarbeit zwischen den USA und Deutschland – auch in Wissenschaft und Technik. Prof. Faouzi Derbel, Prorektor für Forschung und Nachhaltigkeit der HTWK Leipzig, hob die Forschungskompetenz der Fakultät Bauwesen und die strategische Relevanz der Konferenz für die Hochschule hervor. Der Editor-in-Chief des Journals Dr. Lance VanDemark sagte im Nachgang: „Der internationale Workshop in Leipzig war ein zum richtigen Zeitpunkt stattfindender Workshop, der Wissenschaftler, Praktiker und Rechtsexperten zusammenbrachte, um das Verständnis von Streitigkeiten und deren Beilegung voranzubringen. Die vielfältigen Hintergründe und Wissensgebiete der Teilnehmenden trugen dazu bei, das Verständnis für Streitigkeiten zu vertiefen und das Risiko von Auseinandersetzungen in Zeiten der Globalisierung zu verringern.“
Zur thematischen Vertiefung folgten zwei Keynotes: Dr.-Ing. Matthias Tietze (C3 – Carbon Concrete Composite) sprach über regulatorische Herausforderungen beim Einsatz von Carbonbeton. Sarah Kristina Merz (Deubim) gab Einblicke in rechtliche Rahmenbedingungen und Normen bei BIM-Projekten.
Fachlich fundiert und international vernetzt

Insgesamt wurden 57 Fachvorträge gehalten – zu Themen wie Schadensersatz, Vertragsgestaltung, Streitbeilegung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Besonders gefragt waren die neuen Themen Building Information Modeling (BIM) und Vertragsmanagement. Die Vortragenden lieferten aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, die in einer LADR-Sonderausgabe veröffentlicht werden – ein wichtiges Instrument für den internationalen Wissenstransfer.
Die lebhaften Diskussionen im Anschluss an viele Vorträge zeigten, wie groß das Interesse an Austausch und Kooperation ist – über Disziplin- und Ländergrenzen hinweg.
Leipzig kennenlernen
Bereits zur Welcome Reception am Vorabend der Konferenz trafen sich die Teilnehmenden in der Kanzlei Seufert Rechtsanwälte, einem Sponsor der Veranstaltung. Bei Fingerfood und kühlen Getränken genossen sie den Blick über das alte Rathaus, und knüpften erste Kontakte in entspannter Atmosphäre.
Auch das festliche Konferenz-Dinner bot Gelegenheit zum Austausch über Forschungsthemen hinaus. Den Abschluss bildete ein Stadtrundgang durch Leipzig mit Besuch des traditionsreichen Auerbachs Keller, in dem schon Goethes Faust zu Tisch saß.
Bildimpressionen
Gastwissenschaftler Ph.D. Joan Larrahondo konzentriert sich in seiner Forschung auf Themen der Geo- und Umwelttechnik. Er beschäftigt sich unter anderem mit Bergbauabfällen, Mülldeponien, gashaltigen Böden, Schadstoffbarrieren, hydrophoben mineralischen Oberflächen und oberflächennaher geothermischer Energie. Larrahondo unterrichtet an seiner Heimatuniversität Kurse in Bodenmechanik, Geotechnik, Umweltgeotechnik sowie Ingenieurgeologie.
Die Pontificia Universidad Javeriana, eine Privatuniversität, welche bereits 1623 gegründet wurde und zu den ältesten sowie renommiertesten Universitäten Südamerikas zählt, besteht aus 18 Fakultäten und bietet mehr als 200 Studiengänge, unter anderem in den Bereichen Medizin, Ingenieurwesen, Architektur, Theologie, Jura und Sozialwissenschaften, an. Darüber hinaus verfügt die Pontificia Universidad Javeriana über eine starke Forschungskultur.
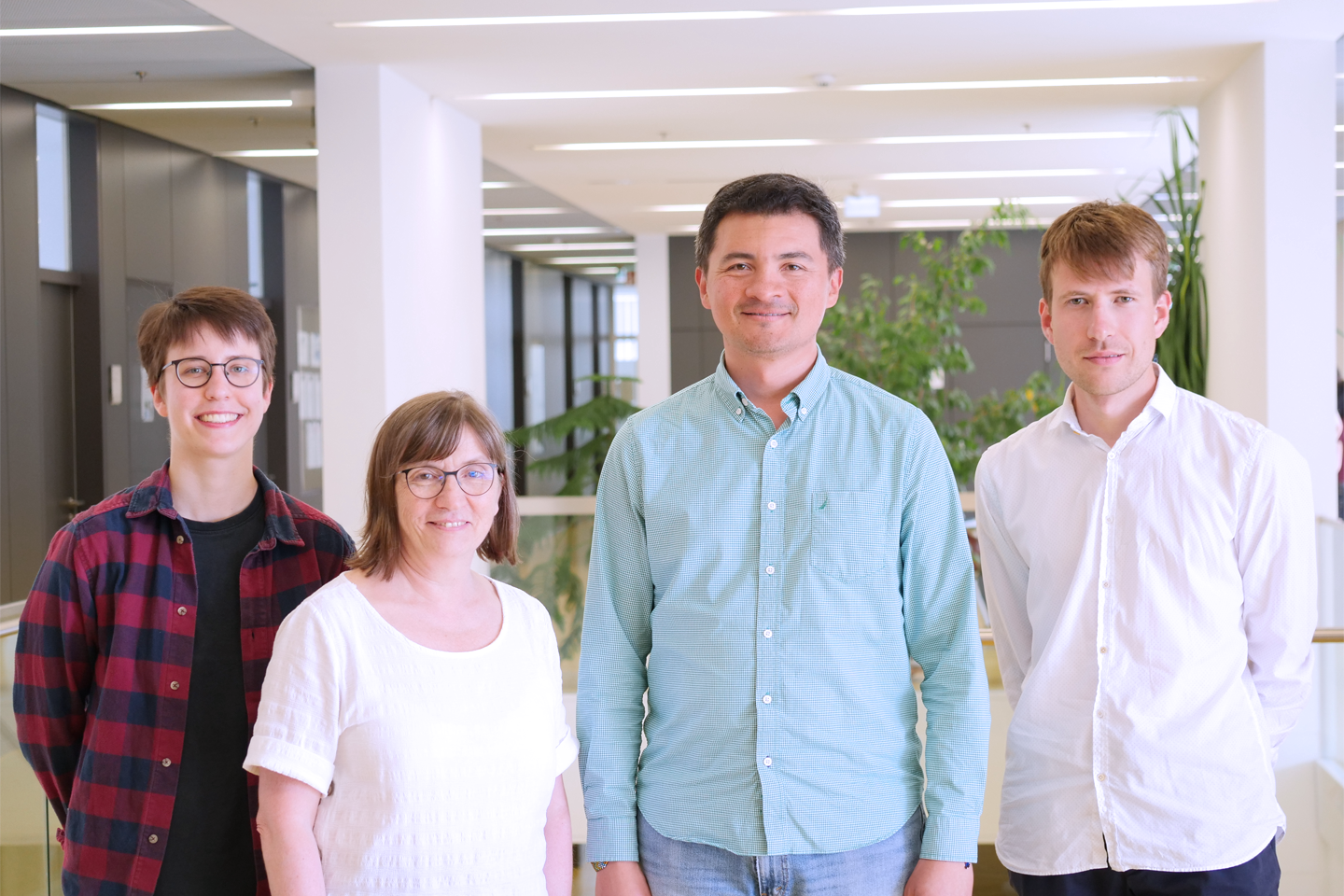
Die Zusammensetzung des deponierten Abfalls ist in Deutschland und Kolumbien sehr unterschiedlich, dabei ist insbesondere der Anteil organischer Bestandteile in Deutschland seit 2005 auf unter fünf Prozent begrenzt. In Kolumbien erfolgt keine Trennung des Haushaltsmülls, sodass der Abfall dort einen Anteil von bis zu 70 Prozent organischen Materials aufweisen kann. Bei der biochemischen Zersetzung der organischen Bestandteile entsteht neben Biogas (u.a. Methan) auch Wärme, sodass in südamerikanischen Deponien Temperaturen von 80-90°C erreicht werden. Sowohl das Biogas als auch die Wärme können für eine regenerative Energieversorgung genutzt werden. Messdaten zum Setzungsverhalten und Temperaturen von der Doña Juna Deponie in Bogotá ermöglichen die Untersuchung auf Realskala.
Gleichzeitig ist von großem Interesse, die Vorgänge im Deponieuntergrund auch rechnerisch zu erfassen und mittels numerischer Simulation vorhersagen zu können. Diesem Zweck diente insbesondere der Forschungsaufenthalt von Ph.D. Joan Larrahondo an der Fakultät Ingenieurwissenschaften. Im Rahmen mehrerer, von Frau Prof. Anke Bucher geleiteten Forschungsprojekte zur oberflächennahen Geothermie (SAGS, EASyQuart, EASyQuart-Plus) wurden und werden an der Fakultät Vorgänge wie Temperaturveränderungen oder Grundwasserflüsse im Untergrund mit dem Open-Source-Programm OpenGeoSys (OGS) modelliert und berechnet. OGS wird vom Department Umweltinformatik am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH (UFZ) betreut und stetig weiterentwickelt. Joan Larrahondo hat sich während seines Aufenthaltes intensiv mit der Nutzung des Programms sowie dessen Anwendung und Weiterentwicklung in Bezug auf die spezifischen Fragestellungen in Kolumbien beschäftigt. Seitens der Fakultät wurde er dabei besonders vom wissenschaftlichen Mitarbeiter Max Jäschke unterstützt.
DFG-Förderung und geplante Verstetigung
Joan Larrahondos Aufenthalt an der HTWK Leipzig wurde durch eine DFG-Förderung finanziell unterstützt, die den Aufbau einer Forschungskooperation zwischen der HTWK und der Pontificia Universidad Javeriana als Ziel hat. Während seines Aufenthaltes knüpfte Larrahondo vielfältige weitere Kontakte: Dazu gehören Prof. Said Al-Akel, welcher als Professor an der HTWK ein ausgewiesener Fachmann in der Deponieforschung ist, wie auch Prof. Haibing Shao vom UFZ, der über tiefgreifende Kenntnisse in der numerischen Simulation poröser Medien verfügt. Ebenso gab es über Benedict Löwe Kontakt zum Forschungsinstitut für Geotechnik an der HTWK Leipzig, wie auch weitere Kontakte zu Betreibern von Deponien in Deutschland. Im Rahmen seines Aufenthaltes besuchte Joan Larrahondo die Deponie in Cröbern und war auch bei einer Geothermiebohrung für Erdwärmesonden in Schkeuditz vor Ort. Darüber hinaus erfolgte ein Treffen mit Prof. Thomas Nagel von der TU Bergakademie Freiberg, um sich über den Einsatz von OGS in der Lehre für Geotechnik zu informieren.
Nach Larrahondos Rückkehr Anfang Juli 2025 nach Kolumbien gilt es nun, die Möglichkeiten einer weiteren Zusammenarbeit auszuloten und beispielsweise an einem stimmigen Konzept für ein internationales Forschungsprojekt zu arbeiten. Der Aufenthalt von Ph.D. Joan Larrahondo war für Prof.in Anke Bucher und ihre wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine sehr wertvolle Erfahrung, die wesentliche Impulse für die Anwendung und Weiterentwicklung der numerischen Simulation mit OGS geliefert hat. Es besteht die große Hoffnung, dass sich dieses positive Erlebnis in einer zukünftigen, gemeinsamen Forschungskooperation verstetigen wird.
Worum geht es in der neusten Ausgabe?
Im Forschungsmagazin Einblicke 2025 hat Künstliche Intelligenz (KI) zum Schwerpunkt, denn kaum eine technische Errungenschaft hat in jüngster Zeit so viel Aufmerksamkeit erhalten und so tiefgreifend Einzug in verschiedene Lebensbereiche gehalten. Auch in der Forschung spielt KI eine zunehmend tragende Rolle: Sei es als eigener Forschungsgegenstand oder aber als Methode angewandter Forschung, die in diversen Disziplinen neue Ansätze und Möglichkeiten bietet.
Lesen Sie im Magazin beispielsweise, wie die Forschende der HTWK Leipzig KI einsetzen, um menschliche Bewegungsabläufe zu analysieren - sei es im Sport, in der Medizin oder bei Arbeitsabläufen. Auch ein Messsystem für die Wartung von Straßen entwickeln Forschende aus dem Zusammenspiel von Sensoren und KI. A propos Straße: Das Smart-Driving-Team der HTWK Leipzig erprobt an Modellfahrzeugen verschiedene KI-Ansätze zum autonomen Fahren - wir berichten.
Themenvielfalt
Neben der Forschungsstatistik 2024 finden Sie wie immer auch die Gewinnerbilder des Fotowettbewerbs Forschungsperspektiven sowie in den "Schlaglichtern" viele weitere spannende Einblicke in unsere vielfältigen Forschungsthemen. Seien es die Bauingenieure und Architekten um Prof. Dr.-Ing Alexander Stahr, die ein neues Reallabor für den Holzbau der Zukunft errichteten, die Maschinenbauer um Prof. Dr.-Ing. Stephan Schönfelder, die UVC-Strahlen zur Luftreinigung verwenden und die Ausbreitung der Keime in Klassenzimmern simulieren, das Team von Prof. Dr.-Ing. Klaus Holschemacher, das recycelten Carbonbeton entwickelt oder aber Prof. Dr.-Ing. Robert Böhm, der mit seinen Mitarbeitenden Methoden erprobt, um Verbundwerkstoffe aus der Luftfahrt und aus Windkraftanlagen wiederzuverwenden.
Das Forschungsmagazin der HTWK Leipzig wird aus Mitteln des Projekts Saxony⁵ mitfinanziert, das im Rahmen des Bund-Länder-Programms Innovative Hochschule gefördert wird.
Keine Ausgabe mehr verpassen
Gern können Sie kostenfrei die Einblicke postalisch oder digital abonnieren. Die Einblicke erscheint einmal im Jahr.
Viel Lesevergnügen wünscht Ihnen die Einblicke-Redaktion des Referats Forschung der HTWK Leipzig!
Rund 90 Wissenschaftler aus aller Welt haben sich für die Konferenz angemeldet. Sie alle sind Expertinnen und Experten auf dem Gebiet des internationalen Baurechts und Baumanagements. Auf hohem akademischem Level und mit starker Anwendungsorientierung tauschen sie sich beim LADR-Workshop über neueste Entwicklungen aus, um so den Wissenstransfer innerhalb der akademischen Gemeinschaft, aber auch in die Bauindustrie und in Behörden zu erhöhen.
Programm mit Vorträgen und Keynotes

An zwei Konferenztagen finden unter anderem Vorträge zu den Themen Rechtsstreit, Schadensersatz, Streitbeilegung, Risiko-Management, Verträge und Konflikte sowie Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Bausektor statt. „Erstmals neu sind die Themen Building Information Modeling (BIM) und Vertragsmanagement, um noch besser die aktuellen wissenschaftlichen Entwicklungen im Bereich des Bau- und Vertragsrechts abbilden zu können“, so Ulrike Quapp, Dekanatsrätin der Fakultät Bauwesen an der HTWK Leipzig und Senior Editor der LADR-Zeitschrift.
Zur Workshop-Eröffnung und den Keynotes am Dienstag, den 1. Juli 2025, werden hochkarätige Gäste erwartet: Nach einer Begrüßung und Einführung durch Professor Klaus Holschemacher sprechen ab 9:00 Uhr Dirk Panter, sächsischer Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz, Lance VanDemark, Chefredakteur des LADR-Journals, Courtney Mazzone, Konsulin vom US-Generalkonsulat in Leipzig, sowie Professor Faouzi Derbel, Prorektor für Forschung und Nachhaltigkeit an der HTWK Leipzig.
Es folgen zwei Keynotes von ausgewiesenen Experten: Dr.-Ing. Matthias Tietze (C3 – Carbon Concrete Composite Verband) gibt einen Überblick zur Regelungssituation für innovative Bauweisen in Deutschland am Beispiel von Carbonbeton. Sarah Kristina Merz (Deubim) befasst sich in ihrem Vortrag mit Normen und rechtliche Anforderungen in BIM-Projekten. Nach den beiden ganztägigen Konferenztagen mit Vorträgen am 1. und 2. Juli 2025 haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit, die Stadt Leipzig bei einer kulturellen Tour auf den Spuren von Goethes Faust besser kennenzulernen.
Veröffentlichung in LADR-Sonderausgabe
Alle Vortragenden werden ihre neuesten Erkenntnisse auch in Beiträgen in einer Sonderausgabe der LADR-Zeitschrift veröffentlichen. Die Zeitschrift ist im Ranking wissenschaftlicher Datenbanken hervorragend positioniert und als Fachpublikation hoch angesehen. So können sich zudem andere Fachleute im Bereich des Baurechts und Baumanagements im Nachhinein weiterbilden.
Der LADR-Workshop wird unter anderem gesponsert von der Kanzlei Seufert Rechtsanwälte und dem Construction Institute der American Society of Civil Engineers (ASCE). Die Amerikanische Gesellschaft der Bauingenieure ist eine der größten Vereinigungen in der Bauindustrie und setzt sich unter anderem für eine nachhaltige Infrastruktur für die Zukunft ein.
In der Modellfabrik des Carbonbeton-Technikums Leipzig simulieren Forschende reale Fertigungsprozesse und erfassen in umfangreichen Messkampagnen Feinstaub- und Faseremissionen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf innovativen Verfahren wie der Direktgarnablage, es werden aber auch klassische textile Verfahren in die Untersuchungen mit eingebunden. Die toxikologische Bewertung erfolgt an der Universität Rostock mittels moderner Lungenzellmodelle.
„Unser Ziel ist es, durch fundierte chemische, physikalische und toxikologische Analysen ein sicheres Fundament für den nachhaltigen Einsatz recycelter Kohlenstofffasern im Bauwesen zu schaffen. Gesundheitsschutz und Innovation dürfen dabei kein Widerspruch sein – sondern müssen gemeinsam gedacht werden“, erklärt Prof. Dr. Ralf Zimmermann, Leiter der Abteilung Analytische Chemie an der Universität Rostock.
Ziel des Projekts ist es, entlang der gesamten Prozesskette – von der Fertigung über die Weiterverarbeitung bis zur Demontage – kritische Emissionsquellen zu identifizieren und geeignete Schutzmaßnahmen abzuleiten. Damit leistet das Vorhaben einen wichtigen Beitrag für mehr Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit im Bauwesen.
„Carbon-Leichtbeton“
Fast zeitgleich mit dem Projekt „WIR! recyceln Fasern – Gesundheitsschutz“ hat auch das Orientierungsvorhaben „Carbon-Leichtbeton“ am Institut für Betonbau der HTWK Leipzig begonnen. Ziel ist es hier, mögliche Potenziale der Materialkombination Carbonbewehrung / Leichtbeton hinsichtlich Tragfähigkeit, Umweltbilanz und Kosten gegenüber klassischem Carbonbeton für statisch bestimmte Decken- und Plattentragwerke zu eruieren.
Die Ergebnisse erster Tastversuche zum Verbundverhalten zwischen den beiden Baustoffen sollen offenlegen, ob sich signifikante Unterschiede zu den bisher im Carbonbetonbau genutzten Betonen ergeben und ob diese einen sinnvollen Einsatz erschweren oder gar ausschließen.
Das Orientierungsvorhaben zielt dabei auf die Schließung einer Lücke ab, da momentan keine Forschungsergebnisse zum Verbundbaustoff Carbon-Leichtbeton vorliegen und es keine Anwendung im Betonbau gibt.
„Durch die wissenschaftliche Untersuchung des Baustoffs soll es gelingen, das Anwendungsfenster von carbonbewehrten Betonbauteilen weiter zu vergrößern und gerade im Bereich der Fertigteile einen Attraktivitätszugewinn zu generieren. Die bestehenden Wertschöpfungsketten werden dadurch gestärkt und vergrößert“, so Bauprofessor Klaus Holschemacher vom Institut für Betonbau der HTWK Leipzig.
Mit seinem Wirken stärkt Stahr die Bedeutung Leipzigs und Sachsens im nachhaltigen und innovativen Holzbau. Als promovierter Bauingenieur, der seit 2010 Professor an der HTWK Leipzig ist, hat er insbesondere in der angewandten Forschung zu digital basierten Fertigungskonzepten und in der Architekturlehre neue Maßstäbe gesetzt. Kern ist sein anwendungsbezogener Forschungsansatz, der den architektonischen Entwurf, die ingenieurtechnische Planung und die numerisch gestützte Fertigung zusammenbringt. Ziel ist es, mit Systeminnovationen Lücken zwischen einzelnen Fachdisziplinen bzw. Prozessschritten zu schließen – und das Bauen von Grund auf ganzheitlich zu gestalten: „Um in Zukunft klimaschonend zu bauen, bedarf es dringend innovativer Konzepte, welche die Materialverbräuche senken, die Nutzungszeiten der Bauwerke durch höhere Ausführungsqualitäten verlängern und den Einsatz kaum recyclingfähiger mineralischer Baustoffe reduzieren. Darin sehe ich auch meine besondere Verantwortung als Wissenschaftler“, beschreibt Stahr seine Motivation.
Prof. Dr.-Ing. Jean- Alexander Müller, Rektor der HTWK Leipzig, betont: „Die unermüdliche Arbeit von Alexander Stahr erfährt durch den Leipziger Wissenschaftspreis eine angemessene öffentliche Würdigung. Seine Forschung zum klimafreundlichen und zukunftsfähigen Bauen hat großen Anwendungsbezug und strahlt über HTWK und Stadt Leipzig hinaus. Damit hat sie das Potenzial, Leipzig und die Region voranzubringen. Alexander Stahr steht damit zugleich exemplarisch für die Leistungsfähigkeit und Qualität von Lehre und Forschung an unserer Hochschule für angewandte Wissenschaften.“
Forschungsgruppe FLEX: Forschen, Lehren und Experimentieren
Ein zentrales Element in Stahrs bundesweit und international beachtetem Schaffen hier in Leipzig ist die interdisziplinäre Forschungsgruppe FLEX, die er 2014 ins Leben rief. Er und sein Team entwickeln neue Lösungen an der Schnittstelle von digitaler Planung und Fertigung. In Zusammenarbeit mit zahlreichen Praxispartnern hat das Team bereits mehr als 20 Forschungsprojekte umgesetzt.
HolzBauForschungsZentrum
Zu den Meilensteinen gehört die Eröffnung des HolzBauForschungsZentrum Leipzig im Innovationspark Bautechnik Leipzig/Sachsen im Stadtteil Engelsdorf 2024. In der hochmodernen Forschungshalle sollen Grundlagen für Hersteller- und Bauprodukt-unabhängige Fertigungskonzepte für das digital basierte Bauen der Zukunft mit Holz entwickelt werden. Damit wird sowohl lokal als auch regional, national und international eine Lücke geschlossen. Im HolzBauForschungsZentrum entwickeln Stahr und sein Team Lösungen für das Bauen mit vorgefertigten Teilen aus nachwachsenden Rohstoffen im Anwendungsmaßstab.
Regional vernetzt
Die enge Zusammenarbeit mit kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in der Region bildet einen Schwerpunkt für Stahr und FLEX, um Konzepte in der Praxis zu evaluieren und fehlerhafte Annahmen schnell korrigieren zu können. Seit 2018 engagiert er sich im sächsischen Transferverbund Saxony5 der fünf sächsischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Im Anwendungsbereich „Produktion“ setzt er sich dort besonders für den Transfer von Wissen zu digital basierten Fertigungskonzepten in Architektur und Bautechnik ein.
Der Leipziger Wissenschaftspreis
Den Wissenschaftspreis verleihen seit 2001 die Stadt Leipzig, die Universität Leipzig sowie die Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig alle zwei Jahre an Persönlichkeiten aus der Wissenschaft, deren Arbeiten höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen genügen und Leipzigs Ruf als Stadt der Wissenschaften festigen.
Bisherige Preisträgerinnen und Preisträger des Leipziger Wissenschaftspreises waren beispielsweise Prof. Dr. Christian Wirth, Professor für spezielle Botanik und funktionelle Biodiversität (2022), Prof. Dr. Evamarie Hey-Hawkins, Professorin für Anorganische Chemie an der Universität Leipzig (2019), Prof. Dr. Dan Diner, Direktor des Simon-Dubnow-Instituts für jüdische Geschichte und Kultur an der Universität Leipzig (2013) sowie Prof. Dr. Svante Pääbo, Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie (2003), der 2022 den Nobelpreis für Physiologie und Medizin erhielt.
Standort im Leipziger Süden
Im Foyer des Nieper-Baus (Karl-Liebknecht-Straße 134) gibt es Mitmachstationen und Exponate zum Anfassen und Ausprobieren: Einige davon befassen sich mit nachhaltigen Materialien wie Carbonbeton und Holz. So können Besucherinnen und Besucher beispielsweise ausprobieren, wie sie Beton zum Leuchten bringen oder wie digitaler Holzbau von Morgen mit Augmented Reality funktioniert. Den Kreislauf in Schwung bringt das bikelab: Hier können Gäste beim Fahrradfahren nicht nur Belastungen testen, sondern gleichzeitig Strom erzeugen. Oder sie finden beim interaktiven Sandkasten der Geotechnik heraus, ob ihr Sprung der eines Handstampfers oder doch einer schweren Impulsverdichtung gleicht. Viele Roboter sind in der 1. Etage zu finden: Die HTWK Robots präsentieren die neue Generation des Roboterfußballs, und nebenan wartet ein interaktives Tic-Tac-Toe-Spiel gegen einen superschnellen Scara-Roboter.
Geöffnet haben außerdem mehrere sonst für die Öffentlichkeit verborgene Labore: Dort gibt es Einblicke in die moderne Fertigung mit CNC-Fräs-Technik, in Elektrotechnik, in digitale Rekonstruktion, 3D-Druck und 3D-Scan sowie ins REM-Labor mit dem hochauflösenden Rasterelektronenmikroskop, das eine 1.000-fach höhere Auflösung als ein Lichtmikroskop hat. Noch mehr zu entdecken gibt es im Sanitärturm, wo Besuchende den Weg des Abwassers sehen können, oder beim Wasserbau-Labor, bei dem die Gefahren von Sturzfluten veranschaulicht werden. Gegenüber, im Lipsius-Bau mit dem angrenzenden Fechner-Bau, sind erstmals zwei weitere Labore geöffnet: Im Hardware-Labor können Interessierte selbst Bühnentechnik programmieren und „HTWK-Hasen“ löten oder wenige Räume weiter an Hand einer Demonstrations-Rauch-Kammer mehr über lebensrettende Rauchmelder erfahren. Im benachbarten Medienzentrum (Gustav-Freytag-Straße 40 a) und im Gutenbergbau (Gustav-Freytag-Straße 42) werden Geheimnisse der Verpackungstechnik gelüftet, beginnend bei der Frage, wie der Deckel auf den Joghurtbecher kommt. Mehr über Print- und Beschichtungsprozesse können Gäste erfahren, während sie ihren individuellen Tischtennisball bedrucken lassen.
Standort im Zentrum-Süd
Im Wiener-Bau (Wächterstraße 13) gibt es die seltene Möglichkeit, faszinierende Wirkungen von Elektrizität zu bestaunen: Das im mitteldeutschen Raum einzigartige HTWK-Hochspannungslabor zeigt verschiedene Hochspannungsphänomene, darunter leuchtendes ionisiertes Gas und Blitze, die auf Oberflächen gleiten. Des Weiteren gibt es Exponate, mit denen Medizintechnik erfahrbar wird oder verschiedene Roboter, die auch selbst gesteuert werden können. Mehr Robotik zum Anfassen und Ausprobieren gibt es bei den Leobots, dem studentischen Robotik-Team der HTWK Leipzig. Nicht zu vergessen: Das leckere Eis am Stiel vom Makers Lab, das im Labor spannende Designs für köstliche Eiskreationen entwickelt hat und dabei über den Weg von der Idee bis zum fertigen Eisprodukt informiert.
Programm für Kinder und Jugendliche mit Anmeldung
Angehende Nachwuchsforscherinnen und -forscher können sich dieses Jahr auf zwei besondere Highlights freuen: Kinder ab dem Grundschulalter können dieses Mal zu Chemiedetektivinnen und -detektiven werden und beim Experimentieren herausfinden, warum es den Fischen im Aquarium schlecht geht. Für alle Rätselbegeisterten ab 14 Jahren hat die Hochschulbibliothek ein Escape-Game um einen „Wettlauf um die Zeit“ entwickelt. Für beide Veranstaltungen empfiehlt sich eine vorherige Anmeldung über die HTWK-Website, da die Plätze begrenzt sind.
Hintergrund
Die Lange Nacht der Wissenschaften ist eine gemeinsame Veranstaltung der Leipziger Forschungseinrichtungen und der Stadt Leipzig. Dieses Jahr findet sie am 20. Juni von 18 bis 23 Uhr in ganz Leipzig statt. Das gesamte Programm ist unter wissen-in-leipzig.de abrufbar. Das Programm der HTWK Leipzig findet sich unter htwk-leipzig.de/lndw.
Worum geht es?
Wake-up Receiver (WuRx) sind kleine, extrem stromsparende Funkempfänger, die ständig "lauschen" können, ob ein spezielles Wecksignal (Wake-up Packets, WuPts) gesendet wird. Sie werden oft in batteriebetriebenen Sensoren eingesetzt.
Der Clou: Im Gegensatz zu normalen Empfängern, die viel Energie brauchen, ist für WuRx weniger als ein Tausendstel der Energie nötig. So können sie jahrelang im Stand-by warten und nur dann den Hauptempfänger "aufwecken", wenn ein relevantes Signal empfangen wird.
Im Zentrum des Papers steht die Frage, wie breitbandig diese Wecksignale sind, die die WuRx erkennen. Denn es gibt gesetzliche Vorschriften, wie breit Signale in bestimmten Frequenzbändern sein dürfen – vor allem in lizenzfreien Bändern. Zu breite Signale können dabei stören oder die gesetzlichen Grenzwerte überschreiten.
Die Autoren Robert Fromm, Prof. Olfa Kanoun und Prof. Faouzi Derbel haben verschiedene WuPt-Sender untersucht: ein Laborgerät sowie zwei handelsübliche Funkmodule, wie sie in vielen Sensoranwendungen zu finden sind. Dabei haben sie festgestellt, dass viele bisher verwendete WuPts deutlich mehr Bandbreite brauchen als erlaubt. Das liegt vor allem an der sehr einfachen Modulationsart (On-Off-Keying), die mit harten Übergängen arbeitet und dadurch viele Frequenzanteile erzeugt.
„Eine wichtige Erkenntnis des Papers ist, dass man die Bandbreite der WuPts deutlich reduzieren kann, wenn man die Signale mit sogenannten ‚Shaping‘-Filtern formt. Diese Filter machen die Übergänge weicher, sodass weniger ungewollte Frequenzanteile entstehen. Dadurch sinkt die Bandbreite um bis zu 75 Prozent – ein riesiger Fortschritt für die praktische Nutzung“, so Robert Fromm.
„Im Rahmen der IEEE I2MTC-Konferenz wird der Best Paper Award als besondere Auszeichnung für herausragende wissenschaftliche Arbeiten im Bereich der Mess- und Instrumentierungstechnologie verliehen. Der ausgezeichnete Beitrag hebt sich durch exzellente wissenschaftliche Qualität, innovative Methodik und hohe Relevanz für Forschung und Praxis. Die IEEE I2MTC-Konferenz zählt zu den weltweit führenden Konferenzen im Bereich Messtechnik und Sensorik“, betont Prof. Faouzi Derbel.

Die HTWK-Arbeitsgruppe stellte auf der Konferenz an einem eigenen Stand Demonstratoren und Forschungsprojekte vor. Neben Robert Fromm nahmen Sarah Ouerghemmi, Maissa Taktak, Robert Thiel und Florian Strakosch teil. Sie gaben u. a. Einblicke in das Projekt ZAPDOS, bei dem sie eine Messeinrichtung entwickeln, die den Durchhang von Hochspannungsleitungen direkt und präzise bestimmen kann.
Die HTWK Leipzig dankt dem ISAD e.V. Verband für Funkkommunikation für das Sponsoring des Standes.
Hintergrund
Die I2MTC ist die “Flagschiff-Konferenz” der IEEE Instrumentation and Measurement Society (IMS). Geleitet wurde sie von Prof. Dr. Olfa Kanoun (TU Chemnitz), Prof. Faouzi Derbel (HTWK Leipzig) und Prof. Carlo Trigona (Universität Catania, Italien). Die I2MTC fand zum ersten Mal in Deutschland statt.
Mehr als 400 internationale Tagungsgäste tauschen sich über Messtechnik und Instrumentierung aus und feierten zugleich das 75-jährige Jubiläum.
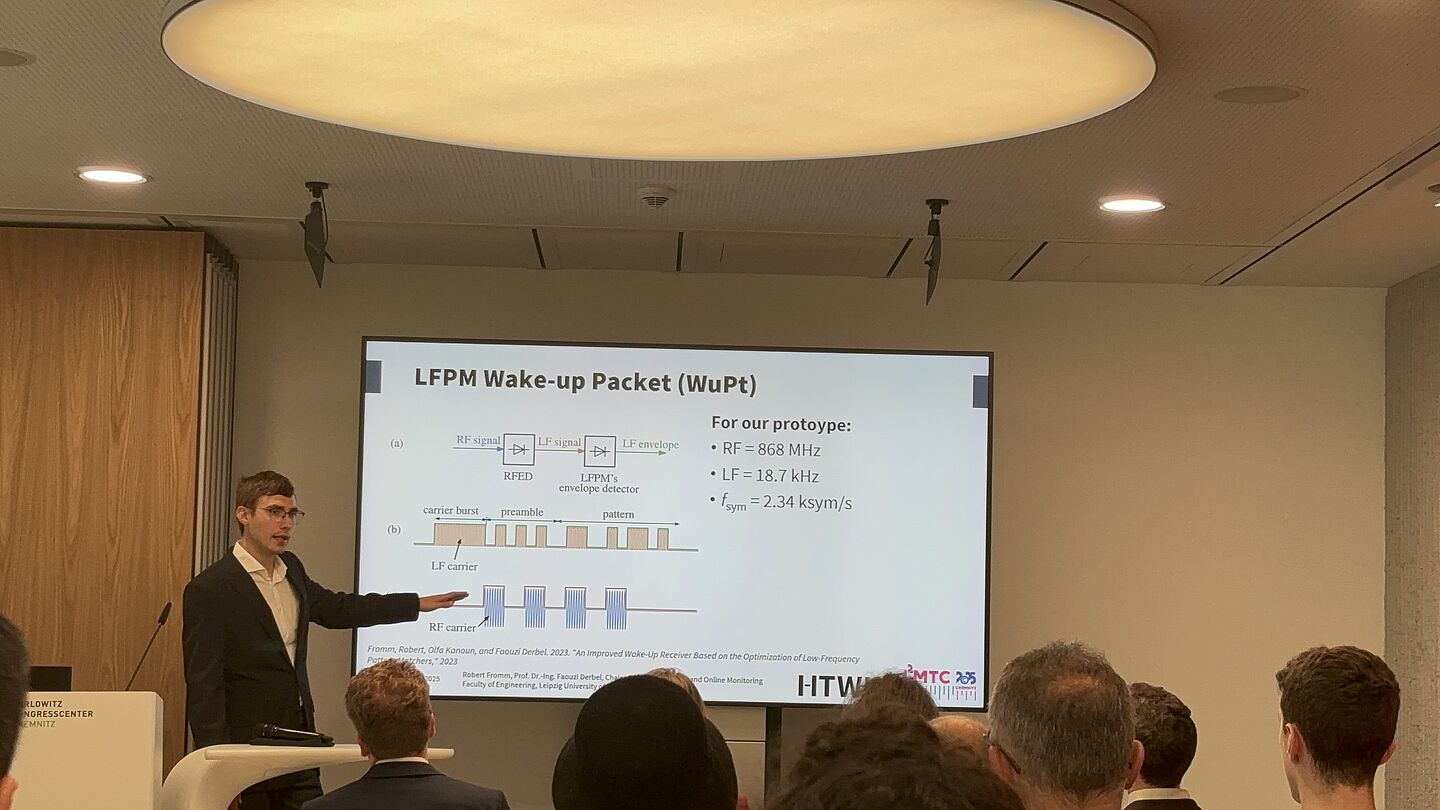
Der prämierte Beitrag entstand unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Stephan Schönfelder und Dr. Florian Wallburg im Rahmen des BMBF-geförderten Forschungsprojekts BeCoLe – UVC-Luftentkeimung in Innenräumen (Förderkennzeichen: 13GW0597D). Die Forschungsarbeiten basieren auf einer engen Kooperation der HTWK Leipzig mit der Dinies Technologies GmbH.
Die ICEEA 2025 fand an der Université Paris Cité statt, einem traditionsreichen Standort wissenschaftlicher Lehre, an dem einst Marie und Pierre Curie wirkten. In diesem historischen akademischen Umfeld präsentierte Dr. Florian Wallburg für das gesamte Forschungsteam der HTWK Leipzig und der Dinies Technologies GmbH die Arbeit „Particle-Resolved CFD Modeling of Indoor Air Disinfection Using Mobile Purification Systems“, die sich mit der präzisen Simulation der Desinfektionsleistung mobiler UVC-Luftreiniger befasst.
Ziel des BeCoLe-Projekts ist es, die Wirkung und Sicherheit von UVC-Strahlung zur Luftentkeimung in Innenräumen systematisch zu erforschen. Die ausgezeichnete Präsentation stellte ein partikelbasiertes CFD-Modell (Computational Fluid Dynamics) vor, mit dem die UVC-Exposition einzelner Aerosolpartikel innerhalb eines Geräts detailliert simuliert wird. Anhand dieser Simulation konnten spezifische Desinfektionsleistungen für verschiedene luftgetragene Krankheitserreger wie Staphylococcus aureus, Mycobacterium tuberculosis, SARS-CoV-2, Influenza A und Adenovirus ermittelt werden. Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere Staphylococcus aureus, Mycobacterium tuberculosis und SARS-CoV-2 sehr effektiv inaktiviert werden – nahezu vollständig. Auch das Grippevirus Influenza A lässt sich deutlich reduzieren. Etwas geringer fällt die Wirkung beim widerstandsfähigeren Adenovirus aus, das weniger empfindlich auf die UVC-Strahlung reagiert. Insgesamt wird deutlich, dass mobile UVC-Luftreiniger ein wirksames Instrument zur Verringerung der Belastung mit Krankheitserregern in Innenräumen darstellen – wobei die Effektivität je nach Erreger unterschiedlich ausfällt.
„Es war ein spannender und fruchtbarer Austausch mit international Forschenden im Bereich Innenraumluftqualität – mit vielen interessanten Einblicken und Impulsen für unsere weitere Arbeit.“, resümierte Dr. Florian Wallburg.
Prof. Dr.-Ing. Stephan Schönfelder, Projektleiter an der HTWK Leipzig, betonte die internationale Anschlussfähigkeit der Forschung: „Ich freue mich, dass wir hier mit unseren aktuellen Forschungstätigkeiten im Verbund BeCoLe auf internationaler Ebene sehr starke Beiträge leisten können.“
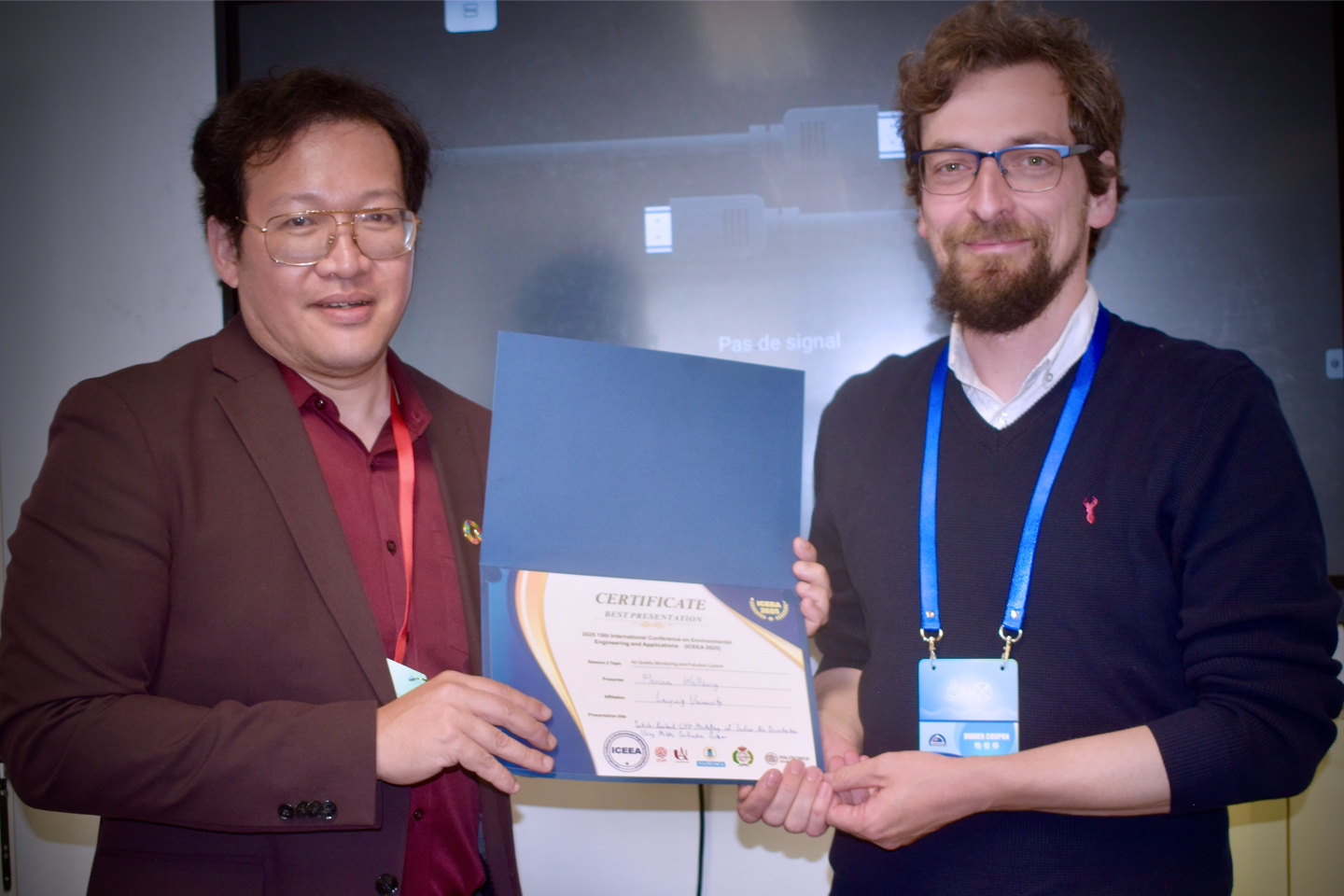
Die Session wurde moderiert von Prof. Dr. Siwatt Pongpiachan, einem international anerkannten Experten für Luftqualität und technologische Entwicklungen in der Umweltüberwachung. Pongpiachan ist Professor an der NIDA (National Institute of Development Administration, Bangkok) und zählt mit über 2.500 wissenschaftlichen Zitationen zu den etablierten Stimmen in seinem Forschungsfeld.
Die Auszeichnung in Paris bekräftigt die Relevanz der Forschungsarbeiten an der HTWK Leipzig zur Innenraumluftqualität – einem Bereich, der nicht nur im Kontext der Pandemie, sondern auch mit Blick auf zukünftige gesundheitliche Herausforderungen zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Die Präsentation kann unter nachfolgendem Link abgerufen werden: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.25633.11366
Die Veröffentlichung befasst sich mit der Nutzung von Carbonbeton, einem belastbaren und korrosionsbeständigen Baustoff, wobei der Fokus auf der Qualitätssicherung und der präzisen Positionierung der Carbonbewehrung in dünnen Bauteilen liegt. Im Rahmen des RUBIN-ISC-Projekts wurden Verfahren entwickelt, um die Lagesicherheit der Bewehrung zu gewährleisten, da kleinere Toleranzen der Bewehrungslage entscheidend für die strukturelle Festigkeit sind. Die Veröffentlichung hebt die Herausforderungen hervor, die mit der geringen Dichte der Carbonbewehrung im Herstellungsprozess verbunden sind, insbesondere im Gießverfahren. Eine erste zerstörungsfreie Prüfmethode, mittels Magnetfeldmessung wurdeentwickelt, um die Bewehrungslage präzise detektieren zu können. Diese Methoden sind später essentiell, um sicherzustellen, dass die Bewehrung korrekt positioniert ist, um so die Vorteile von Carbonbeton voll auszuschöpfen, insbesondere in dünnen Bauteilen, wo die Einhaltung der Toleranzen besonders kritisch ist. In zukünftigen Arbeiten sollen dadurch die Herstellungsprozesse weiter optimiert werden können.
Zum Artikel im Bauingenieur (kostenpflichtig, mit Hochschulbibliotheks-Log-in kostenfrei abrufbar)
Weiterer Fachbeitrag zu ASi-Kabeln in Carbonbeton
In einem weiteren Fachbeitrag für das Magazin „BetonWerk International“ 02/2025 beschrieb Tobias Rudloff wiederum, wie schlanke Elektro- und Kommunikationstechnik in Carbonbeton-Wandkonstruktionen integriert werden kann, um ressourceneffiziente, zukunftsorientierte Gebäudetechnologien zu entwickeln. Im Rahmen des BMWi-geförderten Projekts „WallConnEct“ untersuchte er an der HTWK Leipzig gemeinsam mit Praxispartnern das Potenzial des AS-Interface in der Version 5 (ASi-5), um diese Technologie bereits während der Herstellungsphase von Fertigbauteilen zu implementieren. Dieses System ermöglicht die Übertragung von Daten und Energie über eine einfache Zweidrahtleitung und unterstützt die einfache, automatisierte Kabelverlegung ohne zusätzliche Installationsrohre. Speziell entwickelte Installationsdosen, die leicht eingesetzt und verbunden werden können, reduzieren den Materialbedarf. Diese Methode spart so Ressourcen und reduziert den späteren Arbeitsaufwand auf der Baustelle deutlich. Die Technologie ermöglicht zudem ein gezieltes Energiemonitoring angeschlossener Steckdosen und eine flexible Nutzung vorhandener Komponenten. Insgesamt zeigt die Untersuchung, dass ASi-5 ein großes Potenzial für die Gebäudetechnik hinsichtlich Ressourcenschonung und Effizienzsteigerung bietet.
Im Mittelpunkt der diesjährigen Ausgabe der Veranstaltungsreihe stand der Forschungscampus Weigelstraße im Leipziger Stadtteil Engelsdorf als einen der jüngsten HTWK-Forschungsstandorte. Gelegen im Innovationspark Bautechnik Leipzig/Sachsen feierte im September 2022 das Institut für Betonbau (IfB) hier die Eröffnung des Carbonbetontechnikums. Rund zwei Jahre später eröffnete die Forschungsgruppe FLEX nur wenige Meter entfernt das HolzBauForschungsZentrum. In beiden Reallaboren entstehen Innovationen rund um das Bauen der Zukunft mit Carbonbeton und mit Holz – und das im Realmaßstab.
Begleitendes Fachprogramm sowie Rundgänge und Mitmachstationen
Die Forschungsgruppe FLEX verband mit der Veranstaltung zugleich ihr Jubiläumsfest zum 10-jährigen Bestehen, begleitet von einem Fachprogramm rund um digital basierte Konzepte für das ressourcensparende, kreislauffähige Bauen von morgen an der HTWK Leipzig. Zum Bauen mit Carbonbeton sprach Prof. Dr. Klaus Holschemacher vom Institut für Betonbau. Es folgten Vorträge von Tobias Rudloff vom Institut für Prozessautomation und Eingebettete Systeme über „Digitalbeton“ und von Prof. Dr. Ingo Reinhold vom iP³ Leipzig, dem Institute for Printing, Processing and Packaging Leipzig, über Additive Fertigung. Danach gaben Mitarbeitende der Forschungsgruppe FLEX in weiteren Vorträgen Einblicke zur Robotik im Holzbau, zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz sowie zu den Potenzialen durchgängig digitaler Wertschöpfungsketten.
Die zahlreichen Gäste hatten im Laufe des Nachmittags und Abends zudem Gelegenheit, sich an verschiedenen Stationen sowohl im HolzBauForschungsZentrum als auch im Carbonbetontechnikum über die Innovationskraft der Reallabore zu informieren und praktische Einblicke in die Forschungsarbeit vor Ort zu erhalten. Das Interesse hierfür war bis in die Abendstunden hinein ungebrochen.
Weitere Programmpunkte: Keynote und Dissertationspreis

Die Möglichkeiten für Rundgänge wurden durch weitere spannende Programmpunkte ergänzt: Nach einer Begrüßung durch Prof. Dr. Jean-Alexander Müller, dem Rektor der HTWK Leipzig, erfolgte die Verleihung des Dissertationspreises 2024 der Stiftung HTWK. Diese ehrte in diesem Jahr Dr. Christoph Oefner, der sich in seiner Promotion mit dem klinischen Problem der Implantatlockerung bei Patientinnen und Patienten mit Osteoporose befasste – einem wachsenden Problem in einer zunehmend älter werdenden Gesellschaft.
Im Anschluss folgte ein Gastvortrag von Thomas Strobel, Geschäftsführer der Unternehmensberatung Fenwis. Der „Zukunftslotse“ warf mit seiner Rede zur „Innovationsroadmap 2050“ einen Blick auf den Bausektor der Zukunft und erläuterte an zahlreichen Beispielen, unerlässliche Schritte und Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Zukunftsplanung und notwendige Transformationen in den kommenden 25 Jahren. Passend zum 10-jährigen Jubiläum gab Prof. Dr. Alexander Stahr, Leiter der Forschungsgruppe FLEX, einen Ausblick auf deren künftige Entwicklung. Als einem der nächsten Entwicklungsschritte steht dabei die Gründung des Instituts als ein weiteres In-Institut der HTWK Leipzig an, ums so deren langfristig ausgerichtete Handlungsstrategie zu betonen.
Weitere Impressionen von „Forschung trifft …“ 2025
Vom intelligenten Spiegel über leuchtenden Beton bis hin zu Blitzen in der Luft
Geöffnet sind an diesem Freitagabend mehrere Gebäude am zentralen Campus im Leipziger Süden sowie der Wiener-Bau in der Wächterstraße 13 im Zentrum-Süd. Zu den Exponaten und Mitmachstationen am zentralen Campus zählen beispielsweise ein mit einem Fernseher verbundenes Fahrrad, leuchtender Beton, ein interaktiver Sandkasten, eine Station um einen HTWK-Hasen zu löten oder ein Spiegel, der einiges über sein Gegenüber erzählen kann. Geöffnet sind außerdem mehrere Labore, darunter zum gläsernen Wasserturm, zum Outdoor-Labor zu Agri-Photovoltaik oder zur Drucktechnologie – bei der die Gäste ihren individuellen Tischtennisball gleich im Spiel ausprobieren können. Und wer sich für Roboter interessiert, kann nun auch eine neue Generation des Roboterfußballs kennenlernen.
Im Wiener-Bau gibt es im Hochspannungslabor, das in der Region einzigartig ist, wieder Blitze in der Luft und andere faszinierende Wirkungen von Elektrizität zu bestaunen. Zum Ausprobieren laden verschiedene Versuche zur Medizintechnik ein oder die Leobots, bei denen alle interessierten Roboter bauen können, – und es warten die leckeren Eiskreationen vom Makers Lab auf Testerinnen und Tester.
Spezielle Veranstaltungen für Kinder oder auf Englisch

Viele Angebote an der HTWK Leipzig richten sich sowohl an Kinder als auch an Erwachsene. Bei zwei dieser Angebote wird um vorherige Anmeldung gebeten, um eine Teilnahme garantieren zu können: Die Hochschulbibliothek hat ein Escape-Room-Game entwickelt, das sich an rätselbegeisterte Jugendliche richtet. Diese können in dem einstündigen Erlebnis eine Zeitreise machen. An Kinder ab dem Grundschulalter richtet sich das Angebot der Fachgruppe Chemie am Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Zentrum: „Ein Fall für Chemiededektive – Was passierte im Aquarium?“. Auch hier ist das Platzangebot begrenzt.
Englischsprachige Gäste, die sich für Drucktechnik interessieren, können insbesondere beim Programmpunkt „Duschen und Drucken: Zwei Welten, eine spritzige Verbindung“ auch nach einer Vorführung in Englisch fragen. Bei dem Angebot werden Experimente vorgeführt, die die Phänomene in grundlegende Prozesse beleuchten, die sonst auch in industriellen Inkjet-Anwendungen eine entscheidende Rolle spielen.
Die App zur Wissenschaftsnacht – Entwickelt an der HTWK Leipzig
Neben der HTWK Leipzig beteiligen sich wieder zahlreiche andere Forschungseinrichtungen an der Langen Nacht der Wissenschaften in Leipzig. Das gesamte Programm für die Stadt Leipzig gibt es auf der Seite www.wissen-in-leipzig.de. Erstmals ist das Programm auch in einer App zur Wissenschaftsnacht in Leipzig abrufbar. Diese befindet sich noch in der Betaphase, kann aber bereits für Android-Geräte im Playstore und im Apple-App-Store heruntergeladen werden.
Entwickelt wurde die App von Jörg Bleymehl, Professor für Angewandte Medieninformatik und Mediengestaltung an der Fakultät Informatik und Medien der HTWK Leipzig. „Die Entwicklung der App für die Lange Nacht der Wissenschaften zeigt ein hohes Engagement für den gesamten Wissenschaftsstandort Leipzig von dem alle Hochschulen und Forschungseinrichtungen profitieren werden. Im Namen der Stadt Leipzig und des Leipzig Science Network danke ich Prof. Bleymehl für seine hervorragende Arbeit“, so Dr. Torsten Loschke, Leiter des Referats Wissenspolitik der Stadt Leipzig.
Alle Absolventinnen und Absolventen der HTWK-Studiengänge Informatik, Medieninformatik und Mathematik sind zum Alumni-Treffen ab 17 Uhr eingeladen. Zum Programm und zur Anmeldung.
Dr. Oefner studierte Maschinenbau an der HTWK Leipzig und promovierte anschließend von 2017 bis 2023 an der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig – in Kooperation mit der HTWK Leipzig und unterstützt durch ein HTWK-Promotionsstipendium. Seine Dissertation mit dem Titel „Rechnerische Lebensdaueranalyse eines osteoporotischen lumbalen Pedikelschraube-Wirbel-Verbunds“ wurde mit dem Prädikat „magna cum laude“ bewertet.
Maschinenbau trifft Medizin
„Es war am Anfang relativ schwierig, als Maschinenbauer ein medizinisches Thema zu bearbeiten. Aber durch familiäre Vorprägung lief das relativ gut“, erinnert sich Oefner an den Beginn seiner Promotion.
Osteoporose ist die häufigste Erkrankung des Skelettsystems. In Deutschland sind über sechs Millionen Menschen ab 50 Jahren betroffen. Aufgrund der verminderten Knochendichte steigt das Risiko für Brüche – vor allem an der Wirbelsäule. Die funktionelle Wiederherstellung der Wirbelsäule erfolgt mittels Systemen aus Stäben und Pedikelschrauben. Letztere können sich bei osteoporotischem Knochen jedoch schneller lockern oder sogar versagen.
Wie sich die Verankerung dieser Schrauben trotz schlechter Knochenqualität verbessern lässt, war die zentrale Fragestellung von Oefners Arbeit. Angesichts des demografischen Wandels ist das Thema von wachsender Bedeutung.
Digitale Vorhersage statt Schätzung
Bisher fehlten verlässliche Modelle, um die Lebensdauer von Implantaten im osteoporotischen Knochen vorhersagen zu können. Oefner übertrug daher Methoden der Betriebsfestigkeit – ein zentrales Feld des Maschinenbaus – auf den menschlichen Knochen. Mithilfe vereinfachter Modelle der Lendenwirbelsäule konnte er die Verankerungslebensdauer erstmals in Tagen und Wochen prognostizieren. Zusätzlich analysierte er den Einfluss anatomischer und materialbezogener Faktoren auf die Stabilität der Schrauben.
Die Studien basierten auf experimentellen Untersuchungen am Universitätsklinikum Leipzig sowie komplexen Simulationen, die mit Körperspenderdaten validiert wurden. Dabei zeigte sich etwa, dass schon eine einmalige Überlastung zur Lockerung führen kann. Oefner konnte zudem nachweisen, dass größere Schraubendurchmesser die Verankerung verbessern und die Lebensdauer erhöhen.
Von der Theorie in den OP
„Sein neuartiger Ansatz ist sowohl wissenschaftlich fundiert als auch für den klinischen Alltag hochgradig anwendbar“, fasst Prof. Stephan Schönfelder, Dekan der Fakultät Ingenieurwissenschaften an der HTWK Leipzig und Betreuer der Arbeit, zusammen. Mit dem entwickelten Modell lassen sich Operationen künftig besser planen und individueller gestalten. Ärztinnen und Ärzte können erstmals konkrete Aussagen zur Verankerungslebensdauervon Implantaten treffen – ein Gewinn für die Patientensicherheit.
Gleichzeitig kann die Lebensqualität Betroffener gesteigert werden, da Implantate passgenauer und stabiler verankert werden. „Auf dem Weg dahin müssen jedoch noch weitere valide Materialdaten gesammelt und die Akzeptanz von Simulationsmodellen im klinischen Alltag gestärkt werden“, so Oefner.
Der heute 34-jährige setzt sein Fachwissen inzwischen als Berechnungsingenieur bei Siemens Energy in Leipzig ein. Dort arbeitet er an Rotordynamik und Festigkeitsanalysen von Turboverdichterbaugruppen – ein Arbeitsfeld, in dem wie in der Promotion Belastungen und Simulationen im Fokus stehen.
Reallabor und Citizen Science
Parallel dazu entwickeln die Teilnehmenden ein Reallabor, das im Anschluss für eine breitere gesellschaftliche Beteiligung geöffnet werden soll. Ziel ist es, gemeinsam mit Fachleuten und Interessierten standortgerechte Begrünungskonzepte zu entwickeln, im Reallabor zu diskutieren und praktisch zu erproben.
Das Projekt versteht sich als transformatives Bildungsformat mit Einflüssen aus Bildung der sogenannten „MINT“-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Es fördert forschendes Lernen, interdisziplinäre Zusammenarbeit und die aktive Auseinandersetzung mit ökologischen und gesellschaftlichen Fragen. FaGULab wird federführend von der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig) und in Kooperation mit dem Botanischen Lehrgarten im Schulbiologiezentrum der Stadt Leipzig sowie dem Botanischen Garten der Universität Leipzig umgesetzt. Das Vorhaben ist Teil der Förderinitiative „Transformative Bildung für nachhaltige Entwicklung“ der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) und wird seit März 2025 drei Jahre lang mit rund 250.000 Euro unterstützt. Perspektivisch sollen die entwickelten Begrünungsvorschläge in städtische Planungsprozesse einfließen.
Für Forschung begeistern
FaGULab zeigt, wie Bildung, Beteiligung und Stadtentwicklung zusammenwirken können – praxisnah, multiperspektivisch und mit Blick auf eine nachhaltige Zukunft. Wichtige Unterstützung erhält das Projekt dabei von weiteren assoziierten Partnern: dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) – Department Systemische Umweltbiotechnologie sowie dem Amt für Umweltschutz der Stadt Leipzig. Darüber hinaus begleiten zahlreiche Beteiligte aus dem Leipziger Gründach Think-Tank das Vorhaben – ein Netzwerk aus Verwaltung, Forschung, Bildung und Wirtschaft.
„FaGULab bringt junge Menschen ins Handeln – mit echten Daten, echten Fragestellungen und echten Auswirkungen“, sagt Prof. Dr. Mathias Rudolph, Projektleiter an der HTWK Leipzig (Fakultät Ingenieurwissenschaft). „Sie lernen nicht nur MINT-Grundlagen, sondern erfahren, wie ihre Arbeit zu konkreten Lösungen für unsere Stadt beiträgt.“
Rolf Engelmann, Transferkoordinator des Botanischen Gartens der Universität Leipzig, betont: „Wir schaffen Lernräume mitten in der Stadt – lebendige Schnittstellen zwischen Biodiversität, Bildung und Beteiligung.“
Sebastian Hänsel, wissenschaftlich-pädagogischer Leiter im Schulbiologiezentrum Leipzig, hebt hervor: „FaGULab holt Schülerinnen und Schüler aus ganz unterschiedlichen Lebensrealitäten ab – und schafft Gelegenheiten, selbst aktiv zu werden. Sie erleben, dass ihr Wissen zählt, dass ihre Fragen relevant sind und dass Mitgestalten möglich ist – genau das brauchen wir in der Bildung für nachhaltige Entwicklung.“
„Grüne Inseln in der Stadt wirken kühlend an heißen Tagen und fördern die Artenvielfalt“, sagt Melanie Vogelpohl, DBU-Fachreferentin MINT-Bildung und Nachhaltigkeitsbewertung. „Neben der Unterstützung für Forschung und Verwaltung wirken die Beteiligten bei der Zukunftsgestaltung mit. Das kann Ansporn für eine nachhaltigere Lebens- und Wirtschaftsweise sein.“
Die zu erwartenden Schäden durch Klimawandel oder die Abnahme der Biodiversität sind so immens, dass eine Aufgabe der Nachhaltigkeitsziele geradezu absurd erscheint. Daher ist es wichtig zu wissen, wo Unternehmen heute in ihren Bemühungen stehen und wie die Entwicklung hier aussehen dürfte. Die Studie „Sustainability and Carbon Management in Supply Chains 2025“ wurde gemeinsam von Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky) und der HTWK Leipzig (Prof. Dr. Holger Müller) durchgeführt. Ziel der Studie war es, den aktuellen Stand und die Trends im Bereich des Nachhaltigkeitsmanagements in Unternehmen, insbesondere im Hinblick auf Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen), zu erfassen und zu analysieren. Die Erhebung fand zwischen Oktober und Dezember 2024 statt und umfasste 89 Unternehmen unterschiedlichster Branchen.
Die Studie zeigt, dass über zwei Drittel der befragten Unternehmen direkt von Lieferkettengesetzen betroffen sind, wobei ein hoher Anteil (90,2 %) dem deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz unterliegt. Darüber hinaus müssen 59,6 % der Unternehmen externe Berichterstattungspflichten für THG-Emissionen erfüllen. (B2B-)Kunden verlangen zudem zunehmend konkrete Angaben über den THG-Fußabdruck der Produkte. 69,3 % der befragten Unternehmen berichten von entsprechenden Anforderungen ihrer Kunden.
In Bezug auf die Reduktion von THG-Emissionen haben 74,2 % der befragten Unternehmen konkrete Ziele formuliert, bei 41,6 % sind diese verbindlich. Eine der größten Herausforderungen bei der Erfassung und Berichterstattung über THG-Emissionen stellt die Datenverfügbarkeit dar. Über drei Viertel der Unternehmen sehen hierin eine der größten Hürden. Der Personalaufwand wird ebenfalls häufig als signifikante Herausforderung genannt. Weitere Probleme umfassen die Korrektheit der Daten von Geschäftspartnern sowie unzureichend definierte Standards.
55,7 % der befragten Unternehmen erheben THG-Werte für zugekaufte Güter und Dienstleistungen. Davon haben 60,4 % bereits das gesamte Volumen erfasst. Die Erhebung erfolgt am häufigsten über die ausgabenbasierte Methode. 81,3 % der Unternehmen nutzen diese Methode zur Berechnung ihrer THG-Emissionen.
Im Bereich des Lieferantenmanagements streben 85,7 % der Unternehmen eine allgemeine Sensibilisierung für das Thema THG-Emissionen bei Lieferanten an, während konkrete Konsequenzen in Preisverhandlungen bisher nur von einem Viertel der Unternehmen thematisiert werden.
Insgesamt zeigen die Ergebnisse der Studie, dass ein hohes Bewusstsein für die Relevanz von Nachhaltigkeit besteht. So sind 72 % der Befragten der Ansicht, dass Unternehmen, die nicht nachhaltig handeln, durch eine strengere Nachhaltigkeitsgesetzgebung mittel- bis langfristig vergleichsweise höhere Kosten tragen müssen. Darüber hinaus glauben 67,4 %, dass sich Nachhaltigkeitsaktivitäten des Unternehmens deutlich positiv auf die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitenden auswirken. Zudem sind 64,7 % der Meinung, dass EU-Unternehmen beim Thema unternehmerische Nachhaltigkeit eine Vorreiterrolle einnehmen müssen.
Die Studie „Sustainability and Carbon Management in Supply Chains 2025“ liefert Einblicke in den aktuellen Stand des Nachhaltigkeitsmanagements in Unternehmen. Die Ergebnisse verdeutlichen die Notwendigkeit eines strategischen Ansatzes zur Erfassung und Reduktion von THG-Emissionen sowie die Bedeutung von Transparenz und Zusammenarbeit in der Lieferkette. Angesichts der drängenden Herausforderungen des Klimawandels bleibt es entscheidend, dass Unternehmen aktiv an ihren Nachhaltigkeitszielen arbeiten.
]]>Das neu gestartete Verbundprojekt der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig) und der gemeinnützig organisierten Kontaktstelle Wohnen, baut mit SieWo eine Vermittlungsstelle für Wohnraum nach häuslicher Gewalt auf. So werden Frauen, die nach einem Aufenthalt im Frauenschutzhaus eine neue Perspektive suchen, mit Vermietenden zusammengebracht: koordiniert, begleitet und sicher. Der Übergang aus der Schutzeinrichtung in eine eigene Wohnung wird erleichtert, die Verweildauer in Frauenhäusern verkürzt und auf diese Weise Gewaltkreisläufe durchbrochen. Über die neue Website können sich Interessierte ab sofort informieren und Kontakt aufnehmen.
So funktioniert SieWo

Die Mitarbeitenden im Projekt SieWo akquirieren Wohnungen und vermitteln diese an Frauenhausbewohnerinnen – mit enger fachlicher Begleitung. Vermietende profitieren dabei von SieWo als festem Ansprechpartner – sowohl vor als auch während des Mietverhältnisses –, verlässlichen Mietzahlungen (beispielsweise über die Agentur für Arbeit), der Begleitung zu Terminen wie Besichtigung, Vertragszeichnung oder Schlüsselübergabe sowie sozialer Wirkung ohne Mehraufwand.
Das Projekt wird durch ein Forschungsteam der HTWK Leipzig unter Leitung von Prof. Dr. Rüdiger Wink wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Ziel ist es, mithilfe eines digitalen Vermittlungsportals langfristige Strukturen zu schaffen, um Gewaltbetroffene schneller in eigene Wohnungen zu bringen – zunächst in Leipzig und perspektivisch darüber hinaus. „Jede vermittelte Wohnung schafft einen freien Platz im Frauenhaus“, so Wink.
Wohnungen gesucht – für eine gewaltfreie Perspektive
Im Rahmen des Projekts suchen die SieWo-Mitarbeiterinnen Angebote aller Wohnungsgrößen im gesamten Leipziger Stadtgebiet. Besonders hoch ist der Bedarf an 1- und 4-Raum-Wohnungen. „Wir laden alle Vermietenden – private wie gewerbliche – ein, sich bei uns zu melden. Gemeinsam können wir konkret helfen“, so Frieler. Auch Menschen auf der Suche nach Nachmieterinnen für ihre Wohnung können sich an das Projekt wenden.
Die zukünftigen Mieterinnen verfügen über einen Wohnberechtigungsschein (WBS) und eine gesicherte Finanzierung der Wohnkosten. Eine Teilnahme am Projekt ist derzeit nur für Bewohnerinnen eines Leipziger Frauenschutzhauses möglich. Akut von häuslicher Gewalt Betroffene auf der Suche nach einem Schutzplatz wenden sich bitte an die Zentrale Sofortaufnahme.
Hintergrund zum Projekt
Das Projekt wird vom Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt als Modellvorhaben sozialer Innovationen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) mit einer Projektlaufzeit von Januar 2025 bis Juni 2026 gefördert. Die HTWK Leipzig bringt ihre Forschungsexpertisen und die Kontaktstelle Wohnen langjährige Erfahrung in der Wohnraumvermittlung ein.
Seit mehr als zehn Jahren entwickelt Stahr mit der interdisziplinären Forschungsgruppe FLEX (Forschung.Lehre.Experiment) Strategien für individualisiert-automatisierte Fertigungskonzepte im Holzbau. Den Anfang bildeten Forschungen zum Zollingerdach, einer besonders materialeffizienten Dachbauweise mit gekrümmten Hölzern, der FLEX dank Digitalisierung und Weiterentwicklung eine neue Perspektive geben konnte. Daraus entwickelten sich zahlreiche weitere Projekte zum innovativen Holzbau. Der jüngste Meilenstein war schließlich die Eröffnung des HolzBauForschungsZentrums an der HTWK Leipzig im August 2024 in Leipzig-Engelsdorf. In dieser in Bezug auf ihre technologische Ausstattung alsbald einzigartigen Forschungs- und Fertigungshalle können Stahr und sein Team aus Architektur und Ingenieurwesen neue Konzepte für materialsparende Lösungen im Realmaßstab und auf Anwendungsniveau entwickeln und erproben. Damit will die Forschungsgruppe FLEX ihrem Anspruch gerecht werden, anwendungsnahe Spitzenforschung zu betreiben.
Begleitendes Fachprogramm und Forschung zum Anfassen
Um den rund 250 Gästen aus, Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft einen Einblick in diesen angewandten Forschungsbereich zu geben, folgte ein breit gefächertes Vortragsprogramm rund um digital basierte Konzepte für das ressourcensparende, kreislauffähige Bauen von morgen an der HTWK Leipzig. Zunächst sprachen Prof. Dr. Klaus Holschemacher vom Institut für Betonbau über Carbonbeton, Tobias Rudloff vom Institut für Prozessautomation und Eingebettete Systeme über „Digitalbeton“ und Prof. Dr. Ingo Reinhold vom iP³ Leipzig, dem Institute for Printing, Processing and Packaging Leipzig, über Additive Fertigung. Es folgten Vorträge der Forschungsgruppe FLEX zur Robotik im Holzbau, der Nutzung von Künstlicher Intelligenz sowie zu den Potenzialen durchgängig digitaler Wertschöpfungsketten.
Praktisch sichtbar wurde die Forschung bei Rundgängen durch das HolzBauForschungsZentrum sowie an Stationen innerhalb der Halle. Zu sehen gab es einen Industrieroboter, der mit einem Stift bestückt Portraits von Besuchenden zeichnete sowie einen kollaborativen Roboter („Cobot“) und einen „LEGO-Roboter“ im Einsatz. Darüber hinaus konnten die Gäste durch eine Mixed-Reality-Brille die „Bauanleitung“ für eine Holzständerwand sehen und ein elementiertes 3D-gedrucktes Modell des weiterentwickelten Zollingerdaches selbst zusammenbauen. Sie konnten bestaunen, wie „Double-Layer-Holzfurniere“ sich unter dem Einfluss wechselnder Luftfeuchte verformen, um in Zukunft als „natürlich gesteuerte“, einzeln austauschbare Verschattungslamellen Räume zu verschatten und Klimatisierungskosten zu reduzieren.
Zukunftslotse Thomas Strobel über den Bausektor der Zukunft
Ein weiteres Highlight war die Keynote von Thomas Strobel, Geschäftsführer der Unternehmensberatung Fenwis. In seiner Funktion als „Zukunftslotse“ warf er mit seiner Rede „Innovationsroadmap 2050“ einen Blick auf den Bausektor der Zukunft. Dabei spannte er den Bogen zwischen wichtigen Rahmenbedingungen eines Zukunftsbildes 2050, erfolgreichen Vorgehensweisen für Zukunftsplanung und den Transformationen, die dafür in den kommenden 25 Jahren erforderlich sein werden. Aus einer chancenorientierten Perspektive betrachtete er erfolgreiche Praxisbeispiele für Kreislaufwirtschaft sowie neue Anforderungen und Erfolgsfaktoren im Bausektor. Seine Keynote reicherte er mit Impulsen zu pragmatischen Zukunftsideen und interdisziplinärem, branchenübergreifendem Austausch an, damit auch Ausbildungskonzepte und Förderprogramme auf zukünftige Bedarfe ausgerichtet werden können.
Ausblick: FLEX erfindet sich neu
Zum Abschluss gab Stahr einen Ausblick auf die Pläne und Entwicklung der Forschungsgruppe FLEX. „Wir freuen uns, dass wir dabei sind, ein eigenes Institut zu gründen. Dies wird der nächste Schritt sein, um unseren Partnern zu signalisieren: Wir haben noch viel vor! Innovation und Verlässlichkeit sind die Säulen unserer langfristig ausgerichteten Handlungsstrategie.“
Hintergrund zu „Forschung trifft …“ und zum Dissertationspreis 2024
Die Jubiläumsfeier fand im Rahmen der Netzwerkveranstaltung „Forschung trifft …“ statt, bei der die HTWK Leipzig einmal im Jahr Mitarbeitende und Forschende sowie Gäste einlädt, Hochschulstandorte und die dort ansässigen Labore und Forschungsprojekte kennenzulernen. Am Forschungscampus Weigelstraße in Leipzig-Engelsdorf im Innovationspark Bautechnik Leipzig/Sachsen befinden sich zwei der größten und neuesten Forschungs- und Fertigungshallen: Das HolzBauForschungsZentrum und das Carbonbetontechnikum. Zwei Orte, an denen Innovationen zum Bauen der Zukunft mit Holz und mit Carbonbeton entstehen – und das im Realmaßstab.
Bei der Veranstaltung verlieh die Stiftung HTWK heute zugleich den Dissertationspreis 2024, mit dem sie jährlich herausragende Promotionen mit hohem Praxisbezug würdigt. Dieses Jahr ehrte die Stiftung Dr. Christoph Oefner: Der Maschinenbauingenieur befasste sich mit dem klinischen Problem der Implantatlockerung bei Patientinnen und Patienten mit Osteoporose. Er entwickelte ein digitales Vorhersagemodell zur quantitativen Lebensdauerabschätzung von Verankerungen mit Pedikelschrauben und nahm den Preis während der feierlichen Verleihung entgegen.
Zum ersten Graduierungskolloquium waren der frisch promovierte Dr.-Ing. Robert Wünsche, Familienangehörige, Studierende der Vertiefungsrichtung ESS, interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Professoren der Fakultät Ingenieurwissenschaften geladen


Dr.-Ing. Robert Wünsche stellte zu Beginn Auszüge aus seiner Promotion „Phasengesteuerte Antennen in der LEO-Satellitenkommunikation“ vor. Die Arbeit wurde von Prof. Krondorf betreut und beschäftigt sich mit der Analyse von phasengesteuerten Antennen für die LEO-Satellitenkommunikation. LEO steht dabei für „Low Earth Orbit“ und bezeichnet neuartige Satellitensysteme im erdnahen Orbit bei ca. 500 bis 1000 km Flughöhe. Das wohl derzeit bekannteste LEO-Satellitensystem ist Starlink von Elon Musk.
Dr. Wünsches Beiträge zeigen den Gewinn an Datenrate, wenn man diese neuartigen Antennen direkt im Satelliten verbaut. Außerdem liefert die Arbeit wichtige Beiträge zur Echtzeitsignalverarbeitung direkt im Satelliten.
Prof. Krondorf selbst hat 2024 ebenfalls auf dem Gebiet der LEO-Satellitensysteme habilitiert und Auszüge aus seiner Habilitationsschrift „Resultate zur stochastischen Modellierung von LEO-Satellitensystemen“ präsentiert.
Mit einem Get-together endete die Veranstaltung.
„Die Präsentation von neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ist ein absolute Highlight im akademischen Leben. Ich hoffe, dass durch diese Sichtbarkeit mehr Absolventen den Weg nach ihrem Abschluss in die Wissenschaft finden und wir so gleichzeitig die Bestrebungen der Hochschule zur Erlangung des Promotionsrechts unterstützen.“, betont Prof. Krondorf.
Mit der neuen Veranstaltungsreihe möchte Prof. Krondorf alle Promotionsvorhaben würdigen.
Am 22. April empfing die Fakultät Digitale Transformation Takafumi Nakada, Leiter des Bereichs Internationale Beziehungen am Electronic Navigation Research Institute (ENRI) in Tokio. Ziel des Besuchs war es, bereits bestehende Kontakte zu vertiefen und über weitere Kooperationsmöglichkeiten zu sprechen. Zudem nutzte Takafumi Nakada den Besuch, die HTWK Leipzig besser kennen zu lernen. Dekan Professor Oliver Crönertz übergab dem Gast einen vom Rektor der Hochschule unterzeichneten Kooperationsvertrag zur akademischen Zusammenarbeit im Bereich der elektronischen Navigation und des Airtraffic Managements.
Professor Oliver Crönertz unterstrich das große Interesse der Fakultät am Ausbau von Forschungskooperationen, die das internationale Profil der HTWK Leipzig stärken und sowohl Studierenden als auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern interessante Möglichkeiten eines Auslandsaufenthaltes eröffnen. „Interessierte haben die Möglichkeit, am ENRI ein Forschungsaufenthalt zu absolvieren und können durch die Zusammenarbeit mit ENRI ihre Kompetenzen im Bereich der Hochfrequenztechnik, Kommunikation und Navigation deutlich erweitern und gemeinsam neue Forschungsergebnisse erzielen“, so Professor Robert Geise, der den Kontakt zum ENRI initiiert hat und fachlich betreut.
Das Electronic Navigation Research Institute und die HTWK Leipzig arbeiten derzeit bereits in einem vom Deutschen Akademischen Austauschdienst geförderten Projekt für neuartige, multistatische Radararchitekturen auf Basis von Software-Defined-Radios zusammen.
Am Besuchsprogramm nahmen seitens der HTWK Leipzig außerdem Prof. Dr.-Ing. Michael Einhaus, Studiendekan für den Masterstudiengang Information- und Kommunikationstechnik der Fakultät Digitale Transformation, und Silke Mühl vom Akademischen Auslandsamt teil. Bei einer kurzen Tour durch die Labore der Fakultät bekam Nakada einen guten Einblick in verschiedene Tätigkeits- und Forschungsbereiche, beispielsweise das Labor für Elektromagnetische Verträglichkeit, das Grundlagenlabor für Elektrotechnik sowie das Forschungsfeld des HTWK Robots Teams. Beide Seiten sehen der Weiterentwicklung der jungen Kooperation entgegen und freuen sich auf zukünftige weitere Forschungsprojekte und akademische Austauschformate.
Weitere Impressionen

Research cooperation with Japan consolidated
HTWK Leipzig and the ENRI research institute commit to work closer together in the future – cooperation agreement signed
On April 22, the Faculty of Digital Transformation welcomed Takafumi Nakada, Senior Director for International Affairs at the Electronic Navigation Research Institute (ENRI) in Tokyo at HTWK Leipzig. The aim of the visit was to deepen existing contacts and to discuss further cooperation opportunities. Mr. Nakada also used his visit to get to know HTWK Leipzig better. Dean Professor Oliver Crönertz handed over a cooperation agreement signed by the university’s Rector for academic collaboration in the field of electronic navigation and air traffic management.
Professor Oliver Crönertz emphasized the Faculty's strong interest in expanding research collaborations that strengthen the international profile of HTWK Leipzig and open up interesting opportunities for a stay abroad of both students and scientists. “Those interested have the opportunity to complete a research stay at ENRI. By working with ENRI, they can significantly expand their skills in the areas of high-frequency technology, communication and navigation, and achieve new research results together,” says Professor Robert Geise who initiated the contact with ENRI and provides technical support.
The Electronic Navigation Research Institute and HTWK Leipzig are currently working together in a project funded by the German Academic Exchange Service on novel, multi-static radar architectures based on software-defined radios.
Other members from HTWK Leipzig also took part in the programme of the visit: Prof. Dr.-Ing. Michael Einhaus, Dean of Studies for the Master's program in Information and Communication Technology at the Faculty of Digital Transformation, and Silke Mühl representing the International Office. During a short tour through the Faculty's laboratories, Mr. Nakada received a good insight into various areas of activity and research, e.g. the laboratory for electromagnetic compatibility, the basic laboratory for electrical engineering and the research field of the HTWK Robots Team. Both sides look forward to further developing the young cooperation and await further research projects and academic exchange formats in the future.
Further impressions
In seinem Eröffnungsvortrag stellte Prof. Thiele die bisherige geotechnischen Forschung an der HTWK Leipzig vor. Anschließend erläuterte er, basierend auf der Motivation und Verantwortung der Gruppe, den zukünftigen Forschungsschwerpunkt „Geotechnik und Klimawandel“ des Instituts. „Wir werden uns zukünftig im Institut verstärkt den sogenannten Ökosystem-Dienstleistungen des Bodens widmen, wie zum Beispiel seiner Fähigkeit, Wasser zu puffern, zu speichern, zu filtern und zu reinigen. Damit erlangen wir ein besseres Verständnis der klimainduzierten Belastung im urbanen Raum“, so Thiele.
Bei der Gründungsfeier hatten die rund 75 Gäste aus Praxis und Hochschule zudem die Gelegenheit, das neue GeoTechnikum am Forschungscampus in der Eilenburger Straße 13 kennenzulernen. Dieses besteht aus dem bodenmechanischen Forschungslabor, Modellständen, zwei geotechnischen Versuchshallen mit Bodenprüfgruben für Versuche im Realmaßstab sowie Werkstätten. Zum Abschluss blieb Zeit für einen persönlich und fachlichen Austausch.
Im Bereich Geotechnik finden an der Hochschule oder mit Beteiligung von HTWK-Forschenden jährlich folgende Veranstaltungen statt:
- Geotechnikseminar: Pro Semester werden fünf Fachvorträge aus der Bauwirtschaft gehalten. Eine Teilnahme ist in Präsenz und online möglich.
- Erdbaufachtagung: Hier tauschen sich Expertinnen und Experten aus Bauplanung, Ausführung und Forschung aus. Die nächste, nunmehr 20. Tagung findet am 13. und 14. Februar 2025 in Leipzig statt und widmet sich dem Fachthema „Erdbau im Wandel“.
- Deponiefachtagung: Die Leipziger Deponiefachtagung dient als Podium zur Diskussion technischer und rechtlicher Fragestellungen des Deponiebaus, der Kreislauf- und Abfallwirtschaft sowie des Umweltschutzes. Der nächste Termin ist am 11. und 12. März 2025 in Leipzig.
- 1. Leipziger Geotechnik-Symposium (LeiGS): Die neue Plattform lädt zum interdisziplinären Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis zu jährlich wechselnden fachübergreifenden geotechnischen Schwerpunktthemen ein. Das 1. LeiGS findet am 13. und 14. November 2025 statt und widmet sich dem Themenfeld „Geotechnik und Klimawandel“.
Vortrag von IfB-Mitarbeiter Dr. Steffen Rittner
Unter den Referierenden war auch Dr. Steffen Rittner, Mitarbeiter am Institut für Betonbau der HTWK Leipzig. Er hielt in Session 1 zur „Zukunft des Leichtbaus: nachhaltige Materialien und innovative Fertigungstechnologien“ einen Vortrag zur „Ressourcenschonung durch angepasste Produktionsverfahren und den Einsatz von Recyclingmaterialien“.
Demnach bietet der Einsatz von Carbonbeton und die Verwertung faserhaltiger Abfälle großes Potenzial für Ressourcenschonung und Klimaschutz im Bauwesen. Derzeit entstehen jedoch bei der Herstellung der dafür notwendigen Bewehrungsmaterialien noch zu hohe Verschnittabfälle. Des Weiteren sind Materialströme beim Recyclingprozess fehlgeleitet, wodurch ein wertvolles Ressourcenpotential bislang ungenutzt bleibt. Um dies zu vermeiden, wird das patentierte Verfahren zur Direktgarnablage weiterentwickelt, sodass zukünftig individuell einstellbare und verschnittfreie Bewehrungsstrukturen realisierbar sind.
Parallel dazu wird in weiteren Forschungsarbeiten die Aufbereitung von faser- und mineralhaltigen Abfällen zu hochwertigen Sekundärbaustoffen für den Einsatz in Carbonbeton vorangetrieben. Schwerpunkte liegen hierbei auf der Verwendung recycelter Carbonfasern und feiner Gesteinskörnungen. Die Entwicklungen umfassen einerseits anwendungsorientierte Anpassungen des robotergestützten Verfahrens zur Direktgarnablage andererseits nachhaltige Betonmischungen mit einem sehr hohen Rezyklatanteil, um mechanische und ökologische Anforderungen zu erfüllen. Die Ergebnisse zeigen eine signifikante Verbesserung der Prozesskette sowie der Betoneigenschaften. Der im Rahmen der Forschungsarbeiten am IfB, gemeinsam mit dem Projektpartner BCS Natur- und Spezialbaustoffe, neu entwickelte Beton wurde mit einem Sonderpreis zur Verleihung für den Preis der Ostdeutschen Bauindustrie im Mai 2024 gewürdigt.

Die Arbeiten leisten so einen Beitrag zur Schaffung nachhaltiger, ressourcenschonender Baumaterialien und tragen zur Transformation des Bauwesens in eine zirkuläre Wirtschaftsweise bei.
M.Eng. Jan Schubert, Teamleiter Wärme, Asset Management der Netz Leipzig GmbH, überreichte den mit 1.000 Euro dotierten Leipziger Energiepreis an Prof. Dr.-Ing. Robert Huhn in Vertretung für Benedict Scharf, der den Preis während der Feier nicht persönlich entgegennehmen konnte.
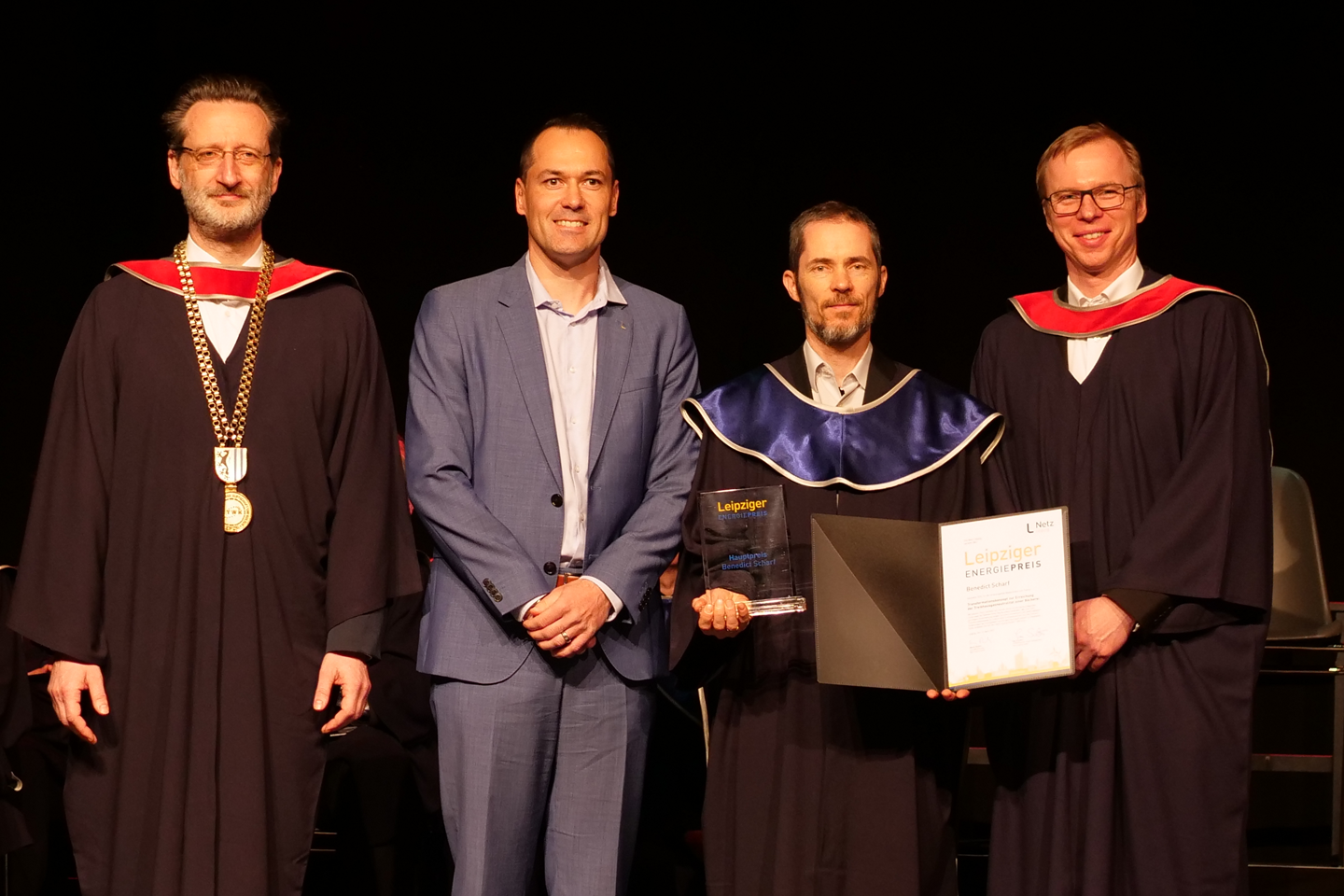
Die prämierte Masterarbeit
Preisträger Benedict Scharf, Absolvent des Masterstudiengangs Energie-, Gebäude und Umwelttechnik (EGM) der Fakultät Ingenieurwissenschaften, hat für seine Abschlussarbeit „Transformationskonzept zur Erreichung der Treibhausgasneutralität einer Bäckerei" den Leipziger Energiepreis 2024 erhalten. Betreut wurde die Arbeit von Prof. Robert Huhn, Professur Gas und Wärmenetze.
Benedict Scharf erarbeitet in seiner Masterarbeit einen Pfad zur Treibhausgasneutralität für eine Bäckerei aus der Region Leipzig. Die Bäckerei hat sich zum Ziel gesetzt, zukünftig ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren und soweit möglich regenerative Energieträger zu nutzen. Ausgehend vom Ist-Zustand der energetischen Versorgung des Produktionsstandortes sowie des Fuhrparks der Bäckerei werden Maßnahmen zur Vermeidung und Reduktion von Treibhausgasemissionen abgeleitet.
Preisverleiher Jan Schubert betont: „Benedict Scharf hat in Bezug auf den Transformationsweg für industrielle Energie-Großverbraucher ein hervorragendes Beispiel gewählt und bearbeitet, das den technischen und wirtschaftlichen Weg aufzeigt, um vollständige Klimaneutralität zu erreichen. Das Beispiel ließe sich gut auf andere Industriebetriebe übertragen, auch wenn die Rahmenbedingungen andere sein können. Insbesondere die Verfolgung innovativer Ansätze und die stetige Einbeziehung der ökonomischen Prämissen hat die Jury der Netz Leipzig GmbH – bestehend aus der Geschäftsführung und der Abteilung Assetmanagement – überzeugt."
Leipziger Energiepreis | Netz Leipzig GmbH
Die Netz Leipzig GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Leipziger Stadtwerke mit Sitz in Leipzig. Als Netzbetreiber bündelt sie damit alle Kompetenzen und Dienstleistungen rund um den Transport und die Verteilung von Strom, Gas und Fernwärme in Leipzig. Sie betreibt die Strom-, Gas- und Fernwärmenetze in Leipzig sowie ein Telekommunikationsnetz. Der Aufgabenbereich umfasst Netzausbauplanung, Instandhaltung, Inspektion, Bauleitung, Netzinformation an externe Partner, Netzmanagement und Zusammenarbeit mit der Regulierungsbehörde (BNetzA). Netz Leipzig ist Arbeitgeber für mehr als 400 Menschen.
Als Tochtergesellschaft der Leipziger Stadtwerke liefert die Netz Leipzig GmbH die Energie für Leipzig. Menschen und Unternehmen in der Region werden zuverlässig und effizient mit Energie versorgt. Sie unterstützt die Stadt Leipzig bei der Verwirklichung der Klimaziele – mit cleveren Konzepten und innovativen Technologien, die den Weg für eine nachhaltig lebenswerte und wirtschaftsstarke Region ebnen. Mehr als 400 Millionen Euro werden in den nächsten Jahren in neue, umweltfreundliche Erzeugungsanlagen und den Netzausbau im Raum investiert – eine Herausforderung die sie als Netzbetreiber mit zum Erfolg führen wollen.
Mit dem Leipziger Energiepreis zeichnet die Netz Leipzig GmbH seit 2017 Studierende der Fakultät Ingenieurwissenschaften der HTWK Leipzig für hervorragende technisch-wissenschaftliche Abschlussarbeiten aus. Diese stehen dabei im Zeichen der Energiewelt von Morgen und greifen aktuelle Entwicklungen von Technologien oder Energienetzstrukturen auf. Dabei ist u.a. der Kontext der Implementierungsfähigkeit sowie die Einordnung ökonomischer Grundsätze und ökologischer Folgewirkungen ein Kriterium zur Auszeichnung. Die Entscheidung darüber wird im Bereich Asset Management in Abstimmung mit der Geschäftsführung der Netz Leipzig getroffen.
Aus Leipzig angereist waren Alla Lysenko von der Kontaktstelle Wohnen, die Kampagnenmanagerin Anna Wolf und die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen Dr. Friederike Frieler und Selma Matzberger der HTWK Leipzig. Am Vormittag waren die Verbundpartnerinnen mit Selina Höfer und Lena des asap e. V. verabredet. Der Verein unterstützt, mit dem Erfahrungsschatz aus vielen Jahren Vermittlungsarbeit, von Gewalt betroffene Frauen* in Berlin dabei, bezahlbaren und an individuellen Bedürfnissen orientierten Wohnraum zu finden. Diskutiert wurden Fragen rund um die praktische und inhaltliche Arbeit, die lokale Vernetzung mit Wohnungsgebenden und Fachstellen im Anti-Gewalt-Bereich sowie der Arbeit mit Klient*innen des Vereins. Asap e. V. vermittelt ca. 350 Wohnungen jährlich erfolgreich an von Gewalt betroffene Frauen* (und ihre Kinder) in Berlin.
Nach dem Mittagessen stand dann der Besuch bei Sebastian Böwe von Housing First Berlin auf der Agenda. Gesprächsthemen waren erfolgreiche Vernetzungsstrategien, die Prinzipien von Housing First und zahlreiche Tipps für eine gelingende Vermittlungsarbeit. Housing First ist ein Projekt zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit in Berlin, es unterstützt Betroffene auf dem Weg zu einem eigenen und unbefristeten Mietvertrag und steht anschließend für Mieter*innen und Wohnungsgeber*innen beratend zur Seite. Mit neuen wertvollen Informationen und Impulsen für die Umsetzung einer Kampagne zur Wohnraumakquise auf dem angespannten Leipziger Wohnungsmarkt kehrte das Projektteam nach Leipzig zurück.
Mit SIWO soll eine Wohnungsvermittlungsstelle in Leipzig geschaffen werden, die von Gewalt betroffene Menschen auf dem Weg in ein eigenständiges und gewaltfreies Leben dabei unterstützt, Wohnraum zu finden. Das Projekt ist im Januar 2025 gestartet, wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und des Freistaats Sachsen gefördert. Es läuft bis Juni 2026 als Modellvorhaben zur Zukunftsplattform für Soziale Innovationen.
]]>Deep Tech (kurz für „Deep Technology“) steht für Technologien und Unternehmen, die Lösungen auf der Grundlage erheblicher wissenschaftlicher oder technischer Innovationen anbieten.
Die Gründungsmitglieder der „Startup Campus Alliance“ sind:
- Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig
- Universität Leipzig
- Technische Universität Dresden
- Technische Universität Chemnitz
- TU Bergakademie Freiberg
- Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
- Hochschule Mittweida
- HHL Leipzig Graduate School of Management
- Friedrich-Schiller-Universität Jena
- Ernst-Abbe-Hochschule Jena
Die „Startup Campus Alliance“ will die Kräfte der Hochschulen in Sachsen und Thüringen im Bereich Gründungsförderung strategisch bündeln und dadurch wirksame Synergien schaffen. Durch gemeinsame Lehrformate, geteilte Infrastruktur und interdisziplinäre Zusammenarbeit entstehen innovative Unterstützungsangebote für gründungsinteressierte Talente und Teams.
Ein zentraler Bestandteil der Allianz ist es, Erfolge im Bereich der Hochschulausgründungen sichtbar zu machen und so die öffentliche Wahrnehmung der Gründungsstandorte Sachsen und Thüringen zu stärken – national wie international. „Darüber hinaus trägt die hochschulübergreifende Kooperation wesentlich zur Weiterentwicklung des regionalen Startup-Ökosystems bei. Immerhin kommen bereits jetzt die meisten Gründungsideen aus den Hochschulen“, sagt der Leipziger Universitätsprofessor Utz Dornberger, der zum Vorsitzenden des Vereins gewählt wurde. In Sachsen habe es 2023 knapp 100 Startup-Neugründungen gegeben, mehr als 60 davon seien auf Gründungsprojekte aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen
zurückzuführen. Utz Dornberger ist Professor für Entwicklungsökonomie mit besonderem Schwerpunkt auf kleinen und mittleren Unternehmen. Er leitet zudem die Selbstmanagement-Initiative Leipzig (SMILE), die Gründungsinitiative der Universität Leipzig.
„Die Gründung der Hochschulallianz ist ein großer Fortschritt für das sächsische Gründungsökosystem. Die hochschulübergreifende Zusammenarbeit ermöglicht es uns als HTWK Leipzig in einem Verbund aus starken Partnern die Innovationskraft unserer Einrichtungen zu stärken und die Sichtbarkeit sowohl auf regionaler als auch auf internationaler Ebene zu erhöhen", betont Prof. Dr.-Ing. Faouzi Derbel, Prorektor für Forschung und Nachhaltigkeit der HTWK Leipzig. „Mit unserer hochschuleigenen Gründungsberatung ‚Startbahn 13‘ sind wir - als Hochschule Angewandter Wissenschaften mit starkem Anwendungsbezug - besonders im technischen bzw. ingenieurwissenschaftlichen Bereich stark. Das spiegelt sich deutlich in der Ausrichtung unserer Ausgründungen wider", betont Prof. Dr.-Ing. Faouzi Derbel, Prorektor für Forschung und Nachhaltigkeit der HTWK Leipzig.

Organisatorische Basis für die Zusammenarbeit ist der gemeinnützige Verein „Startup Campus Alliance“. Der Verein dient als koordinierende Plattform, über die die vielfältigen Aktivitäten der hochschulischen Gründungsförderung effizient gebündelt und strategisch ausgerichtet werden können.
Zudem ermöglicht die Vereinsstruktur eine gemeinsame Interessenvertretung in der Business Opportunities Ost (boOst) Ecosystem gGmbH, welche sich parallel zur Etablierung der Allianz gerade in Gründung befindet. Neben den Sparkassen in Sachsen, dem SpinLab in Leipzig und der TUDAG werden aktuell noch Gespräche mit weiteren privaten Kapitalgebern geführt. Diese starke Partnerschaft soll die Gründung innovativer Startups aus den Hochschulen heraus unterstützen.
Die boOst gGmbH bewirbt sich im Wettbewerb „Startup Factories“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, der ausgewählte deutsche Startup-Ökosysteme beim Aufbau wissensbasierter Ausgründungen unterstützt. Darin soll ein Modell für eine thematisch bzw. regional ausgerichtete „Startup Factory“ entwickelt werden, die als privatrechtliche Organisation außerhalb des Hochschulrahmens agiert.
Das zur Herstellung verwendete Tampondruckverfahren ist ein indirektes Tiefdruckverfahren und bekannt aus dem grafischen Druck für Ziffernblättern von Armbanduhren, die Schrift auf Computertastaturen sowie andere gewölbte und unebene Oberflächen. Seit wenigen Jahren findet es nun zunehmend Anwendung in der gedruckten Elektronik: Die Farbübertragung mittels elastischen Silikontampon von Druckplatte auf Substrat bietet gegenüber den etablierten Druckverfahren (Sieb-, Inkjet- und Tiefdruck) einige Vorteile und erweitert damit das Anwendungsfeld von Drucktechnik in der Elektronik.
Im Druckprozess ist es durch die exakte Ausrichtung des Substrats gelungen, den mehrschichtigen Aufbau aus drei funktionalen Materialien (Silberpaste von Henkel, PEDOT:PSS von Heraeus, Isolation von Marabu) umzusetzen und Kanallängen von 90 Mikrometern zu realisieren. Die Charakterisierung der elektrischen Eigenschaften erfolgte mithilfe des Parameteranalysators im Electronic Engineering Lab der Arbeitsgruppe von Prof. Dr.-Ing. Gerold Bausch. Zunächst wurden ID - VD – Messungen bei festgelegten Gate-Spannungen durchgeführt, wobei typische Kennlinien für Transistoren im Verarmungsmodus erzeugt werden konnten. Anschließend wurden ID - VG – Messungen mit festgelegter Drain-Spannung (VD = 0,6 Volt) durchgeführt. Dabei wurde im Arbeitspunkt eine Transkonduktanz von 2,2 Millisiemens gemessen.
Die Abschlussarbeit von Florian Muschka zeigt, dass sich der Tampondruck als neues Herstellungsverfahren für organisch elektrochemische Transistoren eignet. Nun gilt es diese Erkenntnis zu nutzen, um in kommenden Arbeiten und Projekten das Potential und die Grenzen des Druckverfahrens zur Herstellung von OECTs weiter zu erforschen. Aktuell forscht er in den Projekten "PaperRock" und "IntelliSeal" im Team von Prof. Ingo Reinhold.
Aus- und Weiterbildung sowie berufliche und persönliche Netzwerke sind zentrale Faktoren der Arbeits- und Fachkräftesicherung, insbesondere angesichts der Transformationsprozesse im Mitteldeutschen Revier. Sowohl in der Literatur als auch in den geführten Interviews besteht Konsens darüber, dass Bildung eine grundlegende Ressource für die Regionalentwicklung im Mitteldeutschen Revier – und damit für einen erfolgreichen Strukturwandel – darstellt.
Aus- und Weiterbildung: zentrale Faktoren der Arbeits- und Fachkräftesicherung
Es werden Wege aufgezeigt, potenzielle Arbeits- und Fachkräfte für die Region zu gewinnen und aktuelle Arbeits- und Fachkräftesicherung in der Region zu halten. In den Interviews wird die Notwendigkeit hervorgehoben, in der schulischen und beruflichen Ausbildung den Schwerpunkt auf einen bedarfsgerechten Kompetenzerwerb zu legen und den Bezug zur beruflichen Praxis bereits während der Schulzeit in allen weiterführenden Schulen herzustellen.
Neben der Ausbildung stellt die Weiterbildung einen weiteren wichtigen Faktor der Standortpolitik dar. Im Mitteldeutschen Revier ist ein starker Zuwachs an Weiterbildungsangeboten zu verzeichnen, so dass die Unübersichtlichkeit der Weiterbildungsangebote zur Herausforderung wird. Bildungsangebote sollten in regionalen Bildungscampus gebündelt werden. Aus- und Weiterbildungsangebote können dort strukturiert und übersichtlich an einem Ort angeboten werden. Somit könnte eine qualitativ hochwertige und zeitgemäße Aus- und Weiterbildung gewährleisten werden. Die Campus würden zu Orten, an denen lebenslanges Lernen institutionell verankert wird. Damit sind sie auch für Unternehmen in ländlichen Regionen attraktiv.
Rolle beruflicher und privater Netzwerke
Darüber hinaus werden in den geführten Interviews berufliche und private Netzwerke als zentral für die Fachkräftegewinnung und -sicherung sowie bei der Umsetzung von Projekten angesehen. Lokalen, informellen Netzwerken, die sich über Jahre hinweg gebildet haben, wird insbesondere in strukturschwachen Regionen eine große Bedeutung beigemessen. Häufig nutzen kleine und mittlere Unternehmen informelle Netzwerke zur Gewinnung von Arbeits- und Fachkräften anstelle einer systematischen und strategischen Arbeits- und Fachkräfteplanung.
Arbeits- und Fachkräftesicherung dient der Arbeits- und Fachkräftegewinnung
Während der Fokus häufig auf der Gewinnung neuer Fach- und Arbeitskräfte liegt, sollten Unternehmen verstärkt darauf achten, wie sie ihre bestehenden Mitarbeitenden halten können. Aus- und Weiterbildung sollten nicht als passive, reagierende Instrumente verstanden werden, sondern als aktive Maßnahmen, um den Wandel mitzugestalten. Netzwerke und Weiterbildung sind ein zentraler Faktor für die Arbeits- und Fachkräftesicherung. In den geführten Interviews wird deutlich, dass diese Mitarbeitenden eine Schlüsselrolle einnehmen, indem sie durch ihre langfristige Bindung und Zufriedenheit das Unternehmen in ihren beruflichen und persönlichen Netzwerken weiterempfehlen. Die Sicherung von Fach- und Arbeitskräften kann dann den Unternehmen zur Fach- und Arbeitskräftegewinnung dienen.
Angehörige der HTWK Leipzig können über den Zugang der Hochschulbibliothek den Artikel kostenfrei lesen. Zum IzR-Artikel
Die Konferenz wird vom IT Cluster Mittelstand, vom Wirtschaftsrat Deutschland und von der HTWK Leipzig veranstaltet . Geladen sind 140 Gäste aus mittelständischen Unternehmen, der kommunalen Verwaltung sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Forschungsprojekte zum Thema Digitalisierung und Smart City vorstellen. Erstmals ist die HTWK Leipzig Mitveranstalterin sowie mit dem Nieper-Bau Veranstaltungsort.
HTWK-Rektor Prof. Dr.-Ing. Jean-Alexander Müller wird die Konferenz mit einem Grußwort einleiten. Er betont die Rolle der Hochschule als Partnerin in Sachen Forschung und Transfer: „Die HTWK Leipzig ist exzellent vernetzt und verfügt über breitgefächerte Kompetenzen in Schlüsselbereichen – von Informations- und Kommunikationstechnik über Medieninformatik bis Angewandte KI. Diese Expertise ermöglicht es uns, gemeinsam mit Unternehmen in der Region Lösungen zu entwickeln, die nicht nur technisch auf dem neuesten Stand sind, sondern auch einen nachhaltigen gesellschaftlichen Nutzen stiften.“
Smart City
Zu digitalen Konzepten, die Städte lebenswerter, effizienter, technologisch fortschrittlicher, ökologischer und sozial inklusiver machen sollen, tauschen sich Expertinnen und Experten 14:00 Uhr im „Smart City Panel“ aus. Im Podium sitzt Prof. Dr. Kiran Varanasi, Professor für Virtuelle und Erweiterte Realität an der HTWK Leipzig. Er gibt Einblicke in Masterarbeitsprojekte zur Modellierung der Stadtbeleuchtung in virtueller Realität, zur ökologischen Simulation als Computerspiel und zur Planung des Leipziger Weihnachtsmarkts in virtueller Realität.
Vernetzte Behörden
Prof. Dr. Andreas Both, Professor für Softwarearchitektur sicherer Systeme an der HTWK Leipzig, wird 11:50 Uhr eine Technologie vorstellen, die er mit seiner Forschungsgruppe Web & Software Engineering entwickelte. Das Government-to-Citizien-Verfahren vernetzt Behörden und Verwaltungseinheiten datensouverän und löst klassische Sollbruchstellen der deutschen Verwaltungslandschaft auf.
Fotoimpressionen der 16. Mitteldeutschen Digitalisierungskonferenz
Was, wann, wo?
16. Mitteldeutsche Digitalisierungskonferenz
„Digital First – Schluss mit dem Sand im Getriebe“
3. April 2025, 08:30 Uhr – 17:00 Uhr
HTWK Leipzig, Nieper-Bau
Karl-Liebknecht-Straße 134, 04277 Leipzig
„Welche Anwendungsgebiete es für die Drucksondierung gibt, welche neue Technik dafür zur Verfügung steht und wie wir am Institut für Geotechnik der HTWK Leipzig (IGL) diese Methode in unseren Forschungsprojekten einsetzen, zeigen wir bei unserem ersten DemoDay Drucksondierung am GeoTechnikum“, sagte Ralf Thiele, HTWK-Professor für Bodenmechanik, Grundbau, Fels- und Tunnelbau sowie Leiter des IGL, bei der Begrüßung.
Aus gemeinsamer Forschung entstand Idee zum DemoDay
Der Demonstrationstag am Mittwoch, den 19. März 2025, wurde gemeinsam vom IGL und Royal Eijkelkamp B.V. veranstaltet. Das niederländische Unternehmen Eijkelkamp entwickelt und produziert seit über 110 Jahren Geräte für die Bodenuntersuchung. Seit rund zwei Jahren arbeiten Eijkelkamp und das IGL am GeoTechnikum gemeinsam an Forschungsfragen zur Verbesserung der Drucksondiertechnik. Aus dieser Kooperation entstand die Idee, das Thema in der Region stärker sichtbar zu machen.
Zum DemoDay reisten rund 35 Vertreterinnen und Vertreter von 15 Firmen aus ganz Deutschland an. Die Teilnehmenden, darunter auch Studierende der Hochschule, erhielten In Präsentationen und Demonstrationen praxisnahe Einblicke in Technik, Einsatzmöglichkeiten, Durchführung sowie Interpretation von Drucksondierungen. Sie konnten das Verfahren dabei nicht nur theoretisch kennenlernen, sondern am praktischen Beispiel in den Versuchshallen am GeoTechnikum auch live erleben und sogar selber sondieren.
Live-Demonstrationen ermöglichen Blick in den Untergrund
Gerald Verbeek von Eijkelkamp eröffnete den fachlichen Teil mit einer theoretischen Einführung. Anschließend demonstrierte er mit einem Kollegen das Verfahren mit einer kompakten Sondierraupe in der Versuchshalle des GeoTechnikums. Ein besonderes Highlight war ein innovatives Video-Modul, das während der Sondierung hochauflösende Aufnahmen aus dem Untergrund lieferte. So konnten die Teilnehmenden von der Oberfläche aus direkt in den Untergrund blicken.
Parallel dazu präsentierten Bénédict Löwe vom IGL und Marco van Lichtenberg von Eijkelkamp ein tragbares Gerät zur Messung des Eindringwiderstands bis in eine Tiefe von etwa einem Meter. Es ermöglicht Aussagen über die Befahrbarkeit oder Durchwurzelbarkeit des Bodens und kommt beispielsweise bei der Prüfung der Bettungsqualität unterirdischer Stromkabel, also erdverlegter Kabeltrassen, zum Einsatz. In der Landwirtschaft kann mit dem Gerät bewertet werden, ob der Boden ausreichend locker für die Durchwurzelung oder fest genug für den Einsatz schwerer Maschinen ist.
Für die anwesenden Praxispartner war es ein informativer und abwechslungsreicher Tag mit vielen Gelegenheiten, neueste Technik selbst auszuprobieren. „Wir spielen mit dem Gedanken, uns auch solche Geräte anzuschaffen“, berichtete ein Unternehmensvertreter im Anschluss.
Ergänzend zur Vorführung erhielten die Gäste am GeoTechnikum einen Einblick in die bodenmechanischen und umwelttechnischen Labore sowie in die beiden Versuchshallen mit umfassender Messtechnik und eigenen Geräten für die Drucksondierung der Hochschule.
Wiederholung geplant
Weitere Demonstrationstage mit Praxispartnern sind bereits in Planung. „Es freut uns sehr, dass das Thema auf so großes Interesse stößt. Für uns ist das ein deutliches Zeichen, den Austausch weiter zu fördern und die Veranstaltung zukünftig mit weiteren Themenschwerpunkten fortzusetzen“, so Professor Thiele zum Abschluss der Veranstaltung.
Hintergrund zum Institut für Geotechnik Leipzig (IGL)
Die Geotechnik ist der zweitstärkste Forschungsbereich an der HTWK Leipzig. Um die Kompetenzen der beiden Geotechnikprofessuren von Prof. Ralf Thiele und Prof. Said Al-Akel zu bündeln, gründete sich im Oktober 2024 das Institut für Geotechnik an der HTWK Leipzig (IGL). Das interdisziplinäre Team aus den Bereichen Bauingenieurwesen, Maschinenbauingenieurwesen, Geografie und Geologie befasst sich insbesondere mit umweltgeotechnischen und klimarelevanten Fragestellungen. Ebenfalls beschäftigt es sich mit Themen der Makro- und Mikromechanik von Böden und überträgt Ergebnisse auf praktische Bauprozesse und aktuell relevante Querschnittsthemen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der Geotechnik. Der DemoDay Drucksondierung schließt an das Forschungsfeld der geowissenschaftlichen Messtechnik und Baugrundverbesserung an.
Die Geotechnik ist zudem Mitglied im Transferverbund Saxony⁵ der fünf sächsischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Im Teilprojekt „Nachhaltiges Bauen“ werden Forschungsergebnisse am GeoTechnikum ‒ einem Experimentier- und Demonstrationsraum mit Freiversuchsflächen und einem bodenmechanischen Forschungslabor ‒ in großem Maßstab validiert und für Partner aus Praxis und Wissenschaft demonstriert.
Vom 18. bis 20. März 2025 fanden in Athen gleich drei zentrale Veranstaltungen im Rahmen des Verbundprojekts statt: ein internes Fortschrittsmeeting, ein internationaler Workshop sowie ein Review-Meeting, organisiert von den beteiligten Projektpartnern. Mit am Start war auch das Team des Composite Circularity Labs der HTWK Leipzig, vertreten durch Prof. Robert Böhm, Philipp Johst, Marten Tschatschanidse und Jannick Schneider.
Im Fortschrittsmeeting wurden Ergebnisse aus allen Arbeitspaketen präsentiert. Der Projektpartner INEGI stellte unter anderem Entwicklungsfortschritte aus Arbeitspaket 3 (WP3) vor. In enger Zusammenarbeit mit dem Team des Composite Circularity Labs wurde ein großskaliger PV-floating-Demonstrator entwickelt, bei dem unter anderem umfunktionierte Rotorblattsegmente als Schwimmkörper für ein Photovoltaiksystem eingesetzt wurden. Ein erfolgreicher Feldtest bestätigte die Eignung von Rotorblattstrukturen als tragfähige Schwimmkörper. Weitere Informationen können hier eingesehen werden.
Im anschließenden internationalen Workshop wurde zudem ein breites Spektrum an Projekten zum Thema Kreislaufführung von Faserverbundwerkstoffen vorgestellt. Ziel war es, Grundlagen, aktuelle Erkenntnisse und Herausforderungen im Bereich des Recyclings und der Wiederverwendung von Faserverbundstrukturen insbesondere mit Studierenden zu teilen. Der Workshop gliederte sich in zwei Teile: Im ersten Teil wurden Fachvorträge gehalten, um Synergien zwischen Projekten aufzuzeigen und neue Impulse für eigene Forschungsarbeiten zu gewinnen. Im zweiten Teil erfolgte eine umfangreiche Labtour durch ausgewählte Labore der National Technical University of Athens, um die technologischen Möglichkeiten vor Ort zu demonstrieren.

Die Teilnahme der HTWK-Studierenden Marten Tschatschanidse und Jannick Schneider konnte Dank der finanziellen Unterstützung des Fördervereins der HTWK Leipzig realisiert werden und stellt einen bedeutenden Beitrag zur weiteren Internationalisierung des Studiums und zur Vernetzung mit internationalen Forschungseinrichtungen dar.

Den Abschluss bildete das offizielle Review-Meeting, bei dem zwei EU-Beauftragte den Projektfortschritt bewerteten. Sie bestätigten die realistische Erreichbarkeit der gesetzten Projektziele und formulierten Empfehlungen für die weitere Umsetzung des EuReComp-Projekts.
ECKDATEN Projekt EuReCOMP
Projektlaufzeit: 04/2022 – 03/2026
Förderung: Das Verbundprojekt wird vom zentralen Finanzierungsprogramm der Europäischen Union für Forschung und Innovation, Horizon Europe, gefördert.
Projektkoordinator: National Technical University of Athens (Griechenland)
Hochschulpartner: Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik TU Dresden, Politecnico di Torino (Italien), University of Patras (Griechenland)
Industriepartner: Elbe Flugzeugwerke GmbH (Luftfahrt-Zulieferer), Dallara Automobil (Automobilindustrie, Italien), Anthony, Patrick and Murta Exportacao (Windenergiebranche, Portugal) und IRES (Life Cycle Assessment, Belgien)
Forschungsinstitut: Kunststoff-Zentrum in Leipzig gGmbH
Die Forschungsprojekte der HTWK Leipzig befassen sich unter anderem mit sicherem Wohnen (SIWO), den Herausforderungen wohnungs- und obdachloser Frauen (INTERACT), der Rolle von Kultur als Transformations- und Resilienzfaktor in ländlichen Räumen (KulTRes) sowie dem Strukturwandel rund um den Braunkohleausstieg im Mitteldeutschen Revier (Digitalisierungszentrum Zeitz).
Im Mittelpunkt des Treffens standen der Austausch über aktuelle Forschungsvorhaben und die Präsentation des Visualisierungs- und Analysetools „hin&weg“ der IfL-Forschungsgruppe. Die digitale Anwendung bietet vielfältige Möglichkeiten, Bevölkerungsbewegungen auf verschiedenen Raumebenen auszuwerten und darzustellen. Zuverlässige Daten zu demografischen Entwicklungen bilden die Grundlage für bedarfsgerechte Planungen unter anderem in den Bereichen Bildung, Verkehr und Wohnen.
Der fachliche Austausch lieferte wertvolle Impulse für eine vertiefte Zusammenarbeit, die beide Teams in den kommenden Monaten weiter ausbauen möchten.
]]>Ein neues Großforschungsgerät ermöglicht der HTWK Leipzig nun, diese Pulver genauer zu analysieren: „Wir untersuchen Prozesse, bei denen das Pulver nicht nur als Baumaterial dient, sondern auch funktionale Eigenschaften besitzt. Zusätzliche Funktionen wie elektrische Leitfähigkeit können wir gezielt über einen Druckkopf einbringen. Dadurch eröffnen sich neue Möglichkeiten für die Herstellung multimaterialer und multifunktionaler Bauteile“, erklärt Ingo Reinhold, Professor für Beschichtungsprozesse an der HTWK Leipzig.
Um neuartige funktionale, 3D-gedruckte Materialien und Bauteile in einem vielfältigen und interdisziplinären Konsortium zu erforschen, bildete sich an der HTWK Leipzig der Forschungsbereich Multimaterial-AM heraus. In diesem bündeln Professoren aus den Fakultäten Informatik und Medien sowie Ingenieurwissenschaften ihre Kompetenzen. 2023 beantragten sie bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) eine Großgeräteförderung. Mit Erfolg: Als eine von 16 Hochschulen erhielt die HTWK Leipzig ab Januar 2024 eine Finanzierung in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro für Technik, um den 3D-Druck weiter zu erforschen. Zu den neuen Geräten gehören zwei 3D-Drucker und die nun eingetroffene Pulverscherzelle.
Neue Pulverscherzelle in Betrieb
Die Pulverscherzelle, ein Analyse-Gerät zur Bestimmung von Fließeigenschaften, ist Anfang März 2025 angekommen und in Betrieb genommen worden: „Mit dem Präzisionsrheometer von Anton Paar analysieren wir den Fluss von Pulvermaterialien in einer kontrollierten Temperatur- und Feuchteumgebung, um die Geschwindigkeit und Präzision der Prozesse weiter zu optimieren“, erklärt Reinhold.
Die Pulverscherzelle ermöglicht hochpräzise Rheologiemessungen im Temperaturbereich von 5 bis 120 Grad Celsius und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 5 bis 95 Prozent. Mit ihr lassen sich wichtige Parameter wie Kohäsion, Fließgrenze und Wandreibungseffekte ermitteln. Das ist besonders relevant für den High-Speed-Sintering-Druckprozess, bei dem unter anderem wasserbasierte Inkjet-Tinten eingesetzt werden. Der freigesetzte Wasseranteil kann die Fließfähigkeit des Pulvers erheblich verändern und damit die Dichte sowie die Qualität der gedruckten Bauteile beeinflussen. „Durch diese Messungen können wir gemeinsam mit unseren Partnern in der Materialforschung den Druckprozess gezielt analysieren und optimieren.“
In einer ersten Messreihe widmeten sich Reinhold und sein Team dem Alterungsverhalten von PA12-Pulvern aus dem Selective Laser Sintering (SLS). Reinhold: „Dabei konnten wir nachweisen, dass die Alterung zu einer Erhöhung der Kohäsion, also dem Zusammenhalt, führt, was die Verarbeitbarkeit mehrfach genutzter Pulver erschwert. Gleichzeitig bieten die Messdaten uns eine Grundlage, um die Wiederverwendbarkeit der Pulver gezielt zu verbessern und den notwendigen Auffrischungsgrad der Pulvermischungen zu minimieren. Zusätzlich kann die Temperatur- und Feuchteregelung auch für Versuche mit Kegel-Platte-Geometrie oder Torsion genutzt werden, um Materialkennwerte von Pasten oder Polymeren bei den entsprechenden Umgebungsparametern zu ermitteln.“
Weitere 3D-Drucker werden noch geliefert
Voraussichtlich im Sommer 2025 sollen auch die beiden neuen 3D-Drucker eintreffen. Der Drucker mit Powderbed-Fusion/IR-3D-Drucksystem kann verschiedene Pulver und Tinten durch Wärmestrahlung miteinander verschmelzen und neben der mechanischen Funktion des Bauteils auch lokal Eigenschaften definiert verändern. So können Forschende beispielsweise mit Nanopartikeln elektrische Leiter oder Sensorik in mechanische Strukturen einbringen.
Ein weiterer 3D-Drucker ist für medizinische Anwendungen vorgesehen. Er ermöglicht das Drucken komplexer Materialkombinationen in Granulat- oder Pastenform, die über die verschiedenen Druckköpfe eingespeist werden. Biomedizinerinnen und Biomedizinern erlaubt das Verfahren zum Beispiel, Knochenimplantaten Arzneimittel beizugeben, damit diese vom Körper besser angenommen werden.
Hintergrund zum Forschungsbereich Multimaterial-AM
Der Forschungsbereich Multimaterial-AM verbindet das fakultätsübergreifende Leipzig Center of Materials Science mit dem Institute for Printing, Packaging und Processing (iP3) an der Fakultät für Informatik und Medien, das bereits seit Jahren die Anwendung additiver Fertigungsverfahren im Rahmen der klassischen Druck- und Verpackungstechnik erforscht.<s> </s>
Das Team von Prof. Robert Böhm, Professor für Leichtbau mit Verbundwerkstoffen, gibt Einblicke in drei Projekte: Das europäische Forschungsprojekt EuReCOMP befasst sich mit nachhaltiger Kreislaufwirtschaft, das Iccas-Forschungsprojekt SoKoROMed mit Soft- und Kontinuumsrobotik für medizinische Anwendungen und PRINTCAP mit einer neuen Generation von 3D-gedruckten strukturellen Superkondensatoren als Energiespeicherlösungen für CO2-freie Mobilitätssysteme.
Das Team von Prof. Ingo Reinhold, Professor für Beschichtungsprozesse, zeigt Dichtungen und Transistoren. Die funktionalisierten Dichtungsmaterialien sind für den Einsatz in der Industrie 4.0 vorgesehen. Neben der dichtenden Funktion von Rohren sollen die Dichtungen Materialeigenschaften überprüfen können und somit den Wartungsaufwand minimieren. Die 3D-gedruckten Transistoren sollen wiederum für Sensoranwendungen, beispielsweise in der Medizintechnik zur Glukosemessung, genutzt werden.
Von der Arbeitsgruppe Hybride und Generative Fertigungstechnologien sind additiv hergestellte Schalldämpfer für zivile Anwendungen und eine 3D-gedruckte poröse Struktur für Zellwachstumsstudien ausgestellt. Diese sind Ergebnisse aus Projekten, in denen es um neuartige additive Leitungs- und Gehäusebauteile mit immanenten Schalldämpfungs- und Schalldämmungsstrukturen geht sowie um Design und Biofunktionalisierung von Cloud Sponge-inspirierten Scaffolds für eine verbesserte Leistung von Knochenzellen.
Zu sehen sind auch Ergebnisse aus dem Projekt AkkoLight von Prof. Johannis Zentner, bei dem Leichtbaulösungen in der Akkordeon-Fabrikationen entstehen. Auf der Messe können Besucherinnen und Besucher deshalb einen Demonstrator für ein leichtes Akkordeongehäuse aus geschäumtem Kunststoff, konkret aus LW-ASA, besichtigen. Schließlich gibt es aus dem Forschungsbereich Prozessleittechnik und Prozessführung von Prof. Tilo Heimbold einen Carbon Connector zu sehen. Dieser entstand im Projekt EMEK 3D. Hierbei geht es um ein 3D-Druckverfahren zur elektrischen Kontaktierung von Carbonfasern.
„Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit verspricht spannende Einblicke, wie neue Technologien verschiedene Branchen revolutionieren können, von erneuerbaren Energien über das Gesundheitswesen bis hin zur Fertigung“, so Dr. Dmytro Rassokhin von der Forschungsgruppe Leichtbau mit Verbundwerkstoffen
Unseren HTWK-Forschenden freuen sich auf Besucherinnen und Besucher sowie spannende Gespräche an Stand D40 in Halle 3.
Interessierte können zudem für Freitickets den kostenlosen Code „ITC25BUILDING“ nutzen.
Hintergrund zur Intec-Messe
Alle zwei Jahre treffen sich auf der Intec Fachleute aus dem Maschinen- und Anlagenbau, um sich über innovative und passgenaue Technik für die täglichen Aufgabenstellungen in der Produktion auszutauschen. Parallel zur Intec findet die Zulieferermesse Z statt, bei der Fachleute aus der Zuliefererbranche den Fokus auf Teile, Komponenten, Module, Technologien sowie industrielle Dienstleistungen legen. Damit wird also die komplette Wertschöpfungskette für die Metallverarbeitung abgebildet.
Öffnungszeiten:
- Bis 13.03.2025: 9:00 bis 17:00 Uhr
- 14.03.2025: 9:00 bis 16:00 Uhr
Weitere Bilder von der Messe
„Dass die HTWK Leipzig zu den zehn Finalisten gehört, ist bereits ein erster Erfolg. Es zeigt, dass unsere Hochschule hochkarätige Forschung betreibt, die das Prädikat exzellent verdient“, betont HTWK-Rektor Prof. Dr. Jean-Alexander Müller.
Forschungsimpuls „Soils@Cities“
Die HTWK Leipzig ist mit der Initiative „Resiliente Böden und funktionalisierte Materialgemische im urbanen Raum – Skalenübergreifende Analyse, Entwicklung und Prognose [Soils@Cities]“ unter den Finalisten. Dabei kooperiert die Hochschule mit dem Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) und der Technischen Universität München. Soils@Cities hat das Ziel, den städtischen Boden zu erforschen und dessen klimasichernde Funktionen voll auszuschöpfen, damit Städte dem Klimawandel gewachsen sind.
Der Boden übernimmt in Städten wichtige Funktionen: Er trägt Gebäude und Infrastruktur, dient aber auch als Filter und Puffer im Bereich des Wasserhaushalts und des Schadstoffmanagements. So speichert und reinigt der Boden Niederschlagswasser, tränkt Vegetationsflächen und kühlt damit die Stadt. Durch eine zunehmende Flächenversiegelung nimmt die dafür nutzbare Bodenfläche jedoch stetig ab, infolge des Klimawandels nehmen gleichzeitig Hitzeinseln und Flächenüberflutungen zu. Die Folge: In Städten werden immer häufiger Extremwerte bei Temperaturen, Trockenheit und Niederschlagsereignissen erreicht.
Um diesen Klimaeffekten entgegenzuwirken und gleichzeitig die Klimaresilienz der Städte zu erhöhen, muss der Boden Regenwasser im urbanen Raum schnell aufnehmen und längerfristig speichern. Dafür ist ein besseres Verständnis der Puffer- und Filterfunktionen des städtischen Bodens erforderlich. Hier setzen die Forschungen im Vorhaben Soils@Cities an.
Hintergrund zum DFG-Programm Forschungsimpulse
Forschungsimpulse sind Forschungsverbünde zu einem selbst gewählten Thema, das Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gemeinsam erforschen. Im Mittelpunkt steht die erkenntnisorientierte Forschung an HAW in Deutschland. Deren Potenzial, anwendungsnah zu forschen, soll stärker erschlossen werden, indem die Bedingungen für Forschung gestärkt und die wissenschaftliche Profilbildung an den Hochschulen unterstützt werden. Das Förderprogramm der DFG will so den Wirtschaftsstandort Deutschland nachhaltig stärken und seine internationale Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Die Fördersumme und -dauer hängt vom beantragten Projekt ab; bis zu acht Jahre Förderung bei maximal einer Million Euro Fördersumme pro Jahr sind möglich.

Die Ausschreibung richtet sich an Forscherinnen und Forscher mit einer exzellenten Dissertation in Betreuung einer Professorin oder eines Professors an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, die im Jahr 2023 erfolgreich verteidigt wurde. Promovendinnen und Promovenden können sich auf Vorschlag der Betreuerin oder des Betreuers ihrer Arbeit bewerben.
Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert. Der Preis ist nicht teilbar.
Die eingereichte Arbeit sollte bereits in deutscher oder englischer Sprache zur Veröffentlichung angenommen worden sein. Bewerbungen sind zu richten an .
Folgende Unterlagen sind einzureichen:
- Ein Exposé inklusive einer Darstellung der Bedeutung und Anwendbarkeit der wissenschaftlichen Arbeit für die Praxis;
- eine Kopie der Promotionsurkunde bzw. offizieller Nachweis über das Ergebnis der Promotionsverteidigung;
- ein Empfehlungsschreiben der vorschlagenden Professorin bzw. des vorschlagenden Professors der HTWK Leipzig mit Würdigung der Vergabekriterien des Dissertationspreises;
- ein Exemplar der Dissertation in elektronischer Form;
- eine Liste der Publikationen, die aus der Dissertation hervorgegangen sind;
- ein Lebenslauf;
- eine Liste bisheriger Förderungen oder Preise.
Die Unterlagen sind in separaten PDF-Dokumenten in exakt der vorgegebenen Gliederung einzureichen.
Die Auswahlkriterien sind in den „Bestimmungen über die Vergabe des Dissertationspreises der Stiftung HTWK“ aufgeführt. Es wird ein Abschlussprädikat von mindestens magna cum laude für die Dissertation vorausgesetzt.
Bewerbungsfrist: 31. März 2025.
Die Jury besteht aus einem Mitglied des Rektorats sowie einem weiteren Mitglied der Professorenschaft der HTWK Leipzig sowie zwei Gremienmitgliedern der Stiftung HTWK. Die Jury trifft die Entscheidung einstimmig. Die Einreichung der Bewerbung begründet keinen Anspruch auf den ausgeschriebenen Preis.
Fragen zur Bewerbung: dissertationspreis[at]htwk-leipzig.de
Ein Impuls, einen solchen Sammelband herauszubringen, ging u.a. von Community Working Group "Digitale Labore" des Hochschulforums Digitalisierung aus. Das Team der Working Group, in dem auch einige Mitarbeitende mitteldeutscher Hochschulen wie der TU Ilmenau & der TU Bergakademie Freiberg vertreten sind, widmet sich der für den Einsatz von Remote-Laboren wichtigen Verknüpfung von Entwicklungsperspektive und Ingenieurdidaktik und plant, den Grundstein für die erste deutschlandweite Plattform zu Remote-Laboren zu legen.
Innerhalb des Bandes werden internationale Forschungsergebnisse präsentiert, die sowohl neue Erfahrungen während der COVID-19-Pandemie als auch langfristige Forschungsbemühungen zu Online-Laboren und virtuellen Experimenten im Bildungskontext umfassen. Forscherinnen und Forscher sowie Praktikerinnen und Praktiker verschiedener Nationalitäten, z.B. aus den USA, Ägypten & Deutschland, stellen aktuelle Trends, kritische Herausforderungen und zukünftige Chancen für laborbasierte Bildung im Kontext des Online-Lernens dar. Die Labore und Experimente erstrecken sich über verschiedene Disziplinen, darunter Ingenieurwissenschaften, Umweltstudien und Pharmakologie, mit verwandten Arbeiten in der Hochschulforschung, Online-Lernen, Informatik, Benutzererfahrung, Lernlaboren und virtueller Realität.
Aus dem FAssMII Teilprojekt zu Online-Praktika in der Messtechnik konnten Professor Mathias Rudolph und Projektmitarbeiter Silvio Hund die Entwicklungen ihres Online-Praktikums sowie die damit beobachteten Vorteile und Herausforderungen der Digitalisierung von Laborerfahrungen in diesem zentralen Buch zu Online-Laboren beschreiben.
In ihrem Artikel „Building a Remote Laboratory Using a Practical Example from Undergraduate Engineering Practice“ wird der Prozess hin zu einem Online-Labor für Studierende der Ingenieurwissenschaften beschrieben. Das Ziel dieses Labors ist es, Studierenden die Möglichkeit zu geben, aus der Ferne mit echten Laborgeräten zu interagieren und dabei die Qualität und Flexibilität der Ausbildung zu erhalten. Ein Prototypsystem, das die Serversoftware „Guacamole“ verwendet, ermöglicht dabei den sicheren Zugriff auf Laborgeräte wie Oszilloskope und Signalgeneratoren über Hochschulnetze oder VPNs. Dieses System gestattet es den Studierenden, Schaltkreise aus der Ferne zu bauen und zu testen, so dass das praktische Lernen erhalten bleibt.
Das Buch „Online Laboratories in Engineering and Technology Education“ ist im Januar 2025 bei Springer Nature Link online erschienen.
Risiko einschätzen und Schutzmaßnahmen planen

„Mit dem erweiterten Angebot erreichen wir nun auch die Bürgerinnen und Bürger von Markkleeberg bis Schkeuditz. Das Angebot soll insbesondere Grundstücksbesitzerinnen und -besitzern helfen, das Risiko eines Schadensereignisses besser einzuschätzen und Schutzmaßnahmen für betroffene Gebäude in Betracht zu ziehen“, sagt ZV WALL-Geschäftsführerin Jeanine Höse.
Das Institut für Wasserbau und Siedlungswasserwirtschaft (IWS) der HTWK Leipzig erstellte die Karte auf Basis von dynamischen, modelltechnischen Computersimulationen. Grundlage für die Berechnungen ist ein digitales Geländemodell mit 1x1-Meter-Raster. Darin sind Informationen zur Höhe sowie zur Oberflächenbefestigung enthalten. Tilo Sahlbach, Wasserwirtschaftsexperte der HTWK Leipzig, erläutert: „Die Starkregengefahrenkarte stellt drei Regenszenarien dar: Vom intensiven Starkregenereignis, welches statistisch gesehen alle 30 Jahre wiederkehrt, über das außergewöhnliche Starkregenereignis, welches einmal in 100 Jahren auftritt, bis zum extremen Starkregenereignis. Das ist die größte bisher in Leipzig gemessene Niederschlagsmenge von 80 Millimetern Niederschlagshöhe innerhalb einer Stunde. Farbige Markierungen von blau bis magenta zeigen besonders überflutungsgefährdete Flächen.“
Regenwasser intelligent nutzen
„Die klassische Ableitung von Regenwasser über die Kanalisation stellt längst nicht die alleinige Lösung für den Umgang mit zunehmend heftigen und kleinräumigen Regenereignissen dar. Die Kanalisation flächendeckend auf die selten und zumeist lokal begrenzten Starkregen auszulegen, ist aufgrund des Platzmangels im Untergrund schwer umsetzbar und zudem wirtschaftlich nicht vertretbar. Die Kanäle wären dann für den Normalbetrieb viel zu groß“, betont der Technische Geschäftsführer der Leipziger Wasserwerke, Dr. Ulrich Meyer und ergänzt. „Beim Niederschlagswasser müssen wir mit Blick auf Klimaentwicklung und Stadtgestaltung gemeinsam umdenken: Im Zusammenspiel von Kommune, Abwasserentsorger und dem Grundstückseigentümer gilt es, Regenwasser intelligent zu nutzen, das heißt, es zurückzuhalten, zu versickern oder zu speichern.“
Individuelle Lösungen
Haus- und Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, die wissen wollen, wie stark ihr Grundstück gefährdet ist und Vorsorge betreiben wollen, können bei den Leipziger Wasserwerken eine noch genauere grundstücksbezogene Detailauskunft beantragen. „Menschen können in ihrem persönlichen Umfeld, der Mietergemeinschaft und auf Stadtteilebene Möglichkeiten zum Umgang mit Regen schaffen. Es machen am Ende auch kleine Dinge aus, dass unsere Idee von einer nachhaltigen Entwicklung und der sogenannten Schwammstadt gelingt“, erklärt Jens Riedel, aus dem Team Niederschlagswassermanagement der Leipziger Wasserwerke. Eine einheitliche Lösung gibt es aufgrund der Komplexität dafür aber nicht. „Einige Menschen nutzen Regenwasser im Garten und auf dem Balkon, indem sie es in Kaskadenspeichern aus Tonnen sammeln. Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer installieren Zisternen, Versickerungsanlagen oder Feuchtbiotope, um Regenwasser zu nutzen und Trinkwasser zu sparen“, sagt Riedel.
Das gemeinsame Kartenmaterial von Stadt Leipzig und ZV WALL findet sich auf http://www.leipzig.de/starkregen und www.zvwall.de/regenwasser.html.
Mit diesen und weiteren Fragen befasste sich Rüdiger Wink, Professor für Volkswirtschaftslehre an der HTWK Leipzig, mit seinem Team, Hanna Fischer und Anne Rauchbach. Die Forschenden erstellten eine Studie zum „IT-Fachkräfte- und -Ausbildungsbedarf in IT-Berufsfeldern in der Region Leipzig“. Diese führten sie im Auftrag der Invest Region Leipzig GmbH und unterstützt vom IT Cluster Mitteldeutschland im Rahmen der Fachkräfte-Richtlinie der Sächsischen Aufbaubank aus.
Am 22. Januar 2025, stellten Wink und sein Team die Studie bei einer Experten- und Netzwerkveranstaltung erstmals vor. Vertreten waren unter anderem Gäste aus Hochschulen, Bildungsträgern, Agenturen für Arbeit sowie Partner aus Personalvermittlungen. Sie diskutierten im Anschluss die Ergebnisse und Lösungsansätze der Fachkräfteanalyse.

Datenbasis
Für die Untersuchung nutzten Wink und sein Team amtliche Daten und eine Online-Auswertung von Stellenangeboten für IT-Berufe. Zudem führten sie Experteninterviews und eine Online-Umfrage mit Unternehmen aus der IT-Wirtschaft und der einschlägigen Personalvermittlung durch.
KI-, Programmier- und Sprachkenntnisse wichtig
Demnach ergab sich, dass die IT-Unternehmen in der Region ihren Schwerpunkt in den Bereichen Softwareentwicklung, IT-Systemadministration und IT-Anwendungsberatung aufweisen. Die meisten Unternehmen gehen zudem von einem weiteren Fachkräftebedarf in den nächsten Jahren aus. Dieser richtet sich an Frontend- und Backend-Entwicklerinnen und -entwickler sowie DevOps Engineers und auf Technologiekenntnisse in gängigen Programmen und Programmfamilien. Mit diesen allgemeinen Qualifikationen und Grundlagenkenntnissen können die Unternehmen dann die Fachkräfte unternehmensspezifisch weiterbilden. Kenntnisse in der Programmiersprache Python seien im Hinblick auf KI-Entwicklungen und -Anwendungen von wachsender Bedeutung.
Insgesamt sei der Bedarf an Fachkräften im IT-Bereich in den kommenden zwei Jahren hoch und liege in der Region jeweils mindestens im mittleren dreistelligen Bereich. Mit Fachkräften aus dem Ausland könne der Bedarf bislang nur schwer gedeckt werden, da fehlende deutsche Sprachkenntnisse und aufwändige Visa-Prozesse und Abstimmungen mit der Ausländerbehörde Hemmnisse in der Rekrutierung darstellen.
Fachkräfte vermehrt weiterbilden und qualifizieren
Um die Bedarfe an IT-Fachkräften in der Region zu decken, müssen Unternehmen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen und die Bundesagentur für Arbeit passende Qualifikationsmöglichkeiten und Weiterbildungsangebote bereitstellen und sich diesbezüglich abstimmen. Um Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben, braucht es zudem Angebote zur Sprachförderung; für Unternehmen außerdem zusätzliche Informations- und Beratungsangebote zu Visa-Prozessen.
Fotoausstellung

Erstmals zeigt das Referat Forschung vom 5. bis zum 28. Februar 2025 in einer Fotoausstellung im Foyer der Hochschulbibliothek alle bisherigen Gewinnerbilder des Fotowettbewerbs, denn vor genau zehn Jahren wurde der Fotowettbewerb erstmals ausgerufen. Vom 5. bis zum 28. Februar 2025 sind die Bilder während der Öffnungszeiten der Hochschulbibliothek zu sehen. Die Vernissage am 5. Februar bot den feierlichen Anlass zur Urkundenübergabe und Gratulation der aktuellen Preisträgerinnen und Preisträger.
And the winner is …
Der erste Platz des Fotowettbewerbs geht an Florian Muschka (links), Anika Mühl (rechts) und Sammy Schließer (Fotograf). Das Foto zeigt die Masterstudentin der Druck- und Verpackungstechnik und den wissenschaftlichen Mitarbeiter von Prof. Dr. Ingo Reinhold bei der Charakterisierung von gedruckten organisch elektrochemischen Transistoren (OECTs). Die hohe Empfindlichkeit und die Kompatibilität mit wässrigen Umgebungen machen OECTs ideal für Sensoranwendungen, beispielsweise in der Medizintechnik zur Glukosemessung. Die Transistoren stellten die Forschenden mittels Tampondruck her, einem Tiefdruckverfahren aus der grafischen Industrie, das sich besonders für gewölbte und unebene Oberflächen eignet. Mühl untersucht in ihrer Masterarbeit den Einfluss von Prozessparametern die Druckqualität und Leitfähigkeit von Silberstrukturen im Tampondruck. Muschka erforscht das Druckverfahren für dichtungsintegrierte Sensorik im Projekt „IntelliSeal“ am Forschungs- und Transferzentrum Leipzig der HTWK Leipzig.
2. Platz
Den zweiten Platz erhalten die Bauingenieure Herrmann Busse (Fotografie) und Lorenz Spillecke (Bildbearbeitung) für eine Bildmontage, die ihre Vision des zukünftigen Arbeitsalltags im bodenmechanischen Labor zeigt. Durch Mixed Reality, bei der reale und virtuelle Objekte in Echtzeit miteinander interagieren, könnten Laborantinnen und Laboranten zusätzlich zur reellen Situation kontextbezogene Inhalte sehen. Mithilfe einer Mixed-Reality-Brille wird beispielsweise der Blick in die Probe hinein möglich. Diese Vision hat im bodenmechanischen Kontext ein hohes Innovationspotential, sei es für eine schnellere Verfügbarkeit und Vernetzung von Informationen oder für überfachliche und dezentrale Weiterbildungen. Busse promoviert derzeit an der Technischen Universität Berlin und an der HTWK Leipzig über die Interpretation von Drucksondierungsdaten, gemeinsam mit Spillecke entwickelt er im Projekt „RoadIT1.0“ unter der Leitung von Prof. Dr. Ralf Thiele ein Messsystem für die Beanspruchung des Straßennetzes.
2. Platz
Ebenfalls den zweiten Platz erreicht das Bild von Karl Marbach, Masterstudent im Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau/Energietechnik. Als wissenschaftliche Hilfskraft arbeitet er am Lehrstuhl für Produktions- und Logistiksysteme, geleitet von Prof. Dr. Martin Gürtler. Im Rahmen seines Masterprojekts arbeitet er daran, automatisiert Arbeitsablauf-Zeitanalysen (MTM-Analysen) aus Videosequenzen zu generieren. Dafür nutzt er unter anderem Motion Capture, ein Verfahren zur Erfassung von Bewegungen, sowie eine Objekterkennung. MTM-Analysen finden im industriellen Umfeld insbesondere bei der Planung und Bewertung von manuellen Montagetätigkeiten und bei der Ermittlung von betrieblichen Planzeiten Anwendung. Darüber hinaus werden damit Montageprozesse unter ergonomischen Gesichtspunkten bewertet. Marbach entwickelt dafür einen Algorithmus, der die erfassten Bewegungen zur Verbesserung bestehender Montage-prozesse nutzt. Auf dem Foto ist Marbach bei der Erstellung eines umfangreichen Trainingsdatensatzes zu sehen. Die Bildbearbeitung zeigt die gemessenen beweglichen Bereiche der Hand.
3. Platz
Den dritten Platz des Fotowettbewerbs erhält Niels Clasen, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsgruppe FLEX. Der Bauingenieur erforschte im Projekt „Directed Timber Pressfitting“ unter der Leitung von Prof. Dr. Alexander Stahr im Rahmen seiner Masterarbeit die Klemmwirkung von leimfreien und sortenrein trennbaren Dübel-Verbindungen aus Holz. Die Forschungsgruppe prüfte stabförmige Rundholzdübel, die sie mit Nägeln aus Kunstharzpressholz aufspreizten und fest im Bohrloch einer Furnierschichtholzplatte (LVL) verbanden. In einer Versuchsreihe prüfte Clasen die Tragfähigkeit an 80 Prüfkörpern mit verschiedenen Modifikationen des Dübels. Die ersten Versuche, den Nagel stirnseitig in den Dübel einzutreiben, führten zunächst nicht zu Erfolgen: Dübel zerrissen, Platten spalteten sich auf und Nägel brachen, wie hier im Bild zu sehen. Doch diese Fehler waren wichtig für den Erkenntnisgewinn; weitere Experimente führten zur Lösung: Vorbohrungen, genauere Abstimmungen zwischen Nagel- und Dübelgröße sowie LVL-Platten mit Querlagen konnten die Verbindung schließlich auf bis zu 2 Kilonewton Auszugsfestigkeit perfektionieren.
Die Jury
Die Jury, bestehend aus dem freien Wissenschaftsfotografen Swen Reichhold, dem Referenten für Forschung Dirk Lippik sowie Katrin Haase, Forschungskommunikation, und Dr. Franziska Böhl, Forschungsmarketing, bewerteten die eingereichten Bilder unter Gesichtspunkten wie Fotoqualität, Umsetzung der Bildidee, Einzigartigkeit und Bildkomposition.
Jetzt Foto einreichen
Auch in diesem Jahr ruft das Referat Forschung wieder alle Forschenden der HTWK Leipzig dazu auf, persönliche fotografische Eindrücke einzureichen. Die Einreichung ist ab sofort möglich. Mehr Informationen finden Sie hier.
Bildergalerie Vernissage
Kern des Projekts ist die Entwicklung kleinformatiger, leichter Carbonbetonplatten, die mechanisch mit Holzbalken verbunden werden. Durch diese Bauweise wird eine einfache Montage und Demontage möglich – ohne Klebeverbindungen. Dies macht das System besonders nachhaltig und wiederverwendbar. Carbonbeton ermöglicht zudem eine erhebliche Reduktion der Bauteildicke und des Eigengewichts, wodurch sich das System flexibel an die Anforderungen von Bestandsbauten anpassen lässt.
Nachhaltigkeit und Effizienz
HBVcarbon adressiert die Herausforderungen im Bauwesen hinsichtlich Nachhaltigkeit und Effizienz. Es bietet eine vielversprechende, kostengünstige Lösung für die Sanierung von Holzbalkendecken, die modernen Anforderungen gerecht wird. Im Projekt unterstützen die Bauingenieure der HTWK Leipzig das Unternehmen Holzbau Meyer, das die Anwendung der Carbonbeton-Fertigteile untersucht. Die HTWK Leipzig entwickelt effiziente Verbindungstechnologien, die eine zentrale Rolle im Projekt spielen.
Kreislaufgerechtes Bauen

Im Forschungsprojekt builtZero, welches am 1. März 2025 startet, entwickelt die Forschungsgruppe Nachhaltiges Bauen des Instituts für Betonbau (IfB) gemeinsam mit dem Abbund-Zentrum Oelsnitz GmbH & Co. KG und TSM Bau GmbH aus Riesa ein Bausystem für leichte und treibhausgasneutrale Gebäudemodule zum kreislaufgerechten Bauen.
Die Gebäudemodule bestehen aus einem tragenden Rahmensystem und Sandwich-Wandelementen aus effizienten, umweltfreundlichen Materialien, unter anderem Stroh als Dämmmaterial und Holz. Bei der Entwicklung stehen optimierte Produktion, reduziertes Gewicht und reversible Bauprozesse im Fokus. Neue Fügetechniken sollen eine schnelle, automatisierte Montage und Demontage ermöglichen. Besonders hervorzuheben sind dabei besonders leichte Carbonbetonelemente, modulare Rahmen und wiederverwendbare Komponenten, unterstützt durch automatisierte Fertigungsprozesse. Das Teilvorhaben der HTWK fokussiert auf die Bauphysik der Wandbauteile, auf konstruktive Fragen sowie auf den Lebenszyklus der Gebäudemodule. Dazu wird ein bauphysikalisches Modell und ein Lebenszyklusmodell der Module erstellt, womit die verschiedenen Lösungsansätze für das Wandbaukastensystem bewertet werden können. Daneben untersucht die HTWK Leipzig Möglichkeiten der Automatisierung der Montage und Demontage der Wandbauteile und führt dafür Versuche durch.
Fördervolumen
Das Projekt HBVcarbon wird bis 12/2026 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) im Rahmen des Förderprogramms Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) gefördert. builtZero wird bis 2/2028 von der Sächsischen Aufbaubank finanziert. Das gemeinsame Fördervolumen beträgt knapp 800.000 €.
Neben dieser Forschungsstärke ist die Tatsache, dass bereits heute ca. 40 Prozent aller HTWK-Professuren im ingenieurwissenschaftlichen Bereich (z. B. Bauingenieurwesen, Elektrotechnik und Informationstechnik, Maschinenbau) nach dem neuen Kriterienkatalog kooptiert werden könnten, ein weiterer Beleg für den Anspruch auf ein eigenes Promotionsrecht. Dieser Katalog war von der sächsischen Landesrektorenkonferenz (LRK) im Benehmen mit dem SMWK gemäß den Anforderungen des neuen Sächsischen Hochschulgesetzes im Dezember 2024 veröffentlicht worden.
Maßgebliche Kriterien sind die Höhe der eingeworbenen Drittmittel und die Anzahl wissenschaftlicher Publikationen. Diese sogenannten Gleichstellungskriterien sollen eine objektive, gerechte und transparente Grundlage für die Aufnahme von HAW-Professorinnen und -Professoren in die Fakultät einer Universität gewährleisten.
Mit Blick auf die gesamte HTWK Leipzig inklusive des sogenannten GSW-Bereichs (Geistes- und Sozialwissenschaften, einschließlich Geschichts-, Kultur-, Kunst- und Sprachwissenschaften sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften) könnten rund ein Viertel der gegenwärtigen Professuren nach den genannten Kriterien sofort kooptiert werden, da sie diese bereits ad hoc erfüllen.
Prof. Dr.-Ing. Faouzi Derbel, Prorektor für Forschung und Nachhaltigkeit: „Diese Zahlen belegen die Lehr- und Forschungsstärke unserer Hochschule sehr eindrucksvoll. Die Gleichstellungskriterien der LRK sind ein Fortschritt, Kooptation reicht aus unserer Sicht auf Dauer jedoch nicht aus. Daher muss es unser Anspruch bleiben, dass HAW in Sachsen endlich ein eigenes Promotionsrecht erhalten. Dass schon jetzt so viele unserer Professuren die Kriterien erfüllen, zeigt, dass an der HTWK Leipzig die Expertise da ist.“
HTWK-Rektor Prof. Dr.-Ing. Jean-Alexander Müller bekräftigt: „Wir sind überzeugt, dass ein eigenes Promotionsrecht für uns nicht nur die Qualität der angewandten Forschung weiter steigern, sondern über den Transfer auch die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt Leipzig und der regionalen Wirtschaft fördern würde. Im Moment haben die sächsischen HAW und insbesondere die an der Grenze zu Sachsen-Anhalt und Thüringen liegende HTWK Leipzig einen klaren Standortnachteil durch das fehlende eigene Promotionsrecht. Der Mangel an qualifiziertem Nachwuchs für Professuren an HAW ist eine große Herausforderung für die Zukunft der praxisnahen Forschung in Deutschland, die ja vor allem an Hochschulen wie unserer stattfindet. Wir müssen für Professorinnen und Professoren attraktiv sein – ein eigenes Promotionsrecht, mindestens für einzelne Bereiche, ist dafür unabdingbar.“
Die Herausforderung ist groß: Die Hälfte aller Professuren an der HTWK Leipzig wird bis 2030 altersbedingt frei. Schon heute jedoch sind Anzahl und Diversität qualifizierter Bewerbungen gering. Projekte zur strategischen Karriereförderung wie „Science Careers. Karrieren fördern. Talente gewinnen“ im Bund-Länder-Programm „FH Personal“ an der HTWK Leipzig fördern seit 2023 gezielt wissenschaftliche Karrieren. Dies allein reicht jedoch aus Sicht der HTWK Leipzig nicht aus. Das fehlende Promotionsrecht konterkariert diese Bemühungen zudem.
Hintergrund
Kooptation bedeutet: Professorinnen und Professoren an HAW sollen auf ihren Antrag und mit Zustimmung ihrer Hochschule an eine Fakultät einer Universität zum Zweck der Teilnahme an Promotionsverfahren kooptiert werden (Mitglied der Fakultät werden dürfen, meist befristet), wenn sie hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen Forschungsleistungen Professorinnen und Professoren an Universitäten gleichgestellt sind.
Sachsen ist eines von nur vier Bundesländern, das HAW nach wie vor kein eigenes Promotionsrecht zugesteht. Stattdessen sind lediglich kooperative Promotionen und Kooptationen möglich.
HAW-Professuren können also nur in den Promotionsprozess an Universitäten eingebunden werden, jedoch nicht selbständig Promotionen starten und betreuen. Hessen war 2016 das erste Bundesland, das HAW das eigenständige Promotionsrecht zugesprochen hat.
Vielfältige Aktionen zum 11. Februar
Zum Aktionstag lädt die HTWK Leipzig zu einer Plakatausstellung über die „Leaky Pipeline“ ein. Diese ist in der Hochschulbibliothek sowie in zahlreichen Gebäuden (z.B. dem Trefftz-Bau) der Hochschule öffentlich zugänglich. Begleitend gibt es einen thematischen Handapparat mit Buchempfehlungen, die sich mit Geschlechtergerechtigkeit und Diversität in der Wissenschaft befassen und ebenfalls in der Hochschulbibliothek zur Verfügung steht.
Eingeladen sind zudem alle sich weiblich verstehenden Angehörigen der Leipziger Wissenschaftseinrichtungen, am Aktionstag der Stadt Leipzig (Abteilung Wissenspolitik) sowie der Universität Leipzig teilzunehmen. Dort erwartet die Besucherinnen ein vielfältiges Programm, einschließlich eines Speed-Datings mit Wissenschaftlerinnen und der Filmvorführung „Picture a Scientist“.
Ungleiche Verteilung: Der Gender Gap bleibt eine Herausforderung
Frauen sind in vielen Bereichen der Wissenschaft weiterhin unterrepräsentiert. Es ist sogar so, dass mit jeder Stufe der akademischen Laufbahn – von der Schule bis zur Professur - der Anteil der Frauen weiter abnimmt. Dieses Phänomen wird als „Leaky Pipeline“ bezeichnet.
Auch an der HTWK ist dieser Leaky Pipeline-Effekt, der abnehmenden Frauenanteil auf jeder höheren Qualifikationsstufe, sichtbar.
So liegt der Frauenanteil bei den Studierenden an der HTWK Leipzig bei 37 Prozent, bei den kooperativen Promotionsvorhaben sind es dann nur noch rund 30 Prozent Promovendinnen.
Bei den Professuren sinkt der Frauenanteil noch weiter ab: Nur 27 von 156 Professuren sind an der HTWK Leipzig durch Frauen besetzt, dies entspricht einem Anteil von lediglich 17 Prozent.
Zusätzlich sind besonders in den MINT-Bereichen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) Frauen deutlich weniger vertreten. So lag beispielsweise an der HTWK der Frauenanteil unter den Studierenden in MINT-Studiengängen mit 26 Prozent deutlich unter dem durchschnittlichen Frauenanteil an allen Studierenden (37 Prozent).
Queere Menschen erfahren schon dadurch eine systematische Benachteiligung, dass viele Statistiken ausschließlich zwischen weiblichem und männlichem Geschlecht unterscheiden und somit zahlreiche Identitäten ausklammern.
Dies alles beeinträchtigt die Zukunftsfähigkeit der Wissenschaft – sowohl im internationalen Wettbewerb als auch bei der Konkurrenz um hochqualifizierte Fachkräfte auf dem außerakademischen Arbeitsmarkt.
Wissenschaft braucht Vielfalt – Angebote der HTWK Leipzig
„Die Wissenschaft lebt von unterschiedlichen Perspektiven und Ideen,“ betont die Zentrale Gleichstellungsbeauftragte Dr.in Julia Herrmann. „Wir müssen sicherstellen, dass niemand aufgrund seines Geschlechts oder seiner Identität von einem wissenschaftlichen Weg abgehalten wird.“
Dafür bedarf es gezielter Maßnahmen zur Sichtbarmachung und Anerkennung von Wissenschaftlerinnen, eines stärkeren Bewusstseins für bestehende Ungleichheiten sowie bildungspolitische Angebote. Denn: Mädchen, Frauen und LGBTQIA+ gehören in die Wissenschaft!
An der HTWK gibt es bereits viele Angebote/Maßnahmen zur Stärkung der Chancengerechtigkeit.
Wer mehr über darüber erfahren möchte, kann sich über folgende Angebote informieren:
- Ferienhochschule für Girls* an der HTWK Leipzig – 18.-20. Februar 2025
- Girls‘ Day - am 03. April 2025
- Queerer Stammtisch – Hochschulgruppe
- BIPoC - Hochschulgruppe
- Mentoring-Programm für BA-Studentinnen in MINT-Fächern
- Female Scientists Network
- Angebote zur Vereinbarkeit von Studium / Beruf und Familie sowie Pflege
- Angebote zur Beratung bei Konflikten oder Diskriminierungserfahrungen der Gleichstellungsbeauftragten
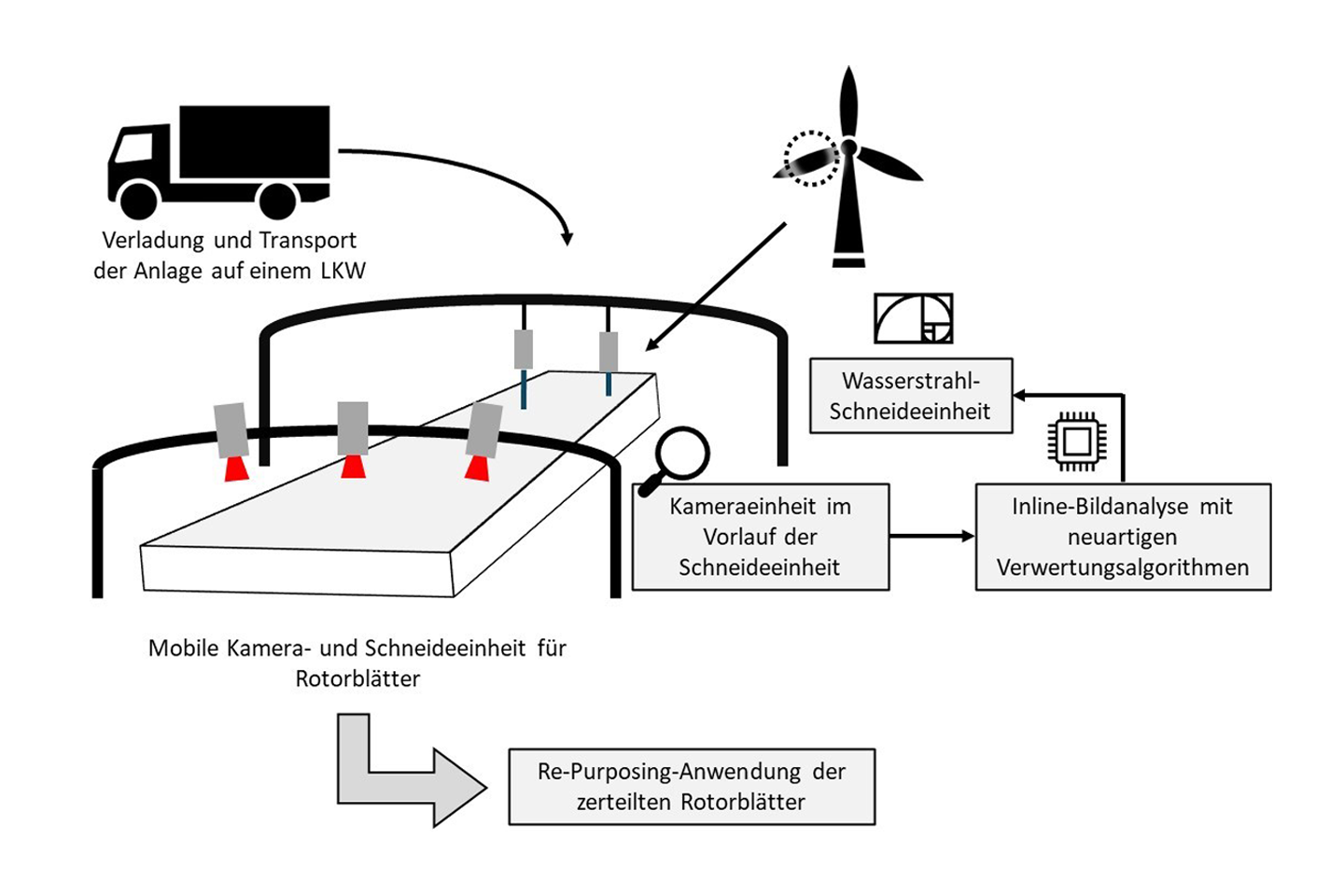
„Wir erhoffen uns von der in RecyRotor fokussierten Technologie eine Effizienzerhöhung bei der Wiederverwendung von Faserverbund-Großstrukturen. Häufig ist die Logistik, insbesondere die hohen Kosten des Transports der großen Rotorblätter vom Windpark bis zu einer Aufbereitungsstätte, der kritische Punkt, der einer Verwertung der Materialien im Sinne der Kreislaufwirtschaft bislang noch im Wege steht. Das RecyRotor-Verfahren wird diesen Nachteil in absehbarer Zeit beseitigen“, erläutert Projektleiter Prof. Robert Böhm. „Wir freuen uns, mit der Herion Engineering GmbH und der Zertrox GmbH zwei deutschlandweit führende Spezialisten auf den Gebieten Zuschnitttechnik und Bilderkennung für das Projekt gewonnen zu haben. Diese Zusammenarbeit wird die Repurpose-Technologie, die an der HTWK seit vier Jahren schrittweise zur Serienreife entwickelt wird, weiter beflügeln.“, prognostiziert der Leiter des CCL Philipp Johst. Das Vorhaben läuft bis Juni 2027 und wird im CCL Lab am Campus Eilenburger Straße durchgeführt.
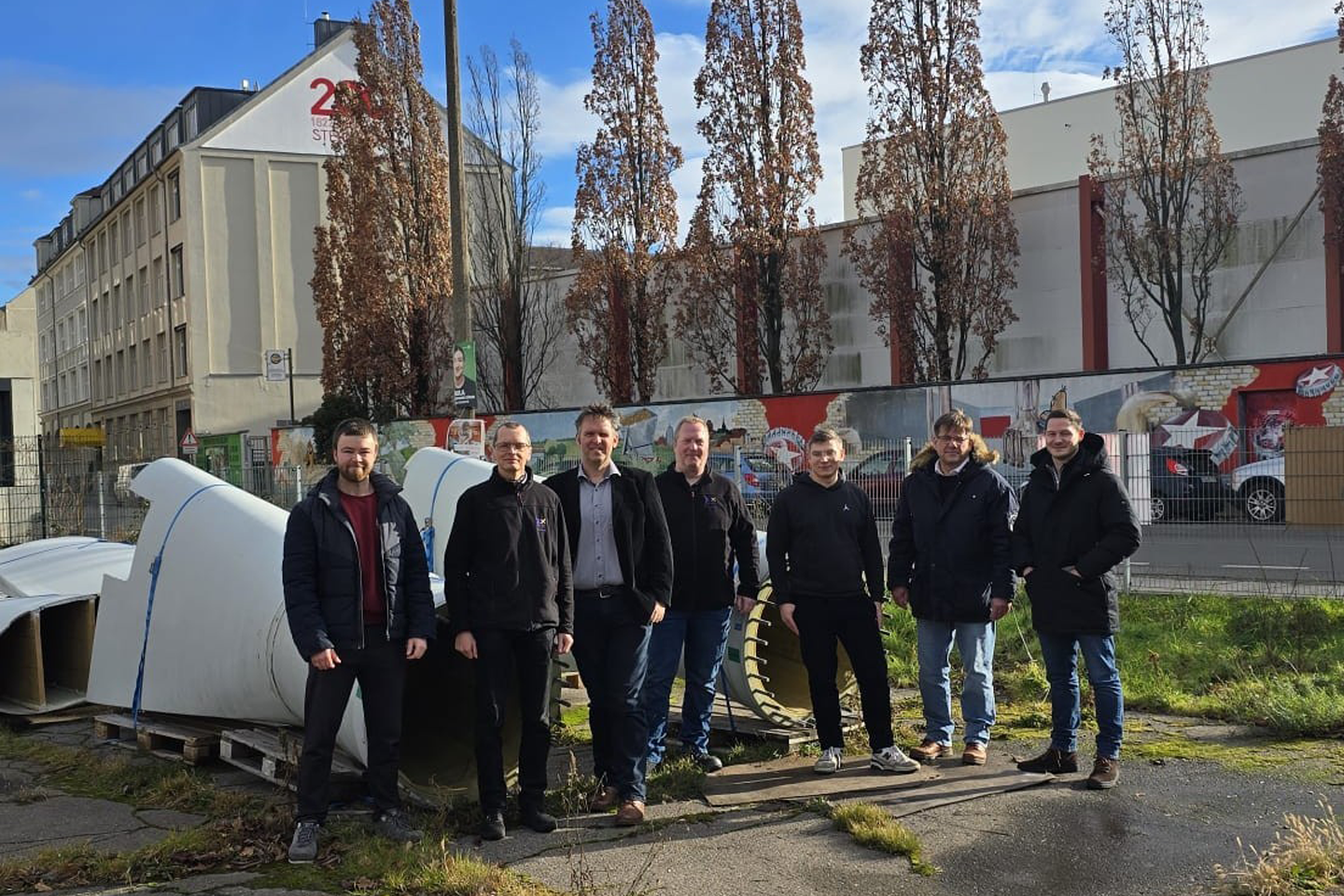

„Wir haben uns in dem Validierungsvorhaben dafür entschieden, Segmente aus ausgedienten Rotorblättern als Schwimmkörper für schwimmende Solaranlagen, sogenannte Floating PV’s, zu verwenden. Diese Repurpose-Lösung verspricht erhebliches Potenzial, da erwartet wird, die Materialkosten für Schwimmkörper zu reduzieren und gleichzeitig einen Beitrag zur Ressourcenschonung zu leisten. Wir werden in dem Vorhaben einen großskaligen Demonstrator für eine Floating PV entwickeln und unter Realbedingungen erproben.“, sagt Philipp Johst, Leiter des neu gegründeten Composite Circularity Labs an der HTWK Leipzig.
Das Validierungsvorhaben legt auch den Grundstein für die mögliche Gründung eines Start-ups, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Produkten aus wiederverwendeten Rotorblattmaterialien spezialisiert. „In enger Zusammenarbeit mit der Gründungsberatung ‚Startbahn 13‘ der HTWK werden wir in den kommenden 18 Monaten prüfen, ob unsere Repurpose-Lösungen in eine Ausgründung überführt werden können. Ein Schwerpunkt ist dabei die Bewertung der Marktchancen für Floating PV mit Schwimmkörpern aus umfunktionieren Rotorblattsegmenten. Ziel ist die Validierung einer nachhaltigen und wirtschaftlich attraktiven Lösung, die langfristig in großem Maßstab eingesetzt werden kann.“, fasst Projektleiter Prof. Robert Böhm die Idee des Validierungsvorhabens zusammen. Das Vorhaben läuft bis Mai 2026 und wird im Composite Circularity Lab am Campus Eilenburger Straße durchgeführt.
Zentrale Themen sind Photovoltaik, Solarthermie, Energiespeicher, Elektromobilität, Strom- und Wärmenetze sowie Sektorenkopplung. Darüber können sich Fachleute und interessierte Gäste bei mehr als 100 Ausstellerinnen und Ausstellern informieren sowie verschiedene Seminare besuchen und Vorträge anhören.
HTWK-Beitrag zur Solarforschung an der Hochschule
Unter den Vortragenden sind auch Mathias Rudolph, Professor für Industrielle Messtechnik an der HTWK Leipzig, und sein Team. Sie werden einen Einblick in die Solarforschung an der Hochschule geben. „Wir forschen beispielsweise seit vielen Jahren daran, wie Photovoltaikmodule und Nutzpflanzenproduktion sich gut ergänzen können“, so Rudolph. „Wir freuen uns darauf, unsere Aktivitäten vorstellen zu können und damit auch die HTWK entsprechend zu promoten. Für unsere Studierende ist eine solche lokale Messe zudem eine hervorragende Möglichkeit, PV-Anwendungen praxisnah und quasi vor der Haustür präsentiert zu bekommen.“
Weitere Forschende der HTWK Leipzig arbeiten unter anderem daran, die Qualitätskontrolle und den Betrieb von Solarzellen zu optimieren und damit die Energieausbeute zu steigern. Andere befassen sich mit senkrecht installierten bifazialen Solarmodulen, die auf beiden Seiten insbesondere die auf- und untergehende Sonne nutzen und so die Verfügbarkeit der Solarenergie in die wertvollen Morgen- und Abendstunden verschieben. Um die Wirkung von Sonnenenergie als neuen Energielieferanten bestmöglich zur Geltung zu bringen, arbeiten die HTWK-Forschenden zudem an einer Weiterentwicklung der Stromnetze: auch diese müssen leistungsfähiger, flexibler und intelligenter werden.
Freitickets für die Messe per Promo-Code
Tickets für die Solar Solutions Leipzig können über die Webseite bestellt werden. Normalerweise kostet ein Ticket 75 Euro (zuzüglich Mehrwertsteuer). Es besteht aber die Möglichkeit, Freitickets zu bekommen, in dem der Promocode „PHOTOVOLTAIK24“ genutzt wird. Zum Ticketshop der Solar Solutions Leipzig.
Hintergrund zur Solar Solutions Leipzig
Nach dem Vorbild in Düsseldorf und Bremen gibt es mit der Solar Solutions Leipzig die Regionalmesse nun auch in Sachsen: hier sollen sich Hersteller, Fachleute und B2B-Kundinnen und -Kunden aus dem privaten und gewerblichen Markt über neueste Trends, Innovationen und Produkte austauschen können.
Die Ausstellung befindet sich in Halle 4 auf dem Leipziger Messegelände. In der „Seminar Arena“ gibt es die Präsentationen zu sehen. Der Vortrag zur HTWK-Solarforschung findet am 2. Messetag um 15 Uhr statt.
Prof. Marco Krondorf erlangt die Venia Legendi der TU Dresden mit dem Abschluss seines Habilitationsverfahrens. Die Arbeit behandelt neue Forschungsergebnisse der Nachrichtentechnik im Bereich der LEO-Satellitenkommunikation. LEO-Satellitensysteme sind derzeit in aller Munde. Das bekannteste Beispiel ist wohl das Starlink System von Elon Musk.
Prof. Marco Krondorf forschte im Bereich der stochastischen Modellierung der Signalerkennung und Modulation und zur Algorithmenentwicklung für Echtzeitempfänger.
Die Arbeit ist als Fachbuch im Vogt Verlag unter der ISBN 978-3-95947-075-9 erschienen.
„ProHydroComp zielt darauf ab, die Energieversorgung der ukrainischen Wirtschaft zu stabilisieren, indem werkstoffbasierte Instandhaltungsmaßnahmen zum Schutz vor korrosionsbedingten Schäden in ukrainischen Wasserkraftwerken entwickelt und erprobt werden. Mein Kollege Dr. Rassokhin hat bereits während seiner Tätigkeit an der PSTU in Mariupol ähnliche Materialsysteme entwickelt, konnte diese Konzepte aber aufgrund der Zerstörung von Mariupol nicht mehr großskalig umsetzen. Ich bin daher froh, dass diese kostengünstigen und effizienten Schutzmaßnahmen nun durch eine Forschungskooperation mit der HTWK Leipzig weiterverfolgt werden können“, erläutert Projektleiter Prof. Robert Böhm (Professur für Leichtbau mit Verbundwerkstoffen). In ProHydroComp sind auch Maßnahmen des wissenschaftlichen Personenaustauschs geplant, um die Forschungskooperation zwischen Deutschland und der Ukraine zukünftig stärken.

„Unsere Beschichtungstechnologie basiert auf nanopartikelverstärkten Duroplasten, die kostengünstig und großflächig einsetzbar sind und vor Ort in der Ukraine erprobt werden können. Diese Beschichtungen erhöhen die Zuverlässigkeit bestehender Anlagen in Wasserkraftwerken, indem sie deren Lebensdauer um das Drei- bis Vierfache erhöhen und gleichzeitig neue Korrosionsschäden vorbeugt. Unsere Partner in Dnipro werden unsere verbesserte Beschichtung in bestehenden Anlagen in einem in Betrieb befindlichen Wasserkraftwerk erproben. Perspektivisch soll die Beschichtung auch in anderen Bereichen Anwendung finden.“, erklärt Dr. Dmytro Rassokhin den wissenschaftlichen Neuigkeitsgrad des Vorhabens. Das Projekt ProHydroComp läuft bis Ende Juni 2026.

Am 6. Januar 2025 trafen sich die Kooperationspartner für ein Auftakt-Treffen im Kreativraum der Startbahn 13 am Forschungscampus Eilenburger Straße. Neben einem gegenseitigen Kennenlernen aller Projektbeteiligten war vor allem ein gemeinsames Verständnis von Aufgaben und Rollen im Projekt Ziel des Treffens. Sie erarbeiteten einem Arbeitsplan für die nächsten Monate und vereinbarten, auch wohnungssuchende Klientinnen und weitere Partner wie Fachkräfte im Gewaltschutz, Wohnungsanbietende/-unternehmen, kommunale Akteure sowie die Sächsische Zukunftsplattform für Soziale Innovationen SINN einzubinden.
Passgenaue Wohnungsangebote vermitteln
Das an die Fakultät Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftsingenieurwesen und an die Interdisziplinäre Forschungsstelle Sicheres Wohnen und Häusliche Gewalt angebundene Team der HTWK Leipzig wird zukünftig durch Master-Studierende der Fakultät Informatik und Medien sowie beratend durch Prof. Dr. Jörg Bleymehl ergänzt. Die Studierenden wollen im Rahmen des Projekts eine digitale Schnittstelle zur Übermittlung passgenauer Wohnungsangebote entwickeln.
Das Projekt wird als Modellvorhaben sozialer Innovationen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus vom Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2026 gefördert.
Das Mentoring-Programm ist eines von mehreren Programmformaten des Female Scientists Networks, mit denen die HTWK Leipzig einen Beitrag zur hochschulweiten Sichtbarkeit, Vernetzung und Qualifizierung von Wissenschaftlerinnen aller Karrierestufen leisten möchte.
Wissenschaft? Promotion? Karriere?
Wer sich während des Masterstudiums oder kurz nach dem Berufseinstieg mit Peers darüber beraten möchte, ob eine Promotion der nächste Schritt sein könnte, ist hier genau richtig. Denn Ment4Science ermöglicht es Masterstudentinnen und wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, sich mit Gleichgesinnten auf Augenhöhe über die Perspektive der „Promotion“ auszutauschen. Dieser Austausch wird von einer Mentorin begleitet, die aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen wertvolle Ratschläge zur Entscheidungsfindung und bewährte Strategien für den Weg in die Wissenschaft teilt. Mithilfe des Peer- und Gruppen-Mentorings bietet das Programm während eines Semesters Raum und Zeit, Impulse und Antworten zu zentralen Fragen wie z.B. der Finanzierung, den ersten Schritten, individuellen Karrierewünschen oder persönlichen Potenzialen zu erhalten. Vor dem Programmstart erhalten sowohl die Teilnehmerinnen als auch die Mentorin ein Mentoring-Briefing, während des Semesters werden Sie von der Projektkoordinatorin begleitet.
Machen Sie den nächsten Schritt!
Melden Sie sich bei Interesse bis zum 15. März 2025 über das Anmeldeformular an und freuen Sie sich im Sommersemester auf einen inspirierenden und empowernden Austausch mit Gleichgesinnten. Weitere Informationen zum Programm und Ablauf finden Sie auf der Programmwebseite.
Bund-Länder-Programm "FH-Personal"
Ment4Science ist ein Programmformat des Female Scientists Networks im umfassenden Projekt Science Careers, das im Rahmen des Bund-Länder-Programms "FH-Personal" unterstützt wird. Dieses Programm hat das Ziel, hochschul- und standortspezifische Konzepte für innovative Ansätze zur Rekrutierung und Qualifizierung des akademischen Nachwuchses zu entwickeln und umzusetzen. Weitere Informationen sind auf der Webseite des Förderprogramms FH-Personal abrufbar.
Alle interessierten Gäste können dabei in einer offenen Runde Fragen über verschiedene Herausforderungen stellen, die während der Promotion auftreten können. Dies beginnt beim Finden eines Doktorvaters oder einer Doktormutter, der Wahl eines passenden Themas und dem Erstellen eines Exposés und geht über Hürden im Bereich Vernetzung, Recherche, Entwicklung einer Forschungsmethodik oder dem effektiven Zeitmanagement insbesondere während des Schreibprozesses und endet bei Fragen zur Einreichung der Arbeit, der Vorbereitung der Verteidigung oder der abschließenden Veröffentlichung der Dissertation.
Eine Anmeldung zum Workshop ist nicht notwendig, hilft der PromovierendenVertretung aber bei der Planung. Interessierte werden zudem gebeten, sich im Vorfeld über eigene Herausforderungen in ihrer Promotion Gedanken zu machen.
Tag: Donnerstag, 23. Januar 2025
Zeit: 17:00 bis 18:30 Uhr
Ort: Nieperbau, Raum NI 002
Weitere Termine
Am Mittwoch, den 19. Februar 2025, gibt es im Promovierendenkolloquium wieder zwei Vorträge: Zum einen stellt Florian Muschka von der Fakultät Informatik und Medien seine Forschungen zur medizinischen Diagnostik vor, bei der Medizintests auf papierbasierten Trägern als plastikfreie Alternative entwickelt werden, und zum anderen gibt Max Jäschke von der Fakultät Ingenieurwissenschaften Einblicke in sein Promotionsvorhaben zur Wärmeversorgung mit erdgekoppelten Wärmepumpensystemen mit Erdwärmesonden.
Mit dem Beginn des Jahres 2025 strukturiert sich die Forschungsgruppe Leichtbau an der HTWK neu und gründet das „Composite Circularity Lab“ (CCL) und das „Advanced Materials and Structures Lab" (AMSL). In den zwei Labs werden die Kernkompetenzen der Professur für Leichtbau fortan stärker gebündelt, um Synergien zwischen laufenden Forschungsprojekten noch besser nutzen zu können. „Die beiden Themen ‚Kreislaufwirtschaft mit Verbundwerkstoffen‘ und ‚Advanced Materials‘ haben sich in den letzten Jahren als äußerst relevante Forschungsthemen erwiesen, die sowohl in der Innovationsstrategie des Freistaats Sachsen, in der FONA-Strategie der Bundesregierung und in der Advanced Materials Initiative 2030 der EU-Kommission verankert sind. Diese Themen werden daher in der Zukunft auch an der HTWK eine noch größere Rolle als bislang spielen.“, erklärt Prof. Robert Böhm.
Das neue „Composite Circularity Lab” widmet sich in Forschung, Lehre und Transfer der Entwicklung kreislaufgerechter Ingenieurlösungen für den Faserverbundsektor. „Für verschiedene Industriezweige wie die Windenergiebranche, die Luft- und Raumfahrt und die Automobilindustrie entwickeln wir Kreislauf-Strategien, die aus den Elementen Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose und Recycling bestehen. In verschiedenen Forschungsprojekten fokussieren wir uns insbesondere auf die Eigenschaftsbewertung der Faserverbundstrukturen und die Umsetzung von Repurpose-Demonstrator-Lösungen, die wir in serienfähige Anwendungen überführen wollen.“, erläutert Forschungsgruppenleiter Philipp Johst die Ziele des CCL.